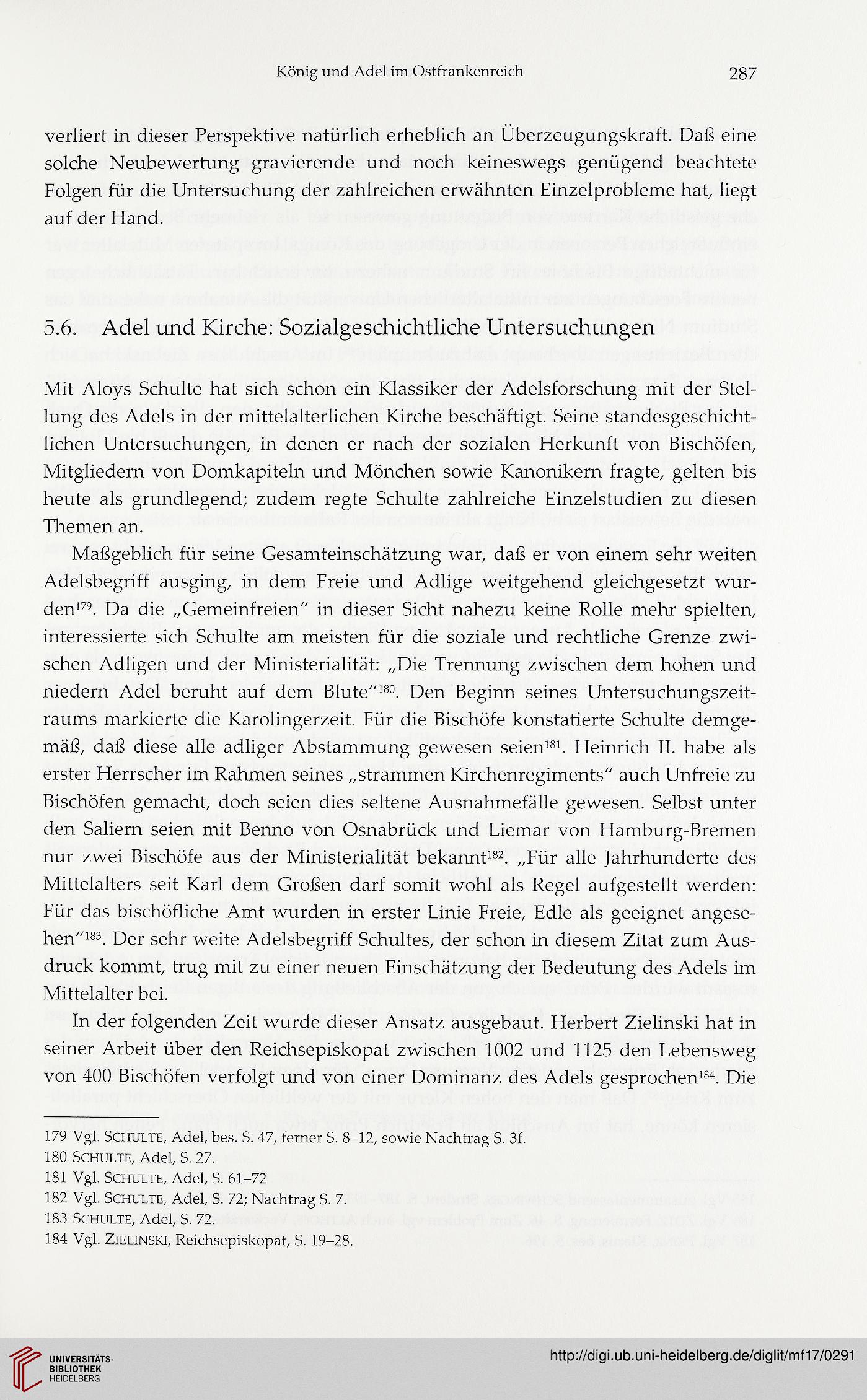König und Adel im Ostfrankenreich
287
verliert in dieser Perspektive natürlich erheblich an Überzeugungskraft. Daß eine
solche Neubewertung gravierende und noch keineswegs genügend beachtete
Folgen für die Untersuchung der zahlreichen erwähnten Einzelprobleme hat, liegt
auf der Hand.
5.6. Adel und Kirche: Sozialgeschichtliche Untersuchungen
Mit Aloys Schulte hat sich schon ein Klassiker der Adelsforschung mit der Stel-
lung des Adels in der mittelalterlichen Kirche beschäftigt. Seine standesgeschicht-
lichen Untersuchungen, in denen er nach der sozialen Herkunft von Bischöfen,
Mitgliedern von Domkapiteln und Mönchen sowie Kanonikern fragte, gelten bis
heute als grundlegend; zudem regte Schulte zahlreiche Einzelstudien zu diesen
Themen an.
Maßgeblich für seine Gesamteinschätzung war, daß er von einem sehr weiten
Adelsbegriff ausging, in dem Freie und Adlige weitgehend gleichgesetzt wur-
deUA Da die „Gemeinfreien" in dieser Sicht nahezu keine Rolle mehr spielten,
interessierte sich Schulte am meisten für die soziale und rechtliche Grenze zwi-
schen Adligen und der Ministerialität: „Die Trennung zwischen dem hohen und
niedern Adel beruht auf dem Blute"^°. Den Beginn seines Untersuchungszeit-
raums markierte die Karolingerzeit. Für die Bischöfe konstatierte Schulte demge-
mäß, daß diese alle adliger Abstammung gewesen seiend Heinrich II. habe als
erster Herrscher im Rahmen seines „strammen Kirchenregiments" auch Unfreie zu
Bischöfen gemacht, doch seien dies seltene Ausnahmefälle gewesen. Selbst unter
den Saliern seien mit Benno von Osnabrück und Liemar von Hamburg-Bremen
nur zwei Bischöfe aus der Ministerialität bekannt^. „Für alle Jahrhunderte des
Mittelalters seit Karl dem Großen darf somit wohl als Regel aufgestellt werden:
Für das bischöfliche Amt wurden in erster Linie Freie, Edle als geeignet angese-
hen"^. Der sehr weite Adelsbegriff Schuhes, der schon in diesem Zitat zum Aus-
druck kommt, trug mit zu einer neuen Einschätzung der Bedeutung des Adels im
Mittelalter bei.
In der folgenden Zeit wurde dieser Ansatz ausgebaut. Herbert Zielinski hat in
seiner Arbeit über den Reichsepiskopat zwischen 1002 und 1125 den Lebensweg
von 400 Bischöfen verfolgt und von einer Dominanz des Adels gesprochen^. Die
179 Vgl. SCHULTE, Adel, bes. S. 47, ferner S. 8-12, sowie Nachtrag S. 3f.
180 SCHULTE, Adel, S. 27.
181 Vgl. SCHULTE, Adel, S. 61-72
182 Vgl. SCHULTE, Adel, S. 72; Nachtrag S. 7.
183 SCHULTE, Adel, S. 72.
184 Vgl. ZlELlNSKl, Reichsepiskopat, S. 19-28.
287
verliert in dieser Perspektive natürlich erheblich an Überzeugungskraft. Daß eine
solche Neubewertung gravierende und noch keineswegs genügend beachtete
Folgen für die Untersuchung der zahlreichen erwähnten Einzelprobleme hat, liegt
auf der Hand.
5.6. Adel und Kirche: Sozialgeschichtliche Untersuchungen
Mit Aloys Schulte hat sich schon ein Klassiker der Adelsforschung mit der Stel-
lung des Adels in der mittelalterlichen Kirche beschäftigt. Seine standesgeschicht-
lichen Untersuchungen, in denen er nach der sozialen Herkunft von Bischöfen,
Mitgliedern von Domkapiteln und Mönchen sowie Kanonikern fragte, gelten bis
heute als grundlegend; zudem regte Schulte zahlreiche Einzelstudien zu diesen
Themen an.
Maßgeblich für seine Gesamteinschätzung war, daß er von einem sehr weiten
Adelsbegriff ausging, in dem Freie und Adlige weitgehend gleichgesetzt wur-
deUA Da die „Gemeinfreien" in dieser Sicht nahezu keine Rolle mehr spielten,
interessierte sich Schulte am meisten für die soziale und rechtliche Grenze zwi-
schen Adligen und der Ministerialität: „Die Trennung zwischen dem hohen und
niedern Adel beruht auf dem Blute"^°. Den Beginn seines Untersuchungszeit-
raums markierte die Karolingerzeit. Für die Bischöfe konstatierte Schulte demge-
mäß, daß diese alle adliger Abstammung gewesen seiend Heinrich II. habe als
erster Herrscher im Rahmen seines „strammen Kirchenregiments" auch Unfreie zu
Bischöfen gemacht, doch seien dies seltene Ausnahmefälle gewesen. Selbst unter
den Saliern seien mit Benno von Osnabrück und Liemar von Hamburg-Bremen
nur zwei Bischöfe aus der Ministerialität bekannt^. „Für alle Jahrhunderte des
Mittelalters seit Karl dem Großen darf somit wohl als Regel aufgestellt werden:
Für das bischöfliche Amt wurden in erster Linie Freie, Edle als geeignet angese-
hen"^. Der sehr weite Adelsbegriff Schuhes, der schon in diesem Zitat zum Aus-
druck kommt, trug mit zu einer neuen Einschätzung der Bedeutung des Adels im
Mittelalter bei.
In der folgenden Zeit wurde dieser Ansatz ausgebaut. Herbert Zielinski hat in
seiner Arbeit über den Reichsepiskopat zwischen 1002 und 1125 den Lebensweg
von 400 Bischöfen verfolgt und von einer Dominanz des Adels gesprochen^. Die
179 Vgl. SCHULTE, Adel, bes. S. 47, ferner S. 8-12, sowie Nachtrag S. 3f.
180 SCHULTE, Adel, S. 27.
181 Vgl. SCHULTE, Adel, S. 61-72
182 Vgl. SCHULTE, Adel, S. 72; Nachtrag S. 7.
183 SCHULTE, Adel, S. 72.
184 Vgl. ZlELlNSKl, Reichsepiskopat, S. 19-28.