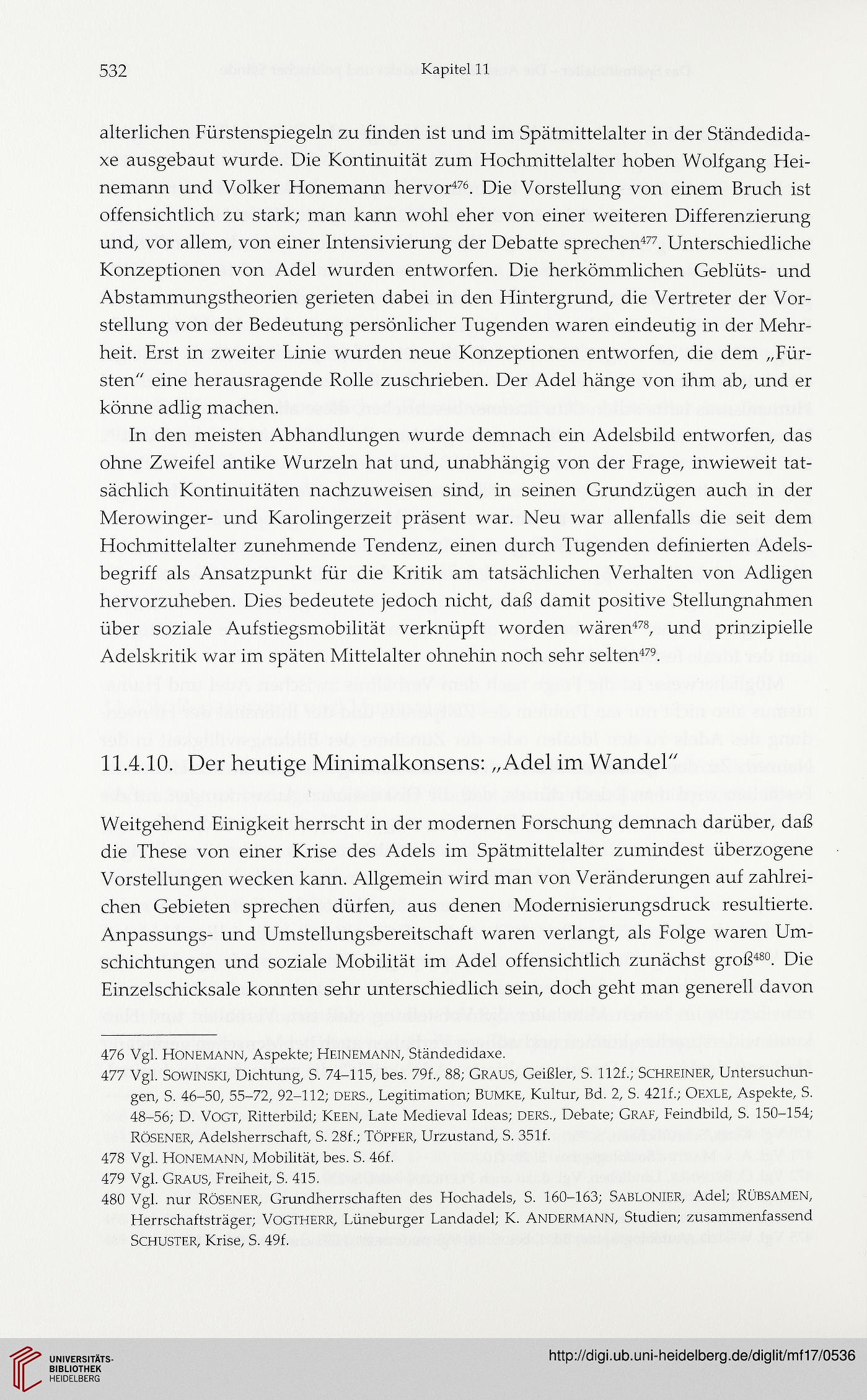532
Kapitel 11
alterlichen Fürstenspiegeln zu finden ist und im Spätmittelalter in der Ständedida-
xe ausgebaut wurde. Die Kontinuität zum Hochmittelalter hoben Wolfgang Hei-
nemann und Volker Honemann hervorW Die Vorstellung von einem Bruch ist
offensichtlich zu stark; man kann wohl eher von einer weiteren Differenzierung
und, vor allem, von einer Intensivierung der Debatte sprechen^. Unterschiedliche
Konzeptionen von Adel wurden entworfen. Die herkömmlichen Geblüts- und
Abstammungstheorien gerieten dabei in den Hintergrund, die Vertreter der Vor-
stellung von der Bedeutung persönlicher Tugenden waren eindeutig in der Mehr-
heit. Erst in zweiter Linie wurden neue Konzeptionen entworfen, die dem „Für-
sten" eine herausragende Rolle zuschrieben. Der Adel hänge von ihm ab, und er
könne adlig machen.
In den meisten Abhandlungen wurde demnach ein Adelsbild entworfen, das
ohne Zweifel antike Wurzeln hat und, unabhängig von der Frage, inwieweit tat-
sächlich Kontinuitäten nachzuweisen sind, in seinen Grundzügen auch in der
Merowinger- und Karolingerzeit präsent war. Neu war allenfalls die seit dem
Hochmittelalter zunehmende Tendenz, einen durch Tugenden definierten Adels-
begriff als Ansatzpunkt für die Kritik am tatsächlichen Verhalten von Adligen
hervorzuheben. Dies bedeutete jedoch nicht, daß damit positive Stellungnahmen
über soziale Aufstiegsmobilität verknüpft worden wärenW und prinzipielle
Adelskritik war im späten Mittelalter ohnehin noch sehr seltenW
11.4.10. Der heutige Minimalkonsens: „Adel im Wandel"
Weitgehend Einigkeit herrscht in der modernen Forschung demnach darüber, daß
die These von einer Krise des Adels im Spätmittelalter zumindest überzogene
Vorstellungen wecken kann. Allgemein wird man von Veränderungen auf zahlrei-
chen Gebieten sprechen dürfen, aus denen Modernisierungsdruck resultierte.
Anpassungs- und Umstellungsbereitschaft waren verlangt, als Folge waren Um-
schichtungen und soziale Mobilität im Adel offensichtlich zunächst großW Die
Einzelschicksale konnten sehr unterschiedlich sein, doch geht man generell davon
476 Vgl. HONEMANN, Aspekte; HEINEMANN, Ständedidaxe.
477 Vgl. SOWINSKI, Dichtung, S. 74-115, bes. 79t., 88; GRAUS, Geißler, S. 112f.; SCHREINER, Untersuchun-
gen, S. 46-50, 55-72, 92-112; DERS., Legitimation; BUMKE, Kultur, Bd. 2, S. 421f.; OEXLE, Aspekte, S.
48-56; D. VOGT, Ritterbild; KEEN, Late Medieval Ideas; DERS., Debate; GRAF, Feindbild, S. 150-154;
RÖSENER, Adelsherrschatt, S. 28t.; TÖPFER, Urzustand, S. 351t.
478 Vgl. HONEMANN, Mobilität, bes. S. 46t.
479 Vgl. GRAUS, Freiheit, S. 415.
480 Vgl. nur RÖSENER, Grundherrschaften des Hochadels, S. 160-163; SABLONIER, Adel; RÜBSAMEN,
Herrschaftsträger; VOGTHERR, Lüneburger Landadel; K. ANDERMANN, Studien; zusammenfassend
SCHUSTER, Krise, S. 49f.
Kapitel 11
alterlichen Fürstenspiegeln zu finden ist und im Spätmittelalter in der Ständedida-
xe ausgebaut wurde. Die Kontinuität zum Hochmittelalter hoben Wolfgang Hei-
nemann und Volker Honemann hervorW Die Vorstellung von einem Bruch ist
offensichtlich zu stark; man kann wohl eher von einer weiteren Differenzierung
und, vor allem, von einer Intensivierung der Debatte sprechen^. Unterschiedliche
Konzeptionen von Adel wurden entworfen. Die herkömmlichen Geblüts- und
Abstammungstheorien gerieten dabei in den Hintergrund, die Vertreter der Vor-
stellung von der Bedeutung persönlicher Tugenden waren eindeutig in der Mehr-
heit. Erst in zweiter Linie wurden neue Konzeptionen entworfen, die dem „Für-
sten" eine herausragende Rolle zuschrieben. Der Adel hänge von ihm ab, und er
könne adlig machen.
In den meisten Abhandlungen wurde demnach ein Adelsbild entworfen, das
ohne Zweifel antike Wurzeln hat und, unabhängig von der Frage, inwieweit tat-
sächlich Kontinuitäten nachzuweisen sind, in seinen Grundzügen auch in der
Merowinger- und Karolingerzeit präsent war. Neu war allenfalls die seit dem
Hochmittelalter zunehmende Tendenz, einen durch Tugenden definierten Adels-
begriff als Ansatzpunkt für die Kritik am tatsächlichen Verhalten von Adligen
hervorzuheben. Dies bedeutete jedoch nicht, daß damit positive Stellungnahmen
über soziale Aufstiegsmobilität verknüpft worden wärenW und prinzipielle
Adelskritik war im späten Mittelalter ohnehin noch sehr seltenW
11.4.10. Der heutige Minimalkonsens: „Adel im Wandel"
Weitgehend Einigkeit herrscht in der modernen Forschung demnach darüber, daß
die These von einer Krise des Adels im Spätmittelalter zumindest überzogene
Vorstellungen wecken kann. Allgemein wird man von Veränderungen auf zahlrei-
chen Gebieten sprechen dürfen, aus denen Modernisierungsdruck resultierte.
Anpassungs- und Umstellungsbereitschaft waren verlangt, als Folge waren Um-
schichtungen und soziale Mobilität im Adel offensichtlich zunächst großW Die
Einzelschicksale konnten sehr unterschiedlich sein, doch geht man generell davon
476 Vgl. HONEMANN, Aspekte; HEINEMANN, Ständedidaxe.
477 Vgl. SOWINSKI, Dichtung, S. 74-115, bes. 79t., 88; GRAUS, Geißler, S. 112f.; SCHREINER, Untersuchun-
gen, S. 46-50, 55-72, 92-112; DERS., Legitimation; BUMKE, Kultur, Bd. 2, S. 421f.; OEXLE, Aspekte, S.
48-56; D. VOGT, Ritterbild; KEEN, Late Medieval Ideas; DERS., Debate; GRAF, Feindbild, S. 150-154;
RÖSENER, Adelsherrschatt, S. 28t.; TÖPFER, Urzustand, S. 351t.
478 Vgl. HONEMANN, Mobilität, bes. S. 46t.
479 Vgl. GRAUS, Freiheit, S. 415.
480 Vgl. nur RÖSENER, Grundherrschaften des Hochadels, S. 160-163; SABLONIER, Adel; RÜBSAMEN,
Herrschaftsträger; VOGTHERR, Lüneburger Landadel; K. ANDERMANN, Studien; zusammenfassend
SCHUSTER, Krise, S. 49f.