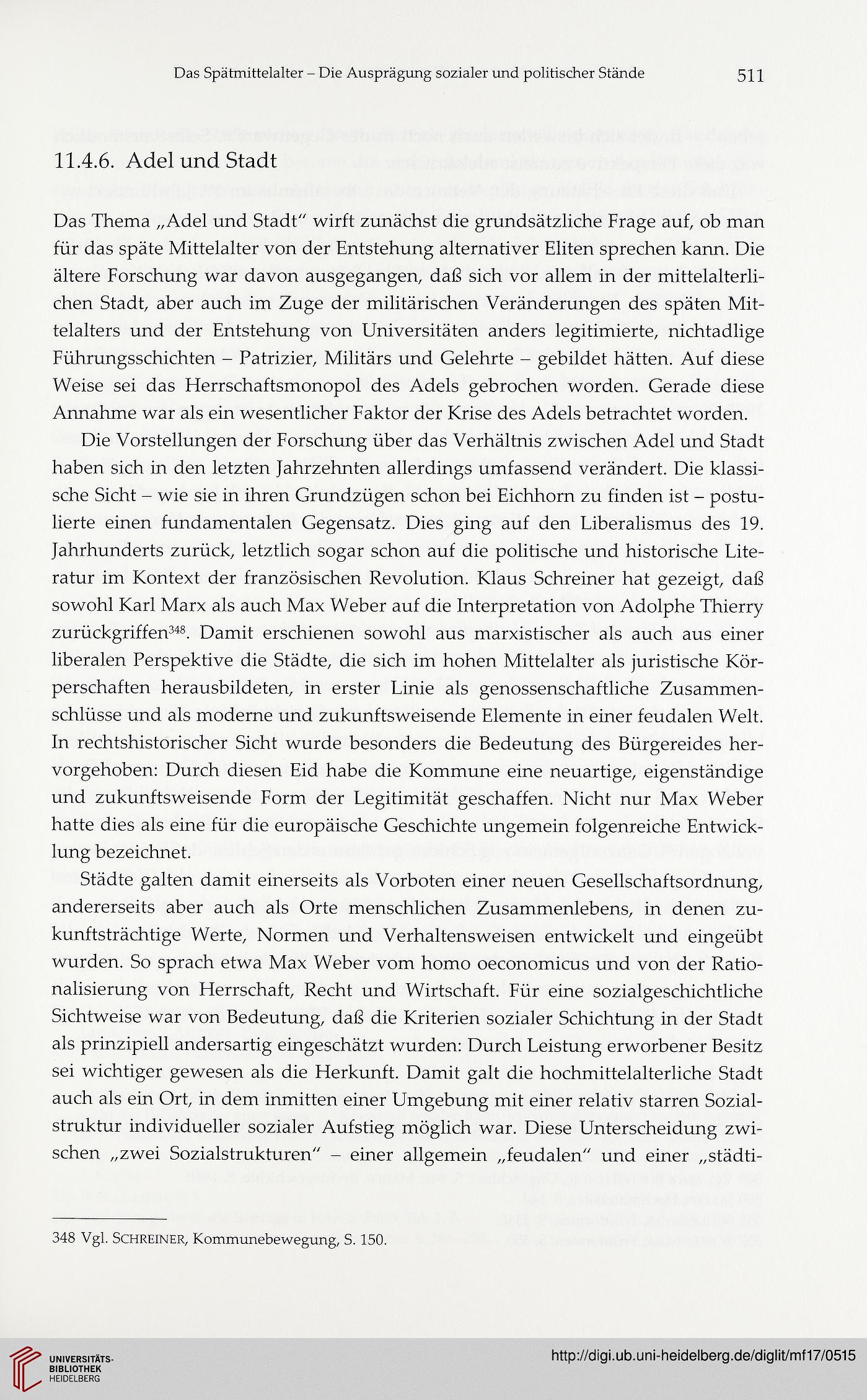Das Spätmittelalter - Die Ausprägung sozialer und politischer Stände
511
11.4.6. Adel und Stadt
Das Thema „Adel und Stadt" wirft zunächst die grundsätzliche Frage auf, ob man
für das späte Mittelalter von der Entstehung alternativer Eliten sprechen kann. Die
ältere Forschung war davon ausgegangen, daß sich vor allem in der mittelalterli-
chen Stadt, aber auch im Zuge der militärischen Veränderungen des späten Mit-
telalters und der Entstehung von Universitäten anders legitimierte, nichtadlige
Führungsschichten - Patrizier, Militärs und Gelehrte - gebildet hätten. Auf diese
Weise sei das Herrschaftsmonopol des Adels gebrochen worden. Gerade diese
Annahme war als ein wesentlicher Faktor der Krise des Adels betrachtet worden.
Die Vorstellungen der Forschung über das Verhältnis zwischen Adel und Stadt
haben sich in den letzten Jahrzehnten allerdings umfassend verändert. Die klassi-
sche Sicht - wie sie in ihren Grundzügen schon bei Eichhorn zu finden ist - postu-
lierte einen fundamentalen Gegensatz. Dies ging auf den Liberalismus des 19.
Jahrhunderts zurück, letztlich sogar schon auf die politische und historische Lite-
ratur im Kontext der französischen Revolution. Klaus Schreiner hat gezeigt, daß
sowohl Karl Marx als auch Max Weber auf die Interpretation von Adolphe Thierry
zurückgriffen^. Damit erschienen sowohl aus marxistischer als auch aus einer
liberalen Perspektive die Städte, die sich im hohen Mittelalter als juristische Kör-
perschaften herausbildeten, in erster Linie als genossenschaftliche Zusammen-
schlüsse und als moderne und zukunftsweisende Elemente in einer feudalen Welt.
In rechtshistorischer Sicht wurde besonders die Bedeutung des Bürgereides her-
vorgehoben: Durch diesen Eid habe die Kommune eine neuartige, eigenständige
und zukunftsweisende Form der Legitimität geschaffen. Nicht nur Max Weber
hatte dies als eine für die europäische Geschichte ungemein folgenreiche Entwick-
lung bezeichnet.
Städte galten damit einerseits als Vorboten einer neuen Gesellschaftsordnung,
andererseits aber auch als Orte menschlichen Zusammenlebens, in denen zu-
kunftsträchtige Werte, Normen und Verhaltensweisen entwickelt und eingeübt
wurden. So sprach etwa Max Weber vom homo oeconomicus und von der Ratio-
nalisierung von Herrschaft, Recht und Wirtschaft. Für eine sozialgeschichtliche
Sichtweise war von Bedeutung, daß die Kriterien sozialer Schichtung in der Stadt
als prinzipiell andersartig eingeschätzt wurden: Durch Leistung erworbener Besitz
sei wichtiger gewesen als die Herkunft. Damit galt die hochmittelalterliche Stadt
auch als ein Ort, in dem inmitten einer Umgebung mit einer relativ starren Sozial-
struktur individueller sozialer Aufstieg möglich war. Diese Unterscheidung zwi-
schen „zwei Sozialstrukturen" - einer allgemein „feudalen" und einer „städti-
348 Vgl. SCHREINER, Kommunebewegung, S. 150.
511
11.4.6. Adel und Stadt
Das Thema „Adel und Stadt" wirft zunächst die grundsätzliche Frage auf, ob man
für das späte Mittelalter von der Entstehung alternativer Eliten sprechen kann. Die
ältere Forschung war davon ausgegangen, daß sich vor allem in der mittelalterli-
chen Stadt, aber auch im Zuge der militärischen Veränderungen des späten Mit-
telalters und der Entstehung von Universitäten anders legitimierte, nichtadlige
Führungsschichten - Patrizier, Militärs und Gelehrte - gebildet hätten. Auf diese
Weise sei das Herrschaftsmonopol des Adels gebrochen worden. Gerade diese
Annahme war als ein wesentlicher Faktor der Krise des Adels betrachtet worden.
Die Vorstellungen der Forschung über das Verhältnis zwischen Adel und Stadt
haben sich in den letzten Jahrzehnten allerdings umfassend verändert. Die klassi-
sche Sicht - wie sie in ihren Grundzügen schon bei Eichhorn zu finden ist - postu-
lierte einen fundamentalen Gegensatz. Dies ging auf den Liberalismus des 19.
Jahrhunderts zurück, letztlich sogar schon auf die politische und historische Lite-
ratur im Kontext der französischen Revolution. Klaus Schreiner hat gezeigt, daß
sowohl Karl Marx als auch Max Weber auf die Interpretation von Adolphe Thierry
zurückgriffen^. Damit erschienen sowohl aus marxistischer als auch aus einer
liberalen Perspektive die Städte, die sich im hohen Mittelalter als juristische Kör-
perschaften herausbildeten, in erster Linie als genossenschaftliche Zusammen-
schlüsse und als moderne und zukunftsweisende Elemente in einer feudalen Welt.
In rechtshistorischer Sicht wurde besonders die Bedeutung des Bürgereides her-
vorgehoben: Durch diesen Eid habe die Kommune eine neuartige, eigenständige
und zukunftsweisende Form der Legitimität geschaffen. Nicht nur Max Weber
hatte dies als eine für die europäische Geschichte ungemein folgenreiche Entwick-
lung bezeichnet.
Städte galten damit einerseits als Vorboten einer neuen Gesellschaftsordnung,
andererseits aber auch als Orte menschlichen Zusammenlebens, in denen zu-
kunftsträchtige Werte, Normen und Verhaltensweisen entwickelt und eingeübt
wurden. So sprach etwa Max Weber vom homo oeconomicus und von der Ratio-
nalisierung von Herrschaft, Recht und Wirtschaft. Für eine sozialgeschichtliche
Sichtweise war von Bedeutung, daß die Kriterien sozialer Schichtung in der Stadt
als prinzipiell andersartig eingeschätzt wurden: Durch Leistung erworbener Besitz
sei wichtiger gewesen als die Herkunft. Damit galt die hochmittelalterliche Stadt
auch als ein Ort, in dem inmitten einer Umgebung mit einer relativ starren Sozial-
struktur individueller sozialer Aufstieg möglich war. Diese Unterscheidung zwi-
schen „zwei Sozialstrukturen" - einer allgemein „feudalen" und einer „städti-
348 Vgl. SCHREINER, Kommunebewegung, S. 150.