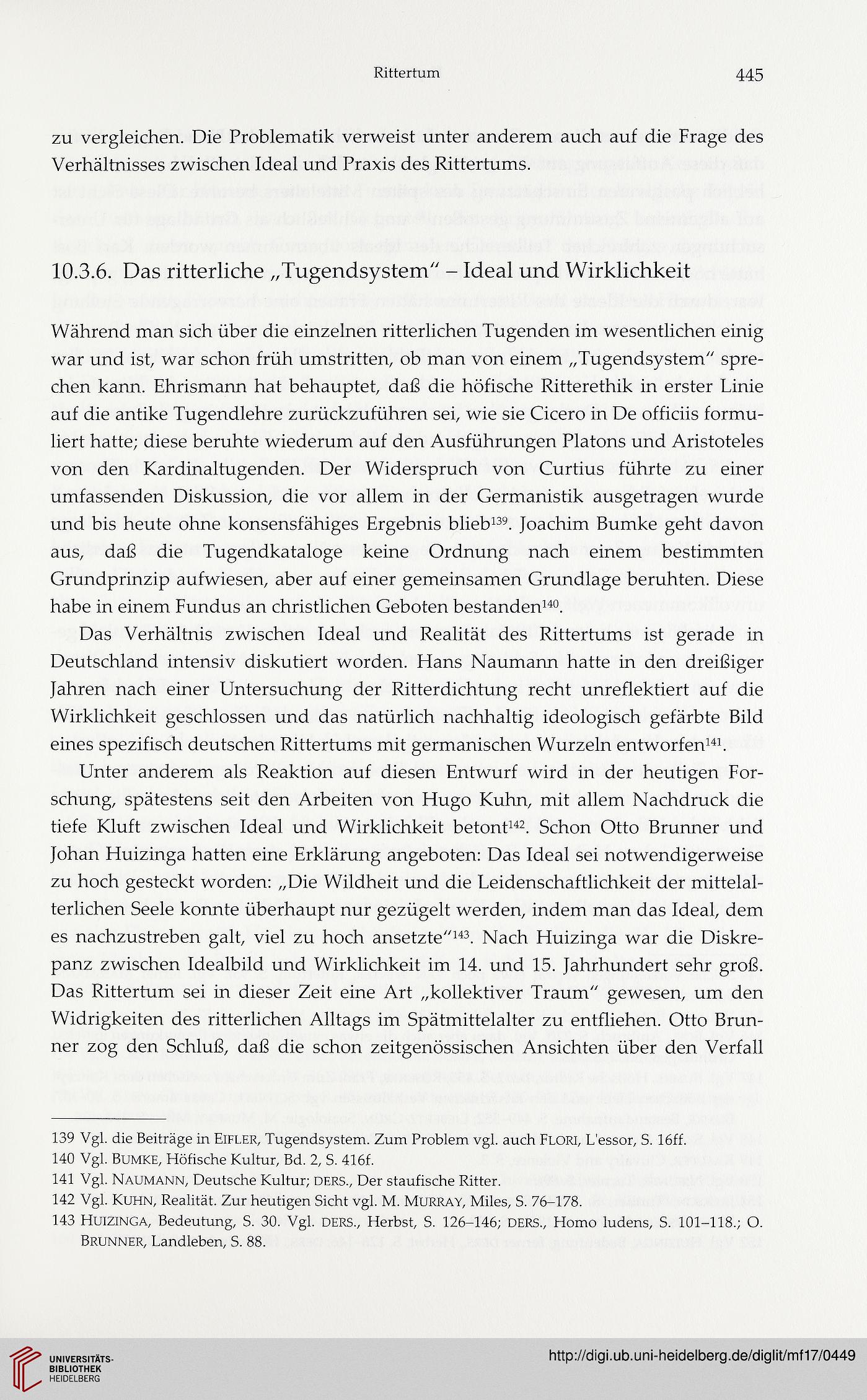Rittertum
445
zu vergleichen. Die Problematik verweist unter anderem auch auf die Frage des
Verhältnisses zwischen Ideal und Praxis des Rittertums.
10.3.6. Das ritterliche „Tugendsystem" - Ideal und Wirklichkeit
Während man sich über die einzelnen ritterlichen Tugenden im wesentlichen einig
war und ist, war schon früh umstritten, ob man von einem „Tugendsystem" spre-
chen kann. Ehrismann hat behauptet, daß die höfische Ritterethik in erster Linie
auf die antike Tugendlehre zurückzuführen sei, wie sie Cicero in De officiis formu-
liert hatte; diese beruhte wiederum auf den Ausführungen Platons und Aristoteles
von den Kardinaltugenden. Der Widerspruch von Curtius führte zu einer
umfassenden Diskussion, die vor allem in der Germanistik ausgetragen wurde
und bis heute ohne konsensfähiges Ergebnis blieDA Joachim Bumke geht davon
aus, daß die Tugendkataloge keine Ordnung nach einem bestimmten
Grundprinzip aufwiesen, aber auf einer gemeinsamen Grundlage beruhten. Diese
habe in einem Fundus an christlichen Geboten bestanden^".
Das Verhältnis zwischen Ideal und Realität des Rittertums ist gerade in
Deutschland intensiv diskutiert worden. Hans Naumann hatte in den dreißiger
Jahren nach einer Untersuchung der Ritterdichtung recht unreflektiert auf die
Wirklichkeit geschlossen und das natürlich nachhaltig ideologisch gefärbte Bild
eines spezifisch deutschen Rittertums mit germanischen Wurzeln entworfen^!
Unter anderem als Reaktion auf diesen Entwurf wird in der heutigen For-
schung, spätestens seit den Arbeiten von Hugo Kuhn, mit allem Nachdruck die
tiefe Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit betontW Schon Otto Brunner und
Johan Huizinga hatten eine Erklärung angeboten: Das Ideal sei notwendigerweise
zu hoch gesteckt worden: „Die Wildheit und die Leidenschaftlichkeit der mittelal-
terlichen Seele konnte überhaupt nur gezügelt werden, indem man das Ideal, dem
es nachzustreben galt, viel zu hoch ansetzte"^. Nach Huizinga war die Diskre-
panz zwischen Idealbild und Wirklichkeit im 14. und 15. Jahrhundert sehr groß.
Das Rittertum sei in dieser Zeit eine Art „kollektiver Traum" gewesen, um den
Widrigkeiten des ritterlichen Alltags im Spätmittelalter zu entfliehen. Otto Brun-
ner zog den Schluß, daß die schon zeitgenössischen Ansichten über den Verfall
139 Vgl. die Beiträge in ElFLER, Tugendsystem. Zum Problem vgl. auch FLORI, L'essor, S. 1611.
140 Vgl. BuMKE, Höfische Kultur, Bd. 2, S. 4161
141 Vgl. NAUMANN, Deutsche Kultur; DERS., Der staufische Ritter.
142 Vgl. KUHN, Realität. Zur heutigen Sicht vgl. M. MURRAY, Miles, S. 76-178.
143 HUIZINGA, Bedeutung, S. 30. Vgl. DERS., Herbst, S. 126-146; DERS., Homo ludens, S. 101-118.; O.
BRUNNER, Landleben, S. 88.
445
zu vergleichen. Die Problematik verweist unter anderem auch auf die Frage des
Verhältnisses zwischen Ideal und Praxis des Rittertums.
10.3.6. Das ritterliche „Tugendsystem" - Ideal und Wirklichkeit
Während man sich über die einzelnen ritterlichen Tugenden im wesentlichen einig
war und ist, war schon früh umstritten, ob man von einem „Tugendsystem" spre-
chen kann. Ehrismann hat behauptet, daß die höfische Ritterethik in erster Linie
auf die antike Tugendlehre zurückzuführen sei, wie sie Cicero in De officiis formu-
liert hatte; diese beruhte wiederum auf den Ausführungen Platons und Aristoteles
von den Kardinaltugenden. Der Widerspruch von Curtius führte zu einer
umfassenden Diskussion, die vor allem in der Germanistik ausgetragen wurde
und bis heute ohne konsensfähiges Ergebnis blieDA Joachim Bumke geht davon
aus, daß die Tugendkataloge keine Ordnung nach einem bestimmten
Grundprinzip aufwiesen, aber auf einer gemeinsamen Grundlage beruhten. Diese
habe in einem Fundus an christlichen Geboten bestanden^".
Das Verhältnis zwischen Ideal und Realität des Rittertums ist gerade in
Deutschland intensiv diskutiert worden. Hans Naumann hatte in den dreißiger
Jahren nach einer Untersuchung der Ritterdichtung recht unreflektiert auf die
Wirklichkeit geschlossen und das natürlich nachhaltig ideologisch gefärbte Bild
eines spezifisch deutschen Rittertums mit germanischen Wurzeln entworfen^!
Unter anderem als Reaktion auf diesen Entwurf wird in der heutigen For-
schung, spätestens seit den Arbeiten von Hugo Kuhn, mit allem Nachdruck die
tiefe Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit betontW Schon Otto Brunner und
Johan Huizinga hatten eine Erklärung angeboten: Das Ideal sei notwendigerweise
zu hoch gesteckt worden: „Die Wildheit und die Leidenschaftlichkeit der mittelal-
terlichen Seele konnte überhaupt nur gezügelt werden, indem man das Ideal, dem
es nachzustreben galt, viel zu hoch ansetzte"^. Nach Huizinga war die Diskre-
panz zwischen Idealbild und Wirklichkeit im 14. und 15. Jahrhundert sehr groß.
Das Rittertum sei in dieser Zeit eine Art „kollektiver Traum" gewesen, um den
Widrigkeiten des ritterlichen Alltags im Spätmittelalter zu entfliehen. Otto Brun-
ner zog den Schluß, daß die schon zeitgenössischen Ansichten über den Verfall
139 Vgl. die Beiträge in ElFLER, Tugendsystem. Zum Problem vgl. auch FLORI, L'essor, S. 1611.
140 Vgl. BuMKE, Höfische Kultur, Bd. 2, S. 4161
141 Vgl. NAUMANN, Deutsche Kultur; DERS., Der staufische Ritter.
142 Vgl. KUHN, Realität. Zur heutigen Sicht vgl. M. MURRAY, Miles, S. 76-178.
143 HUIZINGA, Bedeutung, S. 30. Vgl. DERS., Herbst, S. 126-146; DERS., Homo ludens, S. 101-118.; O.
BRUNNER, Landleben, S. 88.