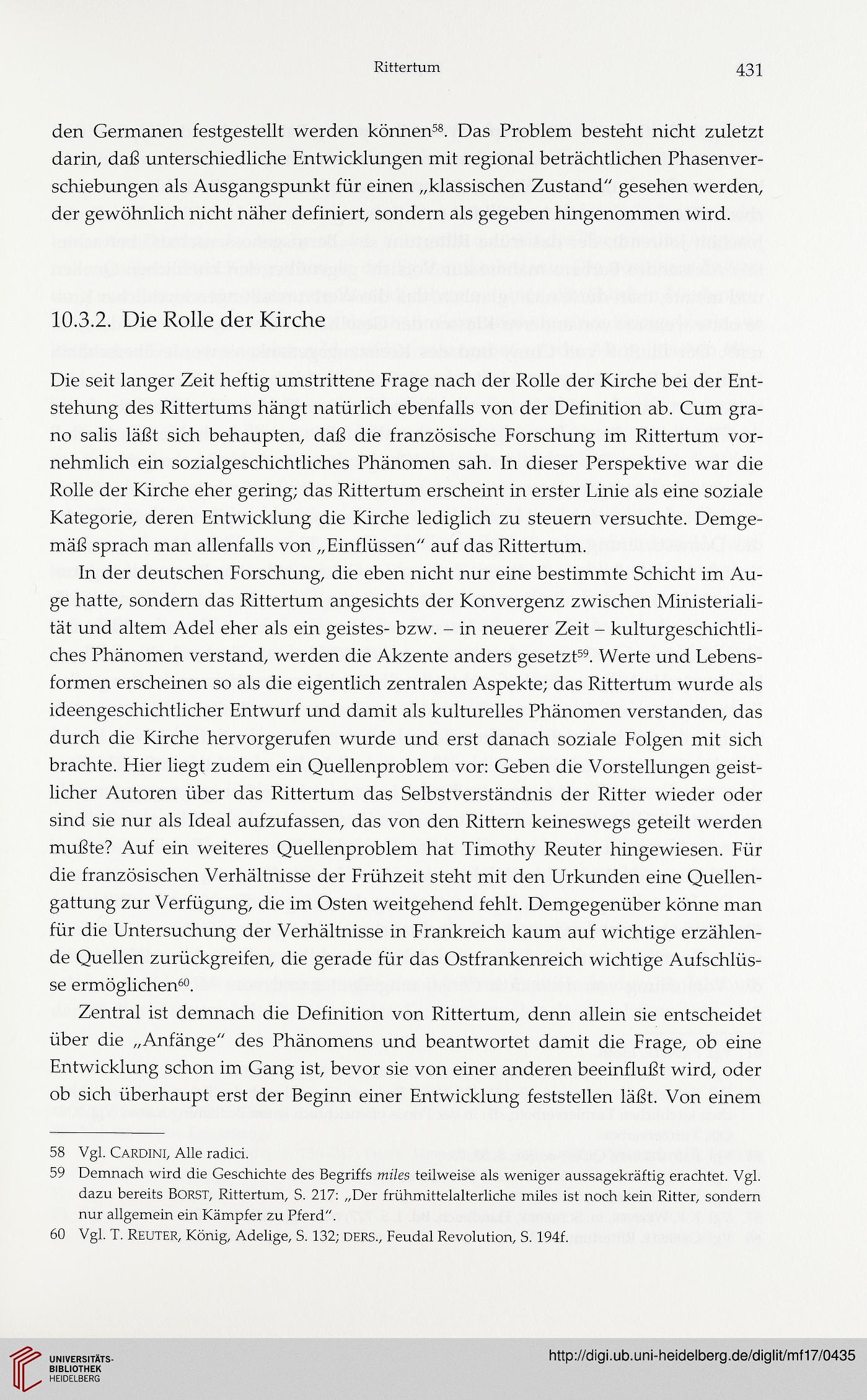Rittertum
431
den Germanen festgestellt werden können^. Das Problem besteht nicht zuletzt
darin, daß unterschiedliche Entwicklungen mit regional beträchtlichen Phasenver-
schiebungen als Ausgangspunkt für einen „klassischen Zustand" gesehen werden,
der gewöhnlich nicht näher definiert, sondern als gegeben hingenommen wird.
10.3.2. Die Rolle der Kirche
Die seit langer Zeit heftig umstrittene Frage nach der Rolle der Kirche bei der Ent-
stehung des Rittertums hängt natürlich ebenfalls von der Definition ab. Cum gra-
no salis läßt sich behaupten, daß die französische Forschung im Rittertum vor-
nehmlich ein sozialgeschichtliches Phänomen sah. In dieser Perspektive war die
Rolle der Kirche eher gering; das Rittertum erscheint in erster Linie als eine soziale
Kategorie, deren Entwicklung die Kirche lediglich zu steuern versuchte. Demge-
mäß sprach man allenfalls von „Einflüssen" auf das Rittertum.
In der deutschen Forschung, die eben nicht nur eine bestimmte Schicht im Au-
ge hatte, sondern das Rittertum angesichts der Konvergenz zwischen Ministeriali-
tät und altem Adel eher als ein geistes- bzw. - in neuerer Zeit - kulturgeschichtli-
ches Phänomen verstand, werden die Akzente anders gesetzt^. Werte und Lebens-
formen erscheinen so als die eigentlich zentralen Aspekte; das Rittertum wurde als
ideengeschichtlicher Entwurf und damit als kulturelles Phänomen verstanden, das
durch die Kirche hervorgerufen wurde und erst danach soziale Folgen mit sich
brachte. Hier liegt zudem ein Quellenproblem vor: Geben die Vorstellungen geist-
licher Autoren über das Rittertum das Selbstverständnis der Ritter wieder oder
sind sie nur als Ideal aufzufassen, das von den Rittern keineswegs geteilt werden
mußte? Auf ein weiteres Quellenproblem hat Timothy Reuter hingewiesen. Für
die französischen Verhältnisse der Frühzeit steht mit den Urkunden eine Quellen-
gattung zur Verfügung, die im Osten weitgehend fehlt. Demgegenüber könne man
für die Untersuchung der Verhältnisse in Frankreich kaum auf wichtige erzählen-
de Quellen zurückgreifen, die gerade für das Ostfrankenreich wichtige Aufschlüs-
se ermöglichen^.
Zentral ist demnach die Definition von Rittertum, denn allein sie entscheidet
über die „Anfänge" des Phänomens und beantwortet damit die Frage, ob eine
Entwicklung schon im Gang ist, bevor sie von einer anderen beeinflußt wird, oder
ob sich überhaupt erst der Beginn einer Entwicklung feststellen läßt. Von einem
58 Vgl. CARDINI, Alle radici.
59 Demnach wird die Geschichte des Begriffs ?nz7gs teilweise als weniger aussagekräftig erachtet. Vgl.
dazu bereits BORST, Rittertum, S. 217: „Der frühmittelalterliche miles ist noch kein Ritter, sondern
nur allgemein ein Kämpfer zu Pferd".
60 Vgl. T. REUTER, König, Adelige, S. 132; DERS., Feudal Revolution, S. 194f.
431
den Germanen festgestellt werden können^. Das Problem besteht nicht zuletzt
darin, daß unterschiedliche Entwicklungen mit regional beträchtlichen Phasenver-
schiebungen als Ausgangspunkt für einen „klassischen Zustand" gesehen werden,
der gewöhnlich nicht näher definiert, sondern als gegeben hingenommen wird.
10.3.2. Die Rolle der Kirche
Die seit langer Zeit heftig umstrittene Frage nach der Rolle der Kirche bei der Ent-
stehung des Rittertums hängt natürlich ebenfalls von der Definition ab. Cum gra-
no salis läßt sich behaupten, daß die französische Forschung im Rittertum vor-
nehmlich ein sozialgeschichtliches Phänomen sah. In dieser Perspektive war die
Rolle der Kirche eher gering; das Rittertum erscheint in erster Linie als eine soziale
Kategorie, deren Entwicklung die Kirche lediglich zu steuern versuchte. Demge-
mäß sprach man allenfalls von „Einflüssen" auf das Rittertum.
In der deutschen Forschung, die eben nicht nur eine bestimmte Schicht im Au-
ge hatte, sondern das Rittertum angesichts der Konvergenz zwischen Ministeriali-
tät und altem Adel eher als ein geistes- bzw. - in neuerer Zeit - kulturgeschichtli-
ches Phänomen verstand, werden die Akzente anders gesetzt^. Werte und Lebens-
formen erscheinen so als die eigentlich zentralen Aspekte; das Rittertum wurde als
ideengeschichtlicher Entwurf und damit als kulturelles Phänomen verstanden, das
durch die Kirche hervorgerufen wurde und erst danach soziale Folgen mit sich
brachte. Hier liegt zudem ein Quellenproblem vor: Geben die Vorstellungen geist-
licher Autoren über das Rittertum das Selbstverständnis der Ritter wieder oder
sind sie nur als Ideal aufzufassen, das von den Rittern keineswegs geteilt werden
mußte? Auf ein weiteres Quellenproblem hat Timothy Reuter hingewiesen. Für
die französischen Verhältnisse der Frühzeit steht mit den Urkunden eine Quellen-
gattung zur Verfügung, die im Osten weitgehend fehlt. Demgegenüber könne man
für die Untersuchung der Verhältnisse in Frankreich kaum auf wichtige erzählen-
de Quellen zurückgreifen, die gerade für das Ostfrankenreich wichtige Aufschlüs-
se ermöglichen^.
Zentral ist demnach die Definition von Rittertum, denn allein sie entscheidet
über die „Anfänge" des Phänomens und beantwortet damit die Frage, ob eine
Entwicklung schon im Gang ist, bevor sie von einer anderen beeinflußt wird, oder
ob sich überhaupt erst der Beginn einer Entwicklung feststellen läßt. Von einem
58 Vgl. CARDINI, Alle radici.
59 Demnach wird die Geschichte des Begriffs ?nz7gs teilweise als weniger aussagekräftig erachtet. Vgl.
dazu bereits BORST, Rittertum, S. 217: „Der frühmittelalterliche miles ist noch kein Ritter, sondern
nur allgemein ein Kämpfer zu Pferd".
60 Vgl. T. REUTER, König, Adelige, S. 132; DERS., Feudal Revolution, S. 194f.