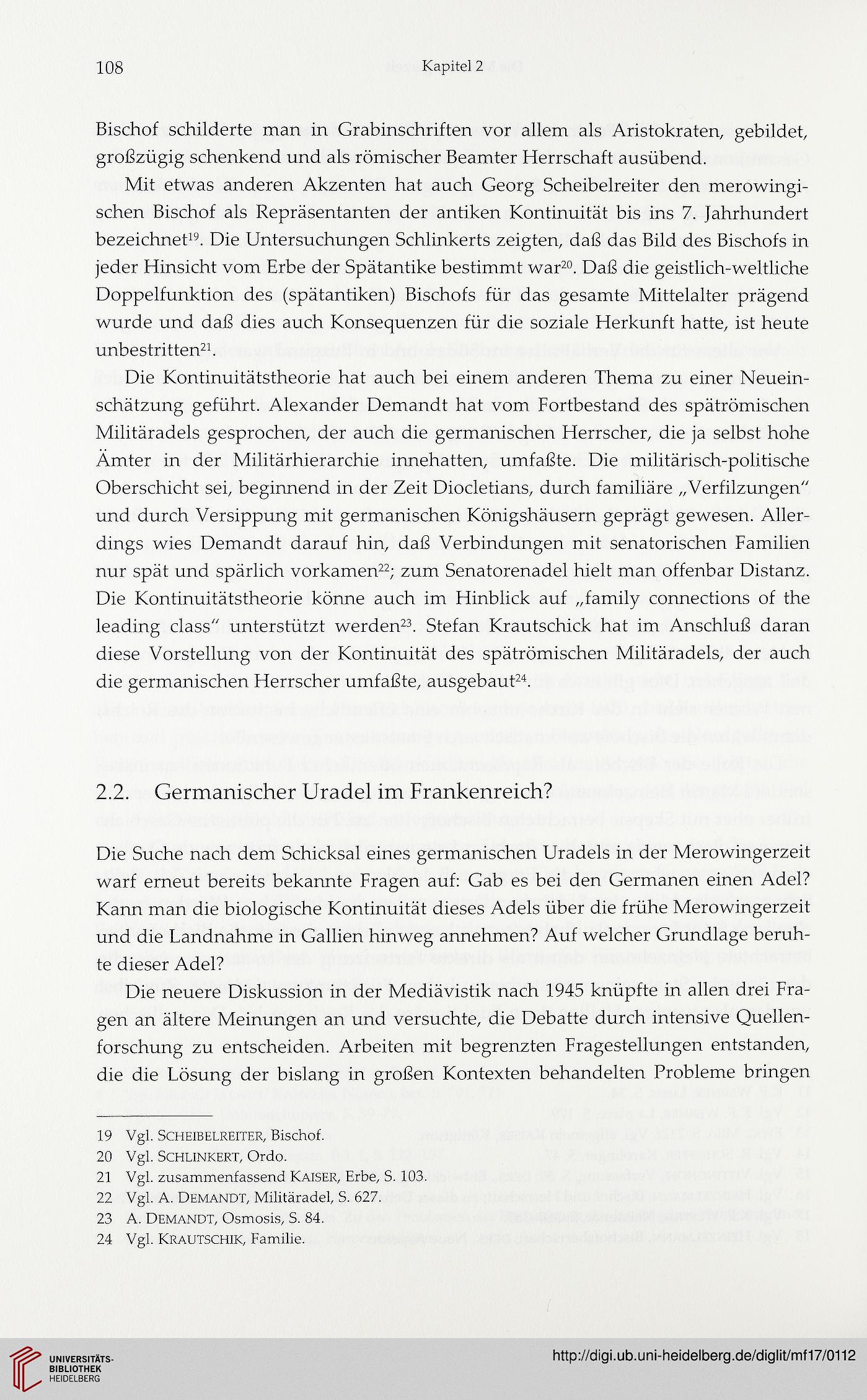108
Kapitel 2
Bischof schilderte man in Grabinschriften vor allem als Aristokraten, gebildet,
großzügig schenkend und als römischer Beamter Herrschaft ausübend.
Mit etwas anderen Akzenten hat auch Georg Scheibeireiter den merowingi-
schen Bischof als Repräsentanten der antiken Kontinuität bis ins 7. Jahrhundert
bezeichnet^. Die Untersuchungen Schlinkerts zeigten, daß das Bild des Bischofs in
jeder Hinsicht vom Erbe der Spätantike bestimmt warA Daß die geistlich-weltliche
Doppelfunktion des (spätantiken) Bischofs für das gesamte Mittelalter prägend
wurde und daß dies auch Konsequenzen für die soziale Herkunft hatte, ist heute
unbestritten^.
Die Kontinuitätstheorie hat auch bei einem anderen Thema zu einer Neuein-
schätzung geführt. Alexander Demandt hat vom Fortbestand des spätrömischen
Militäradels gesprochen, der auch die germanischen Herrscher, die ja selbst hohe
Ämter in der Militärhierarchie innehatten, umfaßte. Die militärisch-politische
Oberschicht sei, beginnend in der Zeit Diocletians, durch familiäre „Verfilzungen"
und durch Versippung mit germanischen Königshäusern geprägt gewesen. Aller-
dings wies Demandt darauf hin, daß Verbindungen mit senatorischen Familien
nur spät und spärlich vorkamen-^; zum Senatorenadel hielt man offenbar Distanz.
Die Kontinuitätstheorie könne auch im Hinblick auf „family Connections of the
leading dass" unterstützt werden^. Stefan Krautschick hat im Anschluß daran
diese Vorstellung von der Kontinuität des spätrömischen Militäradels, der auch
die germanischen Herrscher umfaßte, ausgebautA
2.2. Germanischer Uradel im Frankenreich?
Die Suche nach dem Schicksal eines germanischen Uradels in der Merowingerzeit
warf erneut bereits bekannte Fragen auf: Gab es bei den Germanen einen Adel?
Kann man die biologische Kontinuität dieses Adels über die frühe Merowingerzeit
und die Landnahme in Gallien hinweg annehmen? Auf welcher Grundlage beruh-
te dieser Adel?
Die neuere Diskussion in der Mediävistik nach 1945 knüpfte in allen drei Fra-
gen an ältere Meinungen an und versuchte, die Debatte durch intensive Quellen-
forschung zu entscheiden. Arbeiten mit begrenzten Fragestellungen entstanden,
die die Lösung der bislang in großen Kontexten behandelten Probleme bringen
19 Vgl. SCHEIBEEREITER, Bischof.
20 Vgl. SCHLINKERT, Ordo.
21 Vgl. zusammenfassend KAISER, Erbe, S. 103.
22 Vgl. A. DEMANDT, Militäradel, S. 627.
23 A. DEMANDT, Osmosis, S. 84.
24 Vgl. KRAUTSCHIK, Familie.
Kapitel 2
Bischof schilderte man in Grabinschriften vor allem als Aristokraten, gebildet,
großzügig schenkend und als römischer Beamter Herrschaft ausübend.
Mit etwas anderen Akzenten hat auch Georg Scheibeireiter den merowingi-
schen Bischof als Repräsentanten der antiken Kontinuität bis ins 7. Jahrhundert
bezeichnet^. Die Untersuchungen Schlinkerts zeigten, daß das Bild des Bischofs in
jeder Hinsicht vom Erbe der Spätantike bestimmt warA Daß die geistlich-weltliche
Doppelfunktion des (spätantiken) Bischofs für das gesamte Mittelalter prägend
wurde und daß dies auch Konsequenzen für die soziale Herkunft hatte, ist heute
unbestritten^.
Die Kontinuitätstheorie hat auch bei einem anderen Thema zu einer Neuein-
schätzung geführt. Alexander Demandt hat vom Fortbestand des spätrömischen
Militäradels gesprochen, der auch die germanischen Herrscher, die ja selbst hohe
Ämter in der Militärhierarchie innehatten, umfaßte. Die militärisch-politische
Oberschicht sei, beginnend in der Zeit Diocletians, durch familiäre „Verfilzungen"
und durch Versippung mit germanischen Königshäusern geprägt gewesen. Aller-
dings wies Demandt darauf hin, daß Verbindungen mit senatorischen Familien
nur spät und spärlich vorkamen-^; zum Senatorenadel hielt man offenbar Distanz.
Die Kontinuitätstheorie könne auch im Hinblick auf „family Connections of the
leading dass" unterstützt werden^. Stefan Krautschick hat im Anschluß daran
diese Vorstellung von der Kontinuität des spätrömischen Militäradels, der auch
die germanischen Herrscher umfaßte, ausgebautA
2.2. Germanischer Uradel im Frankenreich?
Die Suche nach dem Schicksal eines germanischen Uradels in der Merowingerzeit
warf erneut bereits bekannte Fragen auf: Gab es bei den Germanen einen Adel?
Kann man die biologische Kontinuität dieses Adels über die frühe Merowingerzeit
und die Landnahme in Gallien hinweg annehmen? Auf welcher Grundlage beruh-
te dieser Adel?
Die neuere Diskussion in der Mediävistik nach 1945 knüpfte in allen drei Fra-
gen an ältere Meinungen an und versuchte, die Debatte durch intensive Quellen-
forschung zu entscheiden. Arbeiten mit begrenzten Fragestellungen entstanden,
die die Lösung der bislang in großen Kontexten behandelten Probleme bringen
19 Vgl. SCHEIBEEREITER, Bischof.
20 Vgl. SCHLINKERT, Ordo.
21 Vgl. zusammenfassend KAISER, Erbe, S. 103.
22 Vgl. A. DEMANDT, Militäradel, S. 627.
23 A. DEMANDT, Osmosis, S. 84.
24 Vgl. KRAUTSCHIK, Familie.