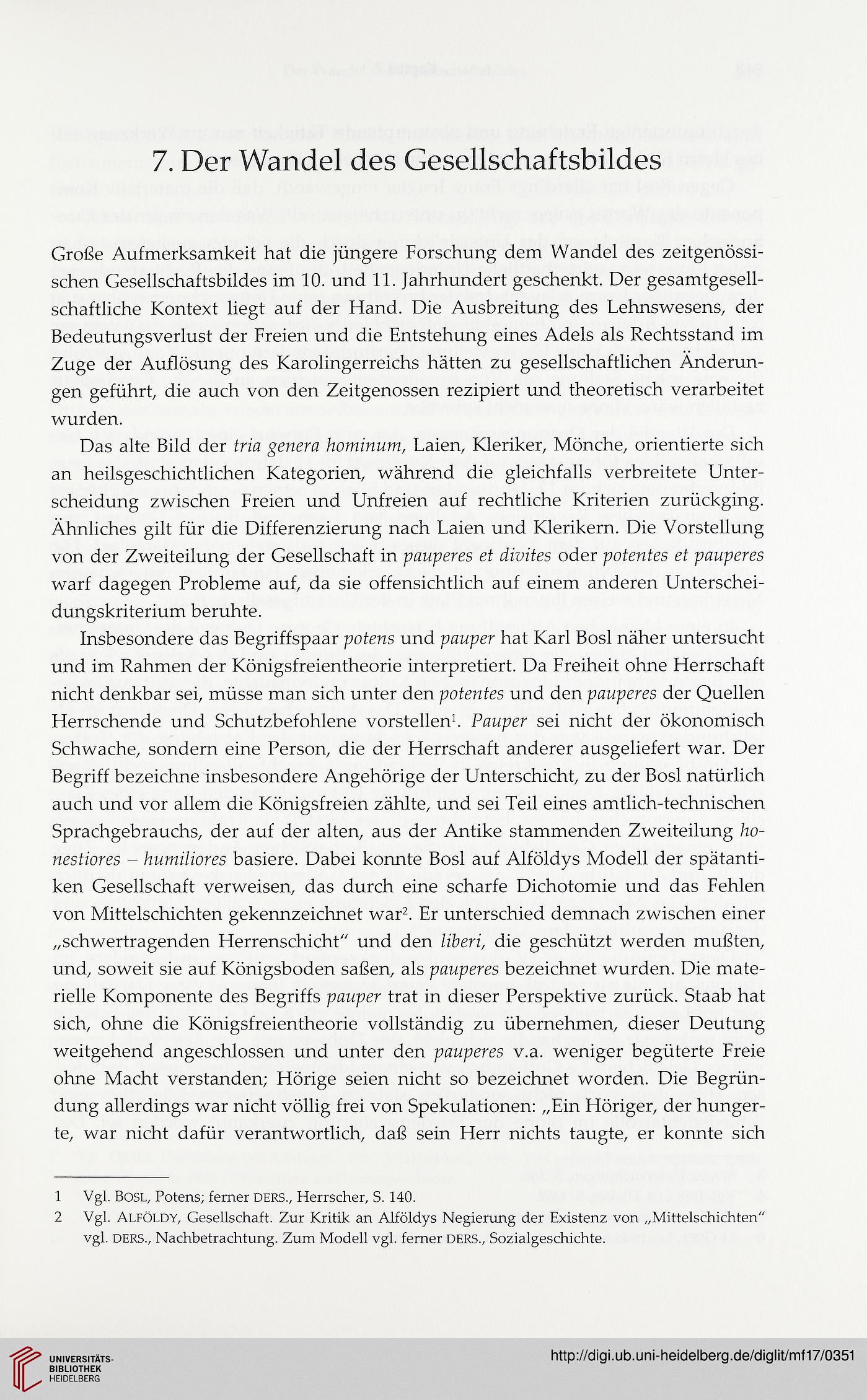7. Der Wandel des Gesellschaftsbildes
Große Aufmerksamkeit hat die jüngere Forschung dem Wandel des zeitgenössi-
schen Gesellschaftsbildes im 10. und 11. Jahrhundert geschenkt. Der gesamtgesell-
schaftliche Kontext liegt auf der Hand. Die Ausbreitung des Lehnswesens, der
Bedeutungsverlust der Freien und die Entstehung eines Adels als Rechtsstand im
Zuge der Auflösung des Karolingerreichs hätten zu gesellschaftlichen Änderun-
gen geführt, die auch von den Zeitgenossen rezipiert und theoretisch verarbeitet
wurden.
Das alte Bild der bz'% yczzcra izozizzzzzzzzz, Laien, Kleriker, Mönche, orientierte sich
an heilsgeschichtlichen Kategorien, während die gleichfalls verbreitete Unter-
scheidung zwischen Freien und Unfreien auf rechtliche Kriterien zurückging.
Ähnliches gilt für die Differenzierung nach Laien und Klerikern. Die Vorstellung
von der Zweiteilung der Gesellschaft in pzzzzpcrcs ei dzWfes oder poieuies ei pzuzpcrcs
warf dagegen Probleme auf, da sie offensichtlich auf einem anderen Unterschei-
dungskriterium beruhte.
Insbesondere das Begriffspaar poieus und pazzper hat Karl Bosl näher untersucht
und im Rahmen der Königsfreientheorie interpretiert. Da Freiheit ohne Herrschaft
nicht denkbar sei, müsse man sich unter den poicrzics und den pazzpcrcs der Quellen
Herrschende und Schutzbefohlene vorstehend Pazzpgr sei nicht der ökonomisch
Schwache, sondern eine Person, die der Herrschaft anderer ausgeliefert war. Der
Begriff bezeichne insbesondere Angehörige der Unterschicht, zu der Bosl natürlich
auch und vor allem die Königsfreien zählte, und sei Teil eines amtlich-technischen
Sprachgebrauchs, der auf der alten, aus der Antike stammenden Zweiteilung Fo-
rzcsfz'ores - Fzzztzz'iz'orcs basiere. Dabei konnte Bosl auf Alföldys Modell der spätanti-
ken Gesellschaft verweisen, das durch eine scharfe Dichotomie und das Fehlen
von Mittelschichten gekennzeichnet ward Er unterschied demnach zwischen einer
„schwertragenden Herrenschicht" und den izücrz, die geschützt werden mußten,
und, soweit sie auf Königsboden saßen, als pazzpcrcs bezeichnet wurden. Die mate-
rielle Komponente des Begriffs pzzzzpcr trat in dieser Perspektive zurück. Staab hat
sich, ohne die Königsfreientheorie vollständig zu übernehmen, dieser Deutung
weitgehend angeschlossen und unter den pazzpcrcs v.a. weniger begüterte Freie
ohne Macht verstanden; Hörige seien nicht so bezeichnet worden. Die Begrün-
dung allerdings war nicht völlig frei von Spekulationen: „Ein Höriger, der hunger-
te, war nicht dafür verantwortlich, daß sein Herr nichts taugte, er konnte sich
1 Vgl. BOSL, Potens; ferner DERS., Herrscher, S. 140.
2 Vgl. ALFÖLDY, Gesellschaft. Zur Kritik an Alföldys Negierung der Existenz von „Mittelschichten"
vgl. DERS., Nachbetrachtung. Zum Modell vgl. ferner DERS., Sozialgeschichte.
Große Aufmerksamkeit hat die jüngere Forschung dem Wandel des zeitgenössi-
schen Gesellschaftsbildes im 10. und 11. Jahrhundert geschenkt. Der gesamtgesell-
schaftliche Kontext liegt auf der Hand. Die Ausbreitung des Lehnswesens, der
Bedeutungsverlust der Freien und die Entstehung eines Adels als Rechtsstand im
Zuge der Auflösung des Karolingerreichs hätten zu gesellschaftlichen Änderun-
gen geführt, die auch von den Zeitgenossen rezipiert und theoretisch verarbeitet
wurden.
Das alte Bild der bz'% yczzcra izozizzzzzzzzz, Laien, Kleriker, Mönche, orientierte sich
an heilsgeschichtlichen Kategorien, während die gleichfalls verbreitete Unter-
scheidung zwischen Freien und Unfreien auf rechtliche Kriterien zurückging.
Ähnliches gilt für die Differenzierung nach Laien und Klerikern. Die Vorstellung
von der Zweiteilung der Gesellschaft in pzzzzpcrcs ei dzWfes oder poieuies ei pzuzpcrcs
warf dagegen Probleme auf, da sie offensichtlich auf einem anderen Unterschei-
dungskriterium beruhte.
Insbesondere das Begriffspaar poieus und pazzper hat Karl Bosl näher untersucht
und im Rahmen der Königsfreientheorie interpretiert. Da Freiheit ohne Herrschaft
nicht denkbar sei, müsse man sich unter den poicrzics und den pazzpcrcs der Quellen
Herrschende und Schutzbefohlene vorstehend Pazzpgr sei nicht der ökonomisch
Schwache, sondern eine Person, die der Herrschaft anderer ausgeliefert war. Der
Begriff bezeichne insbesondere Angehörige der Unterschicht, zu der Bosl natürlich
auch und vor allem die Königsfreien zählte, und sei Teil eines amtlich-technischen
Sprachgebrauchs, der auf der alten, aus der Antike stammenden Zweiteilung Fo-
rzcsfz'ores - Fzzztzz'iz'orcs basiere. Dabei konnte Bosl auf Alföldys Modell der spätanti-
ken Gesellschaft verweisen, das durch eine scharfe Dichotomie und das Fehlen
von Mittelschichten gekennzeichnet ward Er unterschied demnach zwischen einer
„schwertragenden Herrenschicht" und den izücrz, die geschützt werden mußten,
und, soweit sie auf Königsboden saßen, als pazzpcrcs bezeichnet wurden. Die mate-
rielle Komponente des Begriffs pzzzzpcr trat in dieser Perspektive zurück. Staab hat
sich, ohne die Königsfreientheorie vollständig zu übernehmen, dieser Deutung
weitgehend angeschlossen und unter den pazzpcrcs v.a. weniger begüterte Freie
ohne Macht verstanden; Hörige seien nicht so bezeichnet worden. Die Begrün-
dung allerdings war nicht völlig frei von Spekulationen: „Ein Höriger, der hunger-
te, war nicht dafür verantwortlich, daß sein Herr nichts taugte, er konnte sich
1 Vgl. BOSL, Potens; ferner DERS., Herrscher, S. 140.
2 Vgl. ALFÖLDY, Gesellschaft. Zur Kritik an Alföldys Negierung der Existenz von „Mittelschichten"
vgl. DERS., Nachbetrachtung. Zum Modell vgl. ferner DERS., Sozialgeschichte.