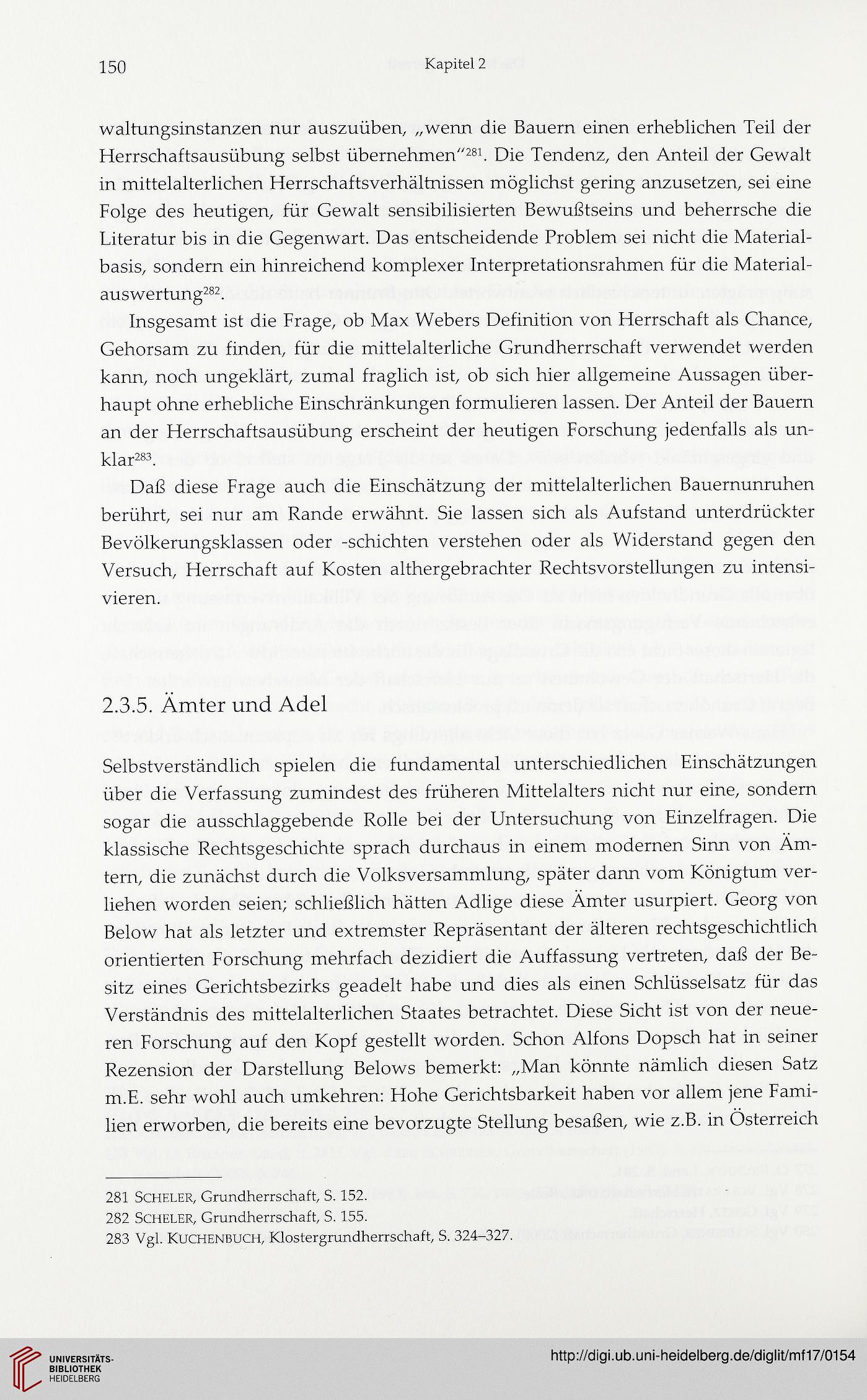150
Kapitel 2
waltungsinstanzen nur auszuüben, „wenn die Bauern einen erheblichen Teil der
Herrschaftsausübung selbst übernehmen"^. Die Tendenz, den Anteil der Gewalt
in mittelalterlichen Herrschaftsverhältnissen möglichst gering anzusetzen, sei eine
Folge des heutigen, für Gewalt sensibilisierten Bewußtseins und beherrsche die
Literatur bis in die Gegenwart. Das entscheidende Problem sei nicht die Material-
basis, sondern ein hinreichend komplexer Interpretationsrahmen für die Material-
auswertung28ü
Insgesamt ist die Frage, ob Max Webers Definition von Herrschaft als Chance,
Gehorsam zu finden, für die mittelalterliche Grundherrschaft verwendet werden
kann, noch ungeklärt, zumal fraglich ist, ob sich hier allgemeine Aussagen über-
haupt ohne erhebliche Einschränkungen formulieren lassen. Der Anteil der Bauern
an der Herrschaftsausübung erscheint der heutigen Forschung jedenfalls als un-
klar^.
Daß diese Frage auch die Einschätzung der mittelalterlichen Bauernunruhen
berührt, sei nur am Rande erwähnt. Sie lassen sich als Aufstand unterdrückter
Bevölkerungsklassen oder -schichten verstehen oder als Widerstand gegen den
Versuch, Herrschaft auf Kosten althergebrachter Rechtsvorstellungen zu intensi-
vieren.
2.3.5. Ämter und Adel
Selbstverständlich spielen die fundamental unterschiedlichen Einschätzungen
über die Verfassung zumindest des früheren Mittelalters nicht nur eine, sondern
sogar die ausschlaggebende Rolle bei der Untersuchung von Einzelfragen. Die
klassische Rechtsgeschichte sprach durchaus in einem modernen Sinn von Äm-
tern, die zunächst durch die Volksversammlung, später dann vom Königtum ver-
liehen worden seien; schließlich hätten Adlige diese Ämter usurpiert. Georg von
Below hat als letzter und extremster Repräsentant der älteren rechtsgeschichtlich
orientierten Forschung mehrfach dezidiert die Auffassung vertreten, daß der Be-
sitz eines Gerichtsbezirks geadelt habe und dies als einen Schlüsselsatz für das
Verständnis des mittelalterlichen Staates betrachtet. Diese Sicht ist von der neue-
ren Forschung auf den Kopf gestellt worden. Schon Alfons Dopsch hat in seiner
Rezension der Darstellung Belows bemerkt: „Man könnte nämlich diesen Satz
m.E. sehr wohl auch umkehren: Hohe Gerichtsbarkeit haben vor allem jene Fami-
lien erworben, die bereits eine bevorzugte Stellung besaßen, wie z.B. in Österreich
281 SCHELER, Grundherrschaft, S. 152.
282 SCHELER, Grundherrschaft, S. 155.
283 Vgl. KUCHENBUCH, Klostergrundherrschaft, S. 324-327.
Kapitel 2
waltungsinstanzen nur auszuüben, „wenn die Bauern einen erheblichen Teil der
Herrschaftsausübung selbst übernehmen"^. Die Tendenz, den Anteil der Gewalt
in mittelalterlichen Herrschaftsverhältnissen möglichst gering anzusetzen, sei eine
Folge des heutigen, für Gewalt sensibilisierten Bewußtseins und beherrsche die
Literatur bis in die Gegenwart. Das entscheidende Problem sei nicht die Material-
basis, sondern ein hinreichend komplexer Interpretationsrahmen für die Material-
auswertung28ü
Insgesamt ist die Frage, ob Max Webers Definition von Herrschaft als Chance,
Gehorsam zu finden, für die mittelalterliche Grundherrschaft verwendet werden
kann, noch ungeklärt, zumal fraglich ist, ob sich hier allgemeine Aussagen über-
haupt ohne erhebliche Einschränkungen formulieren lassen. Der Anteil der Bauern
an der Herrschaftsausübung erscheint der heutigen Forschung jedenfalls als un-
klar^.
Daß diese Frage auch die Einschätzung der mittelalterlichen Bauernunruhen
berührt, sei nur am Rande erwähnt. Sie lassen sich als Aufstand unterdrückter
Bevölkerungsklassen oder -schichten verstehen oder als Widerstand gegen den
Versuch, Herrschaft auf Kosten althergebrachter Rechtsvorstellungen zu intensi-
vieren.
2.3.5. Ämter und Adel
Selbstverständlich spielen die fundamental unterschiedlichen Einschätzungen
über die Verfassung zumindest des früheren Mittelalters nicht nur eine, sondern
sogar die ausschlaggebende Rolle bei der Untersuchung von Einzelfragen. Die
klassische Rechtsgeschichte sprach durchaus in einem modernen Sinn von Äm-
tern, die zunächst durch die Volksversammlung, später dann vom Königtum ver-
liehen worden seien; schließlich hätten Adlige diese Ämter usurpiert. Georg von
Below hat als letzter und extremster Repräsentant der älteren rechtsgeschichtlich
orientierten Forschung mehrfach dezidiert die Auffassung vertreten, daß der Be-
sitz eines Gerichtsbezirks geadelt habe und dies als einen Schlüsselsatz für das
Verständnis des mittelalterlichen Staates betrachtet. Diese Sicht ist von der neue-
ren Forschung auf den Kopf gestellt worden. Schon Alfons Dopsch hat in seiner
Rezension der Darstellung Belows bemerkt: „Man könnte nämlich diesen Satz
m.E. sehr wohl auch umkehren: Hohe Gerichtsbarkeit haben vor allem jene Fami-
lien erworben, die bereits eine bevorzugte Stellung besaßen, wie z.B. in Österreich
281 SCHELER, Grundherrschaft, S. 152.
282 SCHELER, Grundherrschaft, S. 155.
283 Vgl. KUCHENBUCH, Klostergrundherrschaft, S. 324-327.