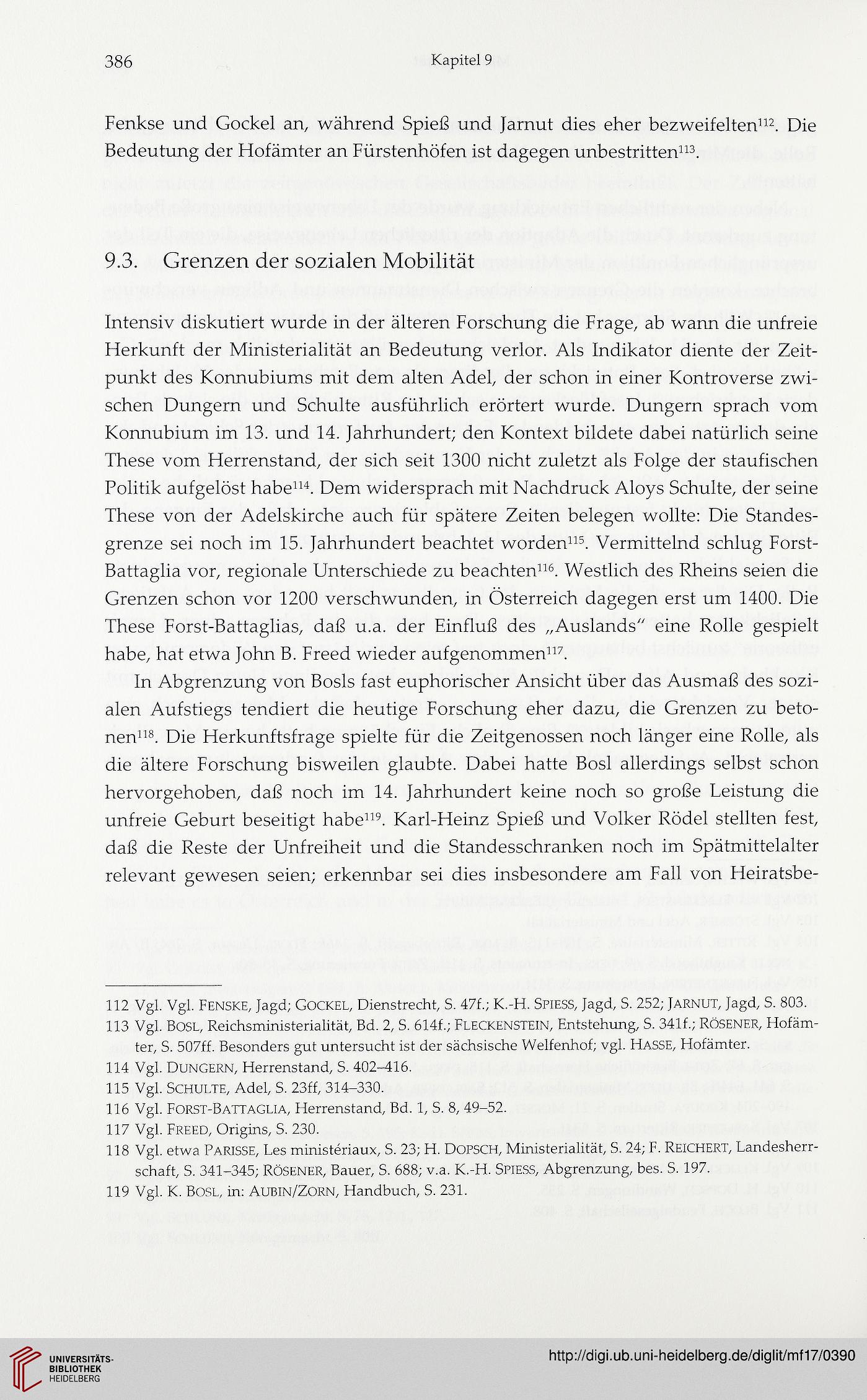386
Kapitel 9
Fenkse und Gockel an, während Spieß und Jarnut dies eher bezweifelten^. Die
Bedeutung der Hofämter an Fürstenhöfen ist dagegen unbestritten^.
9.3. Grenzen der sozialen Mobilität
Intensiv diskutiert wurde in der älteren Forschung die Frage, ab wann die unfreie
Herkunft der Ministerialität an Bedeutung verlor. Als Indikator diente der Zeit-
punkt des Konnubiums mit dem alten Adel, der schon in einer Kontroverse zwi-
schen Düngern und Schulte ausführlich erörtert wurde. Düngern sprach vom
Konnubium im 13. und 14. Jahrhundert; den Kontext bildete dabei natürlich seine
These vom Herrenstand, der sich seit 1300 nicht zuletzt als Folge der staufischen
Politik aufgelöst habe"F Dem widersprach mit Nachdruck Aloys Schulte, der seine
These von der Adelskirche auch für spätere Zeiten belegen wollte: Die Standes-
grenze sei noch im 15. Jahrhundert beachtet worden^. Vermittelnd schlug Forst-
Battaglia vor, regionale Unterschiede zu beachten^. Westlich des Rheins seien die
Grenzen schon vor 1200 verschwunden, in Österreich dagegen erst um 1400. Die
These Forst-Battaglias, daß u.a. der Einfluß des „Auslands" eine Rolle gespielt
habe, hat etwa John B. Freed wieder aufgenommeWR
In Abgrenzung von Bosls fast euphorischer Ansicht über das Ausmaß des sozi-
alen Aufstiegs tendiert die heutige Forschung eher dazu, die Grenzen zu beto-
nen^. Die Herkunftsfrage spielte für die Zeitgenossen noch länger eine Rolle, als
die ältere Forschung bisweilen glaubte. Dabei hatte Bosl allerdings selbst schon
hervorgehoben, daß noch im 14. Jahrhundert keine noch so große Leistung die
unfreie Geburt beseitigt habe"^. Karl-Heinz Spieß und Volker Rödel stellten fest,
daß die Reste der Unfreiheit und die Standesschranken noch im Spätmittelalter
relevant gewesen seien; erkennbar sei dies insbesondere am Fall von Heiratsbe-
112 Vgl. Vgl. FENSKE, Jagd; GOCKEL, Dienstrecht, S. 47f.; K.-H. SPIESS, Jagd, S. 252; JARNUT, Jagd, S. 803.
113 Vgl. BOSL, Reichsministerialität, Bd. 2, S. 614f.; FLECKENSTEIN, Entstehung, S. 341f.; RÖSENER, Hofäm-
ter, S. 507ff. Besonders gut untersucht ist der sächsische Weifenhof; vgl. HASSE, Hofämter.
114 Vgl. DÜNGERN, Herrenstand, S. 402-416.
115 Vgl. SCHULTE, Adel, S. 23ff, 314-330.
116 Vgl. FORST-BATTAGLIA, Herrenstand, Bd. 1, S. 8, 49-52.
117 Vgl. FREED, Origins, S. 230.
118 Vgl. etwa PARISSE, Les ministeriaux, S. 23; H. DOPSCH, Ministerialität, S. 24; F. REICHERT, Landesherr-
schaft, S. 341-345; RÖSENER, Bauer, S. 688; v.a. K.-H. SPIESS, Abgrenzung, bes. S. 197.
119 Vgl. K. BOSL, in: AUBIN/ZORN, Handbuch, S. 231.
Kapitel 9
Fenkse und Gockel an, während Spieß und Jarnut dies eher bezweifelten^. Die
Bedeutung der Hofämter an Fürstenhöfen ist dagegen unbestritten^.
9.3. Grenzen der sozialen Mobilität
Intensiv diskutiert wurde in der älteren Forschung die Frage, ab wann die unfreie
Herkunft der Ministerialität an Bedeutung verlor. Als Indikator diente der Zeit-
punkt des Konnubiums mit dem alten Adel, der schon in einer Kontroverse zwi-
schen Düngern und Schulte ausführlich erörtert wurde. Düngern sprach vom
Konnubium im 13. und 14. Jahrhundert; den Kontext bildete dabei natürlich seine
These vom Herrenstand, der sich seit 1300 nicht zuletzt als Folge der staufischen
Politik aufgelöst habe"F Dem widersprach mit Nachdruck Aloys Schulte, der seine
These von der Adelskirche auch für spätere Zeiten belegen wollte: Die Standes-
grenze sei noch im 15. Jahrhundert beachtet worden^. Vermittelnd schlug Forst-
Battaglia vor, regionale Unterschiede zu beachten^. Westlich des Rheins seien die
Grenzen schon vor 1200 verschwunden, in Österreich dagegen erst um 1400. Die
These Forst-Battaglias, daß u.a. der Einfluß des „Auslands" eine Rolle gespielt
habe, hat etwa John B. Freed wieder aufgenommeWR
In Abgrenzung von Bosls fast euphorischer Ansicht über das Ausmaß des sozi-
alen Aufstiegs tendiert die heutige Forschung eher dazu, die Grenzen zu beto-
nen^. Die Herkunftsfrage spielte für die Zeitgenossen noch länger eine Rolle, als
die ältere Forschung bisweilen glaubte. Dabei hatte Bosl allerdings selbst schon
hervorgehoben, daß noch im 14. Jahrhundert keine noch so große Leistung die
unfreie Geburt beseitigt habe"^. Karl-Heinz Spieß und Volker Rödel stellten fest,
daß die Reste der Unfreiheit und die Standesschranken noch im Spätmittelalter
relevant gewesen seien; erkennbar sei dies insbesondere am Fall von Heiratsbe-
112 Vgl. Vgl. FENSKE, Jagd; GOCKEL, Dienstrecht, S. 47f.; K.-H. SPIESS, Jagd, S. 252; JARNUT, Jagd, S. 803.
113 Vgl. BOSL, Reichsministerialität, Bd. 2, S. 614f.; FLECKENSTEIN, Entstehung, S. 341f.; RÖSENER, Hofäm-
ter, S. 507ff. Besonders gut untersucht ist der sächsische Weifenhof; vgl. HASSE, Hofämter.
114 Vgl. DÜNGERN, Herrenstand, S. 402-416.
115 Vgl. SCHULTE, Adel, S. 23ff, 314-330.
116 Vgl. FORST-BATTAGLIA, Herrenstand, Bd. 1, S. 8, 49-52.
117 Vgl. FREED, Origins, S. 230.
118 Vgl. etwa PARISSE, Les ministeriaux, S. 23; H. DOPSCH, Ministerialität, S. 24; F. REICHERT, Landesherr-
schaft, S. 341-345; RÖSENER, Bauer, S. 688; v.a. K.-H. SPIESS, Abgrenzung, bes. S. 197.
119 Vgl. K. BOSL, in: AUBIN/ZORN, Handbuch, S. 231.