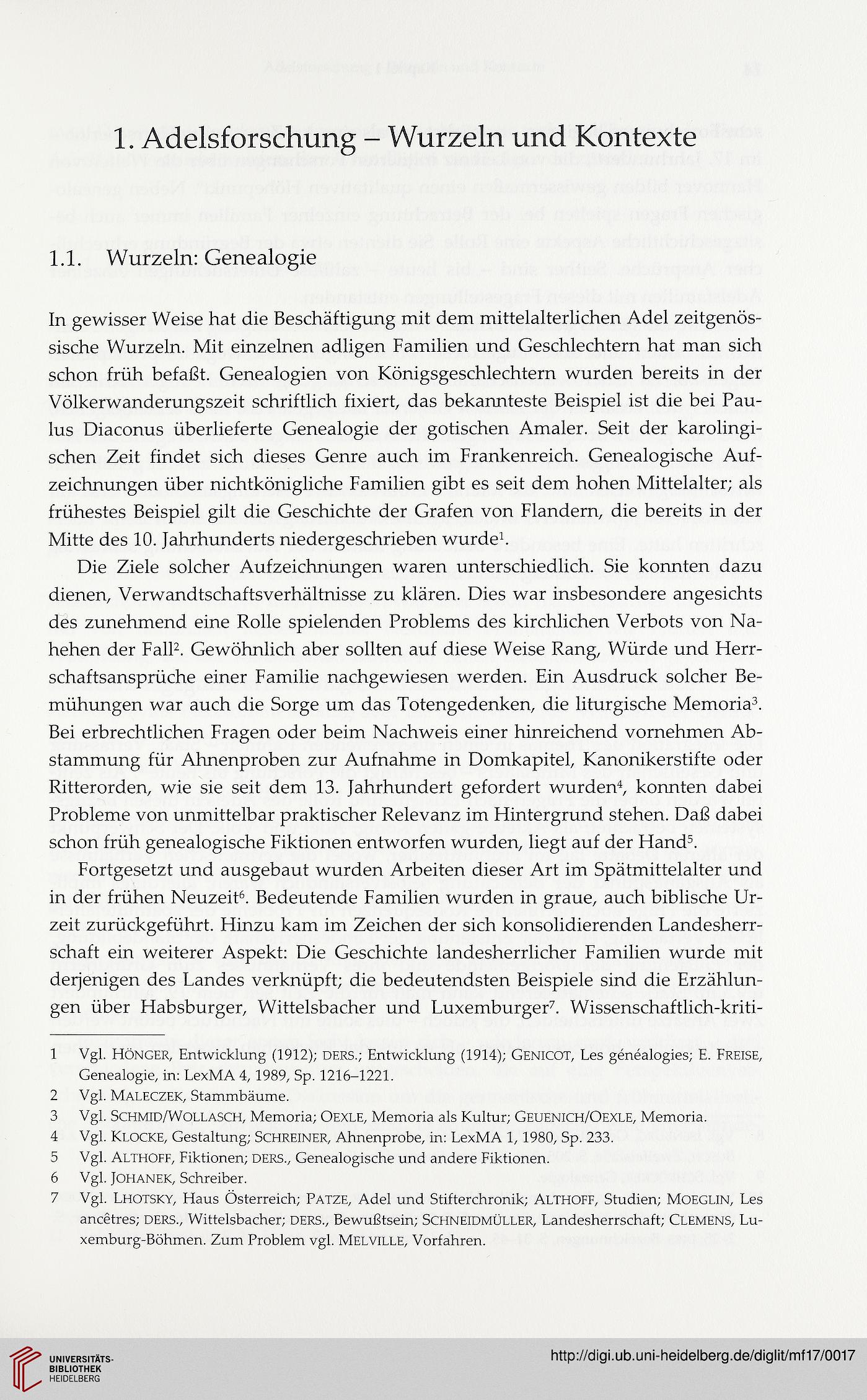1. Adelsforschung - Wurzeln und Kontexte
1.1. Wurzeln: Genealogie
In gewisser Weise hat die Beschäftigung mit dem mittelalterlichen Adel zeitgenös-
sische Wurzeln. Mit einzelnen adligen Familien und Geschlechtern hat man sich
schon früh befaßt. Genealogien von Königsgeschlechtern wurden bereits in der
Völkerwanderungszeit schriftlich fixiert, das bekannteste Beispiel ist die bei Pau-
lus Diaconus überlieferte Genealogie der gotischen Amaler. Seit der karolingi-
schen Zeit findet sich dieses Genre auch im Frankenreich. Genealogische Auf-
zeichnungen über nichtkönigliche Familien gibt es seit dem hohen Mittelalter; als
frühestes Beispiel gilt die Geschichte der Grafen von Flandern, die bereits in der
Mitte des 10. Jahrhunderts niedergeschrieben wurdek
Die Ziele solcher Aufzeichnungen waren unterschiedlich. Sie konnten dazu
dienen, Verwandtschaftsverhältnisse zu klären. Dies war insbesondere angesichts
des zunehmend eine Rolle spielenden Problems des kirchlichen Verbots von Na-
hehen der FalP. Gewöhnlich aber sollten auf diese Weise Rang, Würde und Herr-
schaftsansprüche einer Familie nachgewiesen werden. Ein Ausdruck solcher Be-
mühungen war auch die Sorge um das Totengedenken, die liturgische Memorial
Bei erbrechtlichen Fragen oder beim Nachweis einer hinreichend vornehmen Ab-
stammung für Ahnenproben zur Aufnahme in Domkapitel, Kanonikerstifte oder
Ritterorden, wie sie seit dem 13. Jahrhundert gefordert wurden^, konnten dabei
Probleme von unmittelbar praktischer Relevanz im Hintergrund stehen. Daß dabei
schon früh genealogische Fiktionen entworfen wurden, liegt auf der Handk
Fortgesetzt und ausgebaut wurden Arbeiten dieser Art im Spätmittelalter und
in der frühen Neuzeih. Bedeutende Familien wurden in graue, auch biblische Ur-
zeit zurückgeführt. Hinzu kam im Zeichen der sich konsolidierenden Landesherr-
schaft ein weiterer Aspekt: Die Geschichte landesherrlicher Familien wurde mit
derjenigen des Landes verknüpft; die bedeutendsten Beispiele sind die Erzählun-
gen über Habsburger, Wittelsbacher und Luxemburger?. Wissenschaftlich-kriti-
1 Vgl. HÖNGER, Entwicklung (1912); DERS.; Entwicklung (1914); GENICOT, Ees genealogies; E. FREISE,
Genealogie, in: LexMA 4, 1989, Sp. 1216-1221.
2 Vgl. MALECZEK, Stammbäume.
3 Vgl. SCHMID/WOLLASCH, Memoria; OEXLE, Memoria als Kultur; GEUENICH/OEXEE, Memoria.
4 Vgl. KLOCKE, Gestaltung; SCHREINER, Ahnenprobe, in: LexMA 1,1980, Sp. 233.
5 Vgl. ALTHOFF, Fiktionen; OERS., Genealogische und andere Fiktionen.
6 Vgl. JOHANEK, Schreiber.
7 Vgl. LHOTSKY, Haus Österreich; PATZE, Adel und Stifterchronik; ALTHOFF, Studien; MOEGLIN, Les
ancetres; DERS., Wittelsbacher; DERS., Bewußtsein; SCHNEIDMÜLLER, Landesherrschaft; CLEMENS, Lu-
xemburg-Böhmen. Zum Problem vgl. MELVILLE, Vorfahren.
1.1. Wurzeln: Genealogie
In gewisser Weise hat die Beschäftigung mit dem mittelalterlichen Adel zeitgenös-
sische Wurzeln. Mit einzelnen adligen Familien und Geschlechtern hat man sich
schon früh befaßt. Genealogien von Königsgeschlechtern wurden bereits in der
Völkerwanderungszeit schriftlich fixiert, das bekannteste Beispiel ist die bei Pau-
lus Diaconus überlieferte Genealogie der gotischen Amaler. Seit der karolingi-
schen Zeit findet sich dieses Genre auch im Frankenreich. Genealogische Auf-
zeichnungen über nichtkönigliche Familien gibt es seit dem hohen Mittelalter; als
frühestes Beispiel gilt die Geschichte der Grafen von Flandern, die bereits in der
Mitte des 10. Jahrhunderts niedergeschrieben wurdek
Die Ziele solcher Aufzeichnungen waren unterschiedlich. Sie konnten dazu
dienen, Verwandtschaftsverhältnisse zu klären. Dies war insbesondere angesichts
des zunehmend eine Rolle spielenden Problems des kirchlichen Verbots von Na-
hehen der FalP. Gewöhnlich aber sollten auf diese Weise Rang, Würde und Herr-
schaftsansprüche einer Familie nachgewiesen werden. Ein Ausdruck solcher Be-
mühungen war auch die Sorge um das Totengedenken, die liturgische Memorial
Bei erbrechtlichen Fragen oder beim Nachweis einer hinreichend vornehmen Ab-
stammung für Ahnenproben zur Aufnahme in Domkapitel, Kanonikerstifte oder
Ritterorden, wie sie seit dem 13. Jahrhundert gefordert wurden^, konnten dabei
Probleme von unmittelbar praktischer Relevanz im Hintergrund stehen. Daß dabei
schon früh genealogische Fiktionen entworfen wurden, liegt auf der Handk
Fortgesetzt und ausgebaut wurden Arbeiten dieser Art im Spätmittelalter und
in der frühen Neuzeih. Bedeutende Familien wurden in graue, auch biblische Ur-
zeit zurückgeführt. Hinzu kam im Zeichen der sich konsolidierenden Landesherr-
schaft ein weiterer Aspekt: Die Geschichte landesherrlicher Familien wurde mit
derjenigen des Landes verknüpft; die bedeutendsten Beispiele sind die Erzählun-
gen über Habsburger, Wittelsbacher und Luxemburger?. Wissenschaftlich-kriti-
1 Vgl. HÖNGER, Entwicklung (1912); DERS.; Entwicklung (1914); GENICOT, Ees genealogies; E. FREISE,
Genealogie, in: LexMA 4, 1989, Sp. 1216-1221.
2 Vgl. MALECZEK, Stammbäume.
3 Vgl. SCHMID/WOLLASCH, Memoria; OEXLE, Memoria als Kultur; GEUENICH/OEXEE, Memoria.
4 Vgl. KLOCKE, Gestaltung; SCHREINER, Ahnenprobe, in: LexMA 1,1980, Sp. 233.
5 Vgl. ALTHOFF, Fiktionen; OERS., Genealogische und andere Fiktionen.
6 Vgl. JOHANEK, Schreiber.
7 Vgl. LHOTSKY, Haus Österreich; PATZE, Adel und Stifterchronik; ALTHOFF, Studien; MOEGLIN, Les
ancetres; DERS., Wittelsbacher; DERS., Bewußtsein; SCHNEIDMÜLLER, Landesherrschaft; CLEMENS, Lu-
xemburg-Böhmen. Zum Problem vgl. MELVILLE, Vorfahren.