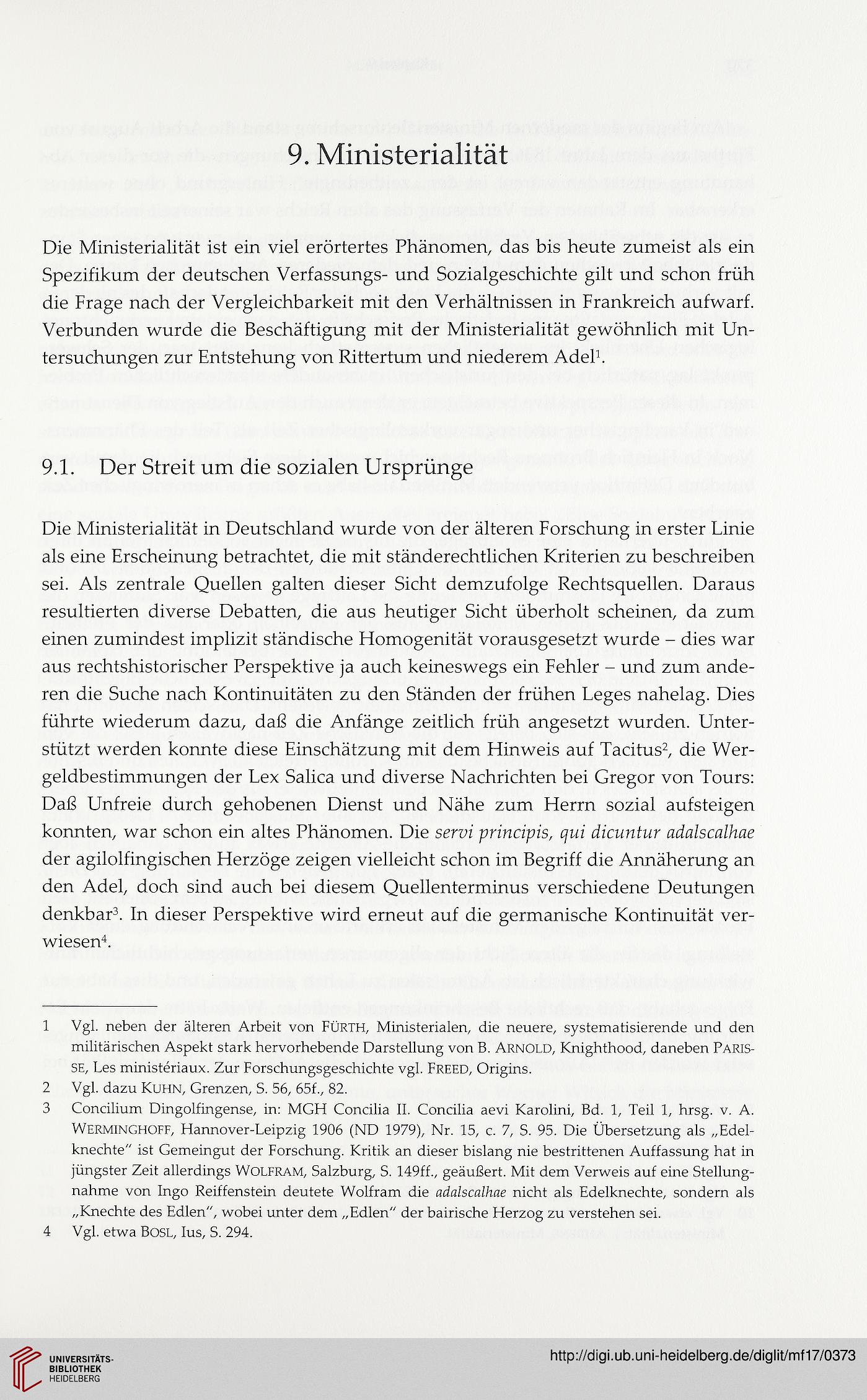9. Ministerialität
Die Ministerialität ist ein viel erörtertes Phänomen, das bis heute zumeist als ein
Spezifikum der deutschen Verfassungs- und Sozialgeschichte gilt und schon früh
die Frage nach der Vergleichbarkeit mit den Verhältnissen in Frankreich aufwarf.
Verbunden wurde die Beschäftigung mit der Ministerialität gewöhnlich mit Un-
tersuchungen zur Entstehung von Rittertum und niederem AdeP.
9.1. Der Streit um die sozialen Ursprünge
Die Ministerialität in Deutschland wurde von der älteren Forschung in erster Linie
als eine Erscheinung betrachtet, die mit ständerechtlichen Kriterien zu beschreiben
sei. Als zentrale Quellen galten dieser Sicht demzufolge Rechtsquellen. Daraus
resultierten diverse Debatten, die aus heutiger Sicht überholt scheinen, da zum
einen zumindest implizit ständische Homogenität vorausgesetzt wurde - dies war
aus rechtshistorischer Perspektive ja auch keineswegs ein Fehler - und zum ande-
ren die Suche nach Kontinuitäten zu den Ständen der frühen Leges nahelag. Dies
führte wiederum dazu, daß die Anfänge zeitlich früh angesetzt wurden. Unter-
stützt werden konnte diese Einschätzung mit dem Hinweis auf TacitusS die Wer-
geidbestimmungen der Lex Salica und diverse Nachrichten bei Gregor von Tours:
Daß Unfreie durch gehobenen Dienst und Nähe zum Herrn sozial aufsteigen
konnten, war schon ein altes Phänomen. Die samz prz'zzcz'pz's, zpzz dz'cnizhzr zzzMsczzEzzzg
der agilolfingischen Herzoge zeigen vielleicht schon im Begriff die Annäherung an
den Adel, doch sind auch bei diesem Quellenterminus verschiedene Deutungen
denkbaU. In dieser Perspektive wird erneut auf die germanische Kontinuität ver-
wiesen^.
1 Vgl. neben der älteren Arbeit von FÜRTH, Ministerialen, die neuere, systematisierende und den
militärischen Aspekt stark hervorhebende Darstellung von B. ARNOLD, Knighthood, daneben PARIS-
SE, Les ministeriaux. Zur Forschungsgeschichte vgl. FREED, Origins.
2 Vgl. dazu KUHN, Grenzen, S. 56, 65f., 82.
3 Concilium Dingolfingense, in: MGH Concilia II. Concilia aevi Karolini, Bd. 1, Teil 1, hrsg. v. A.
WERMINGHOFF, Hannover-Leipzig 1906 (ND 1979), Nr. 15, c. 7, S. 95. Die Übersetzung als „Edel-
knechte" ist Gemeingut der Forschung. Kritik an dieser bislang nie bestrittenen Auffassung hat in
jüngster Zeit allerdings WOLFRAM, Salzburg, S. 149ff., geäußert. Mit dem Verweis auf eine Stellung-
nahme von Ingo Reiffenstein deutete Wolfram die adaZscadiac nicht als Edelknechte, sondern als
„Knechte des Edlen", wobei unter dem „Edlen" der bairische Herzog zu verstehen sei.
4 Vgl. etwa BOSL, Ius, S. 294.
Die Ministerialität ist ein viel erörtertes Phänomen, das bis heute zumeist als ein
Spezifikum der deutschen Verfassungs- und Sozialgeschichte gilt und schon früh
die Frage nach der Vergleichbarkeit mit den Verhältnissen in Frankreich aufwarf.
Verbunden wurde die Beschäftigung mit der Ministerialität gewöhnlich mit Un-
tersuchungen zur Entstehung von Rittertum und niederem AdeP.
9.1. Der Streit um die sozialen Ursprünge
Die Ministerialität in Deutschland wurde von der älteren Forschung in erster Linie
als eine Erscheinung betrachtet, die mit ständerechtlichen Kriterien zu beschreiben
sei. Als zentrale Quellen galten dieser Sicht demzufolge Rechtsquellen. Daraus
resultierten diverse Debatten, die aus heutiger Sicht überholt scheinen, da zum
einen zumindest implizit ständische Homogenität vorausgesetzt wurde - dies war
aus rechtshistorischer Perspektive ja auch keineswegs ein Fehler - und zum ande-
ren die Suche nach Kontinuitäten zu den Ständen der frühen Leges nahelag. Dies
führte wiederum dazu, daß die Anfänge zeitlich früh angesetzt wurden. Unter-
stützt werden konnte diese Einschätzung mit dem Hinweis auf TacitusS die Wer-
geidbestimmungen der Lex Salica und diverse Nachrichten bei Gregor von Tours:
Daß Unfreie durch gehobenen Dienst und Nähe zum Herrn sozial aufsteigen
konnten, war schon ein altes Phänomen. Die samz prz'zzcz'pz's, zpzz dz'cnizhzr zzzMsczzEzzzg
der agilolfingischen Herzoge zeigen vielleicht schon im Begriff die Annäherung an
den Adel, doch sind auch bei diesem Quellenterminus verschiedene Deutungen
denkbaU. In dieser Perspektive wird erneut auf die germanische Kontinuität ver-
wiesen^.
1 Vgl. neben der älteren Arbeit von FÜRTH, Ministerialen, die neuere, systematisierende und den
militärischen Aspekt stark hervorhebende Darstellung von B. ARNOLD, Knighthood, daneben PARIS-
SE, Les ministeriaux. Zur Forschungsgeschichte vgl. FREED, Origins.
2 Vgl. dazu KUHN, Grenzen, S. 56, 65f., 82.
3 Concilium Dingolfingense, in: MGH Concilia II. Concilia aevi Karolini, Bd. 1, Teil 1, hrsg. v. A.
WERMINGHOFF, Hannover-Leipzig 1906 (ND 1979), Nr. 15, c. 7, S. 95. Die Übersetzung als „Edel-
knechte" ist Gemeingut der Forschung. Kritik an dieser bislang nie bestrittenen Auffassung hat in
jüngster Zeit allerdings WOLFRAM, Salzburg, S. 149ff., geäußert. Mit dem Verweis auf eine Stellung-
nahme von Ingo Reiffenstein deutete Wolfram die adaZscadiac nicht als Edelknechte, sondern als
„Knechte des Edlen", wobei unter dem „Edlen" der bairische Herzog zu verstehen sei.
4 Vgl. etwa BOSL, Ius, S. 294.