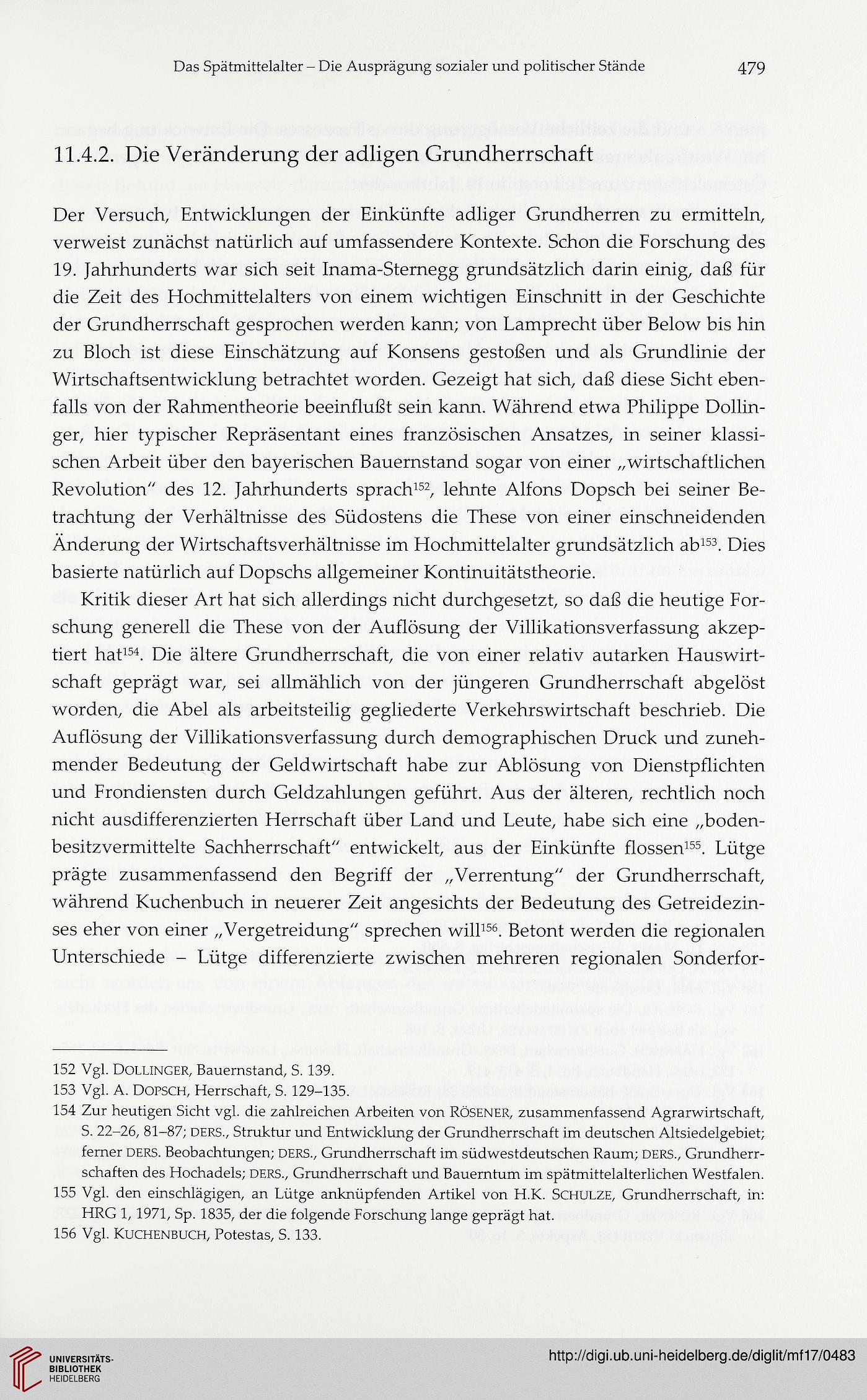Das Spätmittelalter - Die Ausprägung sozialer und politischer Stände
479
11.4.2. Die Veränderung der adligen Grundherrschaft
Der Versuch, Entwicklungen der Einkünfte adliger Grundherren zu ermitteln,
verweist zunächst natürlich auf umfassendere Kontexte. Schon die Forschung des
19. Jahrhunderts war sich seit Inama-Stemegg grundsätzlich darin einig, daß für
die Zeit des Hochmittelalters von einem wichtigen Einschnitt in der Geschichte
der Grundherrschaft gesprochen werden kann; von Lamprecht über Below bis hin
zu Bloch ist diese Einschätzung auf Konsens gestoßen und als Grundlinie der
Wirtschaftsentwicklung betrachtet worden. Gezeigt hat sich, daß diese Sicht eben-
falls von der Rahmentheorie beeinflußt sein kann. Während etwa Philippe Dollin-
ger, hier typischer Repräsentant eines französischen Ansatzes, in seiner klassi-
schen Arbeit über den bayerischen Bauernstand sogar von einer „wirtschaftlichen
Revolution" des 12. Jahrhunderts sprach^, lehnte Alfons Dopsch bei seiner Be-
trachtung der Verhältnisse des Südostens die These von einer einschneidenden
Änderung der Wirtschaftsverhältnisse im Hochmittelalter grundsätzlich aDA Dies
basierte natürlich auf Dopschs allgemeiner Kontinuitätstheorie.
Kritik dieser Art hat sich allerdings nicht durchgesetzt, so daß die heutige For-
schung generell die These von der Auflösung der Villikationsverfassung akzep-
tiert haBA Die ältere Grundherrschaft, die von einer relativ autarken Hauswirt-
schaft geprägt war, sei allmählich von der jüngeren Grundherrschaft abgelöst
worden, die Abel als arbeitsteilig gegliederte Verkehrswirtschaft beschrieb. Die
Auflösung der Villikationsverfassung durch demographischen Druck und zuneh-
mender Bedeutung der Geldwirtschaft habe zur Ablösung von Dienstpflichten
und Frondiensten durch Geldzahlungen geführt. Aus der älteren, rechtlich noch
nicht ausdifferenzierten Herrschaft über Land und Leute, habe sich eine „boden-
besitzvermittelte Sachherrschaft" entwickelt, aus der Einkünfte flosserbA Lütge
prägte zusammenfassend den Begriff der „Verrentung" der Grundherrschaft,
während Kuchenbuch in neuerer Zeit angesichts der Bedeutung des Getreidezin-
ses eher von einer „Vergetreidung" sprechen wilTA Betont werden die regionalen
Unterschiede - Lütge differenzierte zwischen mehreren regionalen Sonderfor-
152 Vgl. DOLLINGER, Bauernstand, S. 139.
153 Vgl. A. DOPSCH, Herrschaft, S. 129-135.
154 Zur heutigen Sicht vgl. die zahlreichen Arbeiten von RÖSENER, zusammenfassend Agrarwirtschaft,
S. 22-26, 81-87; DERS., Struktur und Entwicklung der Grundherrschaft im deutschen Altsiedelgebiet;
ferner DERS. Beobachtungen; DERS., Grundherrschaft im südwestdeutschen Raum; DERS., Grundherr-
schaften des Hochadels; DERS., Grundherrschaft und Bauerntum im spätmittelalterlichen Westfalen.
155 Vgl. den einschlägigen, an Lütge anknüpfenden Artikel von H.K. SCHULZE, Grundherrschaft, in:
HRG 1,1971, Sp. 1835, der die folgende Forschung lange geprägt hat.
156 Vgl. KUCHENBUCH, Potestas, S. 133.
479
11.4.2. Die Veränderung der adligen Grundherrschaft
Der Versuch, Entwicklungen der Einkünfte adliger Grundherren zu ermitteln,
verweist zunächst natürlich auf umfassendere Kontexte. Schon die Forschung des
19. Jahrhunderts war sich seit Inama-Stemegg grundsätzlich darin einig, daß für
die Zeit des Hochmittelalters von einem wichtigen Einschnitt in der Geschichte
der Grundherrschaft gesprochen werden kann; von Lamprecht über Below bis hin
zu Bloch ist diese Einschätzung auf Konsens gestoßen und als Grundlinie der
Wirtschaftsentwicklung betrachtet worden. Gezeigt hat sich, daß diese Sicht eben-
falls von der Rahmentheorie beeinflußt sein kann. Während etwa Philippe Dollin-
ger, hier typischer Repräsentant eines französischen Ansatzes, in seiner klassi-
schen Arbeit über den bayerischen Bauernstand sogar von einer „wirtschaftlichen
Revolution" des 12. Jahrhunderts sprach^, lehnte Alfons Dopsch bei seiner Be-
trachtung der Verhältnisse des Südostens die These von einer einschneidenden
Änderung der Wirtschaftsverhältnisse im Hochmittelalter grundsätzlich aDA Dies
basierte natürlich auf Dopschs allgemeiner Kontinuitätstheorie.
Kritik dieser Art hat sich allerdings nicht durchgesetzt, so daß die heutige For-
schung generell die These von der Auflösung der Villikationsverfassung akzep-
tiert haBA Die ältere Grundherrschaft, die von einer relativ autarken Hauswirt-
schaft geprägt war, sei allmählich von der jüngeren Grundherrschaft abgelöst
worden, die Abel als arbeitsteilig gegliederte Verkehrswirtschaft beschrieb. Die
Auflösung der Villikationsverfassung durch demographischen Druck und zuneh-
mender Bedeutung der Geldwirtschaft habe zur Ablösung von Dienstpflichten
und Frondiensten durch Geldzahlungen geführt. Aus der älteren, rechtlich noch
nicht ausdifferenzierten Herrschaft über Land und Leute, habe sich eine „boden-
besitzvermittelte Sachherrschaft" entwickelt, aus der Einkünfte flosserbA Lütge
prägte zusammenfassend den Begriff der „Verrentung" der Grundherrschaft,
während Kuchenbuch in neuerer Zeit angesichts der Bedeutung des Getreidezin-
ses eher von einer „Vergetreidung" sprechen wilTA Betont werden die regionalen
Unterschiede - Lütge differenzierte zwischen mehreren regionalen Sonderfor-
152 Vgl. DOLLINGER, Bauernstand, S. 139.
153 Vgl. A. DOPSCH, Herrschaft, S. 129-135.
154 Zur heutigen Sicht vgl. die zahlreichen Arbeiten von RÖSENER, zusammenfassend Agrarwirtschaft,
S. 22-26, 81-87; DERS., Struktur und Entwicklung der Grundherrschaft im deutschen Altsiedelgebiet;
ferner DERS. Beobachtungen; DERS., Grundherrschaft im südwestdeutschen Raum; DERS., Grundherr-
schaften des Hochadels; DERS., Grundherrschaft und Bauerntum im spätmittelalterlichen Westfalen.
155 Vgl. den einschlägigen, an Lütge anknüpfenden Artikel von H.K. SCHULZE, Grundherrschaft, in:
HRG 1,1971, Sp. 1835, der die folgende Forschung lange geprägt hat.
156 Vgl. KUCHENBUCH, Potestas, S. 133.