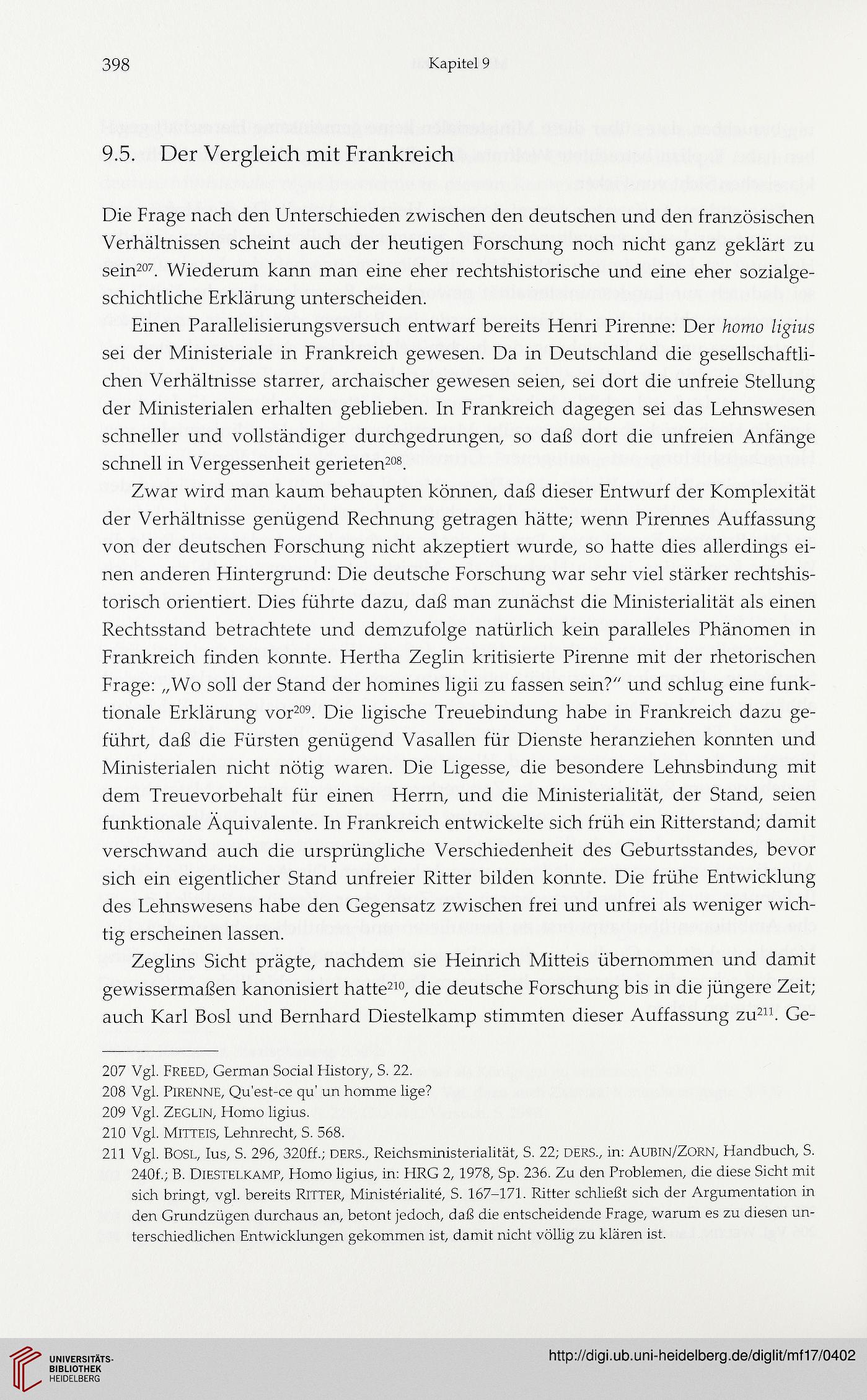398
Kapitel 9
9.5. Der Vergleich mit Frankreich
Die Frage nach den Unterschieden zwischen den deutschen und den französischen
Verhältnissen scheint auch der heutigen Forschung noch nicht ganz geklärt zu
seirPA Wiederum kann man eine eher rechtshistorische und eine eher sozialge-
schichtliche Erklärung unterscheiden.
Einen Parallelisierungsversuch entwarf bereits Henri Pirenne: Der liowo LgDs
sei der Ministeriale in Frankreich gewesen. Da in Deutschland die gesellschaftli-
chen Verhältnisse starrer, archaischer gewesen seien, sei dort die unfreie Stellung
der Ministerialen erhalten geblieben. In Frankreich dagegen sei das Lehnswesen
schneller und vollständiger durchgedrungen, so daß dort die unfreien Anfänge
schnell in Vergessenheit gerieten^.
Zwar wird man kaum behaupten können, daß dieser Entwurf der Komplexität
der Verhältnisse genügend Rechnung getragen hätte; wenn Pirennes Auffassung
von der deutschen Forschung nicht akzeptiert wurde, so hatte dies allerdings ei-
nen anderen Hintergrund: Die deutsche Forschung war sehr viel stärker rechtshis-
torisch orientiert. Dies führte dazu, daß man zunächst die Ministerialität als einen
Rechtsstand betrachtete und demzufolge natürlich kein paralleles Phänomen in
Frankreich finden konnte. Hertha Zeglin kritisierte Pirenne mit der rhetorischen
Frage: „Wo soll der Stand der homines ligii zu fassen sein?" und schlug eine funk-
tionale Erklärung voDA Die ligische Treuebindung habe in Frankreich dazu ge-
führt, daß die Fürsten genügend Vasallen für Dienste heranziehen konnten und
Ministerialen nicht nötig waren. Die Ligesse, die besondere Lehnsbindung mit
dem Treuevorbehalt für einen Herrn, und die Ministerialität, der Stand, seien
funktionale Äquivalente. In Frankreich entwickelte sich früh ein Ritterstand; damit
verschwand auch die ursprüngliche Verschiedenheit des Geburtsstandes, bevor
sich ein eigentlicher Stand unfreier Ritter bilden konnte. Die frühe Entwicklung
des Lehnswesens habe den Gegensatz zwischen frei und unfrei als weniger wich-
tig erscheinen lassen.
Zeglins Sicht prägte, nachdem sie Heinrich Mitteis übernommen und damit
gewissermaßen kanonisiert hattet die deutsche Forschung bis in die jüngere Zeit;
auch Karl Bosl und Bernhard Diestelkamp stimmten dieser Auffassung zWA Ge-
207 Vgl. FREED, German Social History, S. 22.
208 Vgl. PIRENNE, Qu'est-ce qu' un homme lige?
209 Vgl. ZEGLIN, Homo ligius.
210 Vgl. MITTEIS, Lehnrecht, S. 568.
211 Vgl. BOSL, Ius, S. 296, 320ff.; DERS., Reichsministerialität, S. 22; DERS., in: AUBIN/ZORN, Handbuch, S.
2401.; B. DIESTELKAMP, Homo ligius, in: HRG 2, 1978, Sp. 236. Zu den Problemen, die diese Sicht mit
sich bringt, vgl. bereits RITTER, Ministerialite, S. 167-171. Ritter schließt sich der Argumentation in
den Grundzügen durchaus an, betont jedoch, daß die entscheidende Frage, warum es zu diesen un-
terschiedlichen Entwicklungen gekommen ist, damit nicht völlig zu klären ist.
Kapitel 9
9.5. Der Vergleich mit Frankreich
Die Frage nach den Unterschieden zwischen den deutschen und den französischen
Verhältnissen scheint auch der heutigen Forschung noch nicht ganz geklärt zu
seirPA Wiederum kann man eine eher rechtshistorische und eine eher sozialge-
schichtliche Erklärung unterscheiden.
Einen Parallelisierungsversuch entwarf bereits Henri Pirenne: Der liowo LgDs
sei der Ministeriale in Frankreich gewesen. Da in Deutschland die gesellschaftli-
chen Verhältnisse starrer, archaischer gewesen seien, sei dort die unfreie Stellung
der Ministerialen erhalten geblieben. In Frankreich dagegen sei das Lehnswesen
schneller und vollständiger durchgedrungen, so daß dort die unfreien Anfänge
schnell in Vergessenheit gerieten^.
Zwar wird man kaum behaupten können, daß dieser Entwurf der Komplexität
der Verhältnisse genügend Rechnung getragen hätte; wenn Pirennes Auffassung
von der deutschen Forschung nicht akzeptiert wurde, so hatte dies allerdings ei-
nen anderen Hintergrund: Die deutsche Forschung war sehr viel stärker rechtshis-
torisch orientiert. Dies führte dazu, daß man zunächst die Ministerialität als einen
Rechtsstand betrachtete und demzufolge natürlich kein paralleles Phänomen in
Frankreich finden konnte. Hertha Zeglin kritisierte Pirenne mit der rhetorischen
Frage: „Wo soll der Stand der homines ligii zu fassen sein?" und schlug eine funk-
tionale Erklärung voDA Die ligische Treuebindung habe in Frankreich dazu ge-
führt, daß die Fürsten genügend Vasallen für Dienste heranziehen konnten und
Ministerialen nicht nötig waren. Die Ligesse, die besondere Lehnsbindung mit
dem Treuevorbehalt für einen Herrn, und die Ministerialität, der Stand, seien
funktionale Äquivalente. In Frankreich entwickelte sich früh ein Ritterstand; damit
verschwand auch die ursprüngliche Verschiedenheit des Geburtsstandes, bevor
sich ein eigentlicher Stand unfreier Ritter bilden konnte. Die frühe Entwicklung
des Lehnswesens habe den Gegensatz zwischen frei und unfrei als weniger wich-
tig erscheinen lassen.
Zeglins Sicht prägte, nachdem sie Heinrich Mitteis übernommen und damit
gewissermaßen kanonisiert hattet die deutsche Forschung bis in die jüngere Zeit;
auch Karl Bosl und Bernhard Diestelkamp stimmten dieser Auffassung zWA Ge-
207 Vgl. FREED, German Social History, S. 22.
208 Vgl. PIRENNE, Qu'est-ce qu' un homme lige?
209 Vgl. ZEGLIN, Homo ligius.
210 Vgl. MITTEIS, Lehnrecht, S. 568.
211 Vgl. BOSL, Ius, S. 296, 320ff.; DERS., Reichsministerialität, S. 22; DERS., in: AUBIN/ZORN, Handbuch, S.
2401.; B. DIESTELKAMP, Homo ligius, in: HRG 2, 1978, Sp. 236. Zu den Problemen, die diese Sicht mit
sich bringt, vgl. bereits RITTER, Ministerialite, S. 167-171. Ritter schließt sich der Argumentation in
den Grundzügen durchaus an, betont jedoch, daß die entscheidende Frage, warum es zu diesen un-
terschiedlichen Entwicklungen gekommen ist, damit nicht völlig zu klären ist.