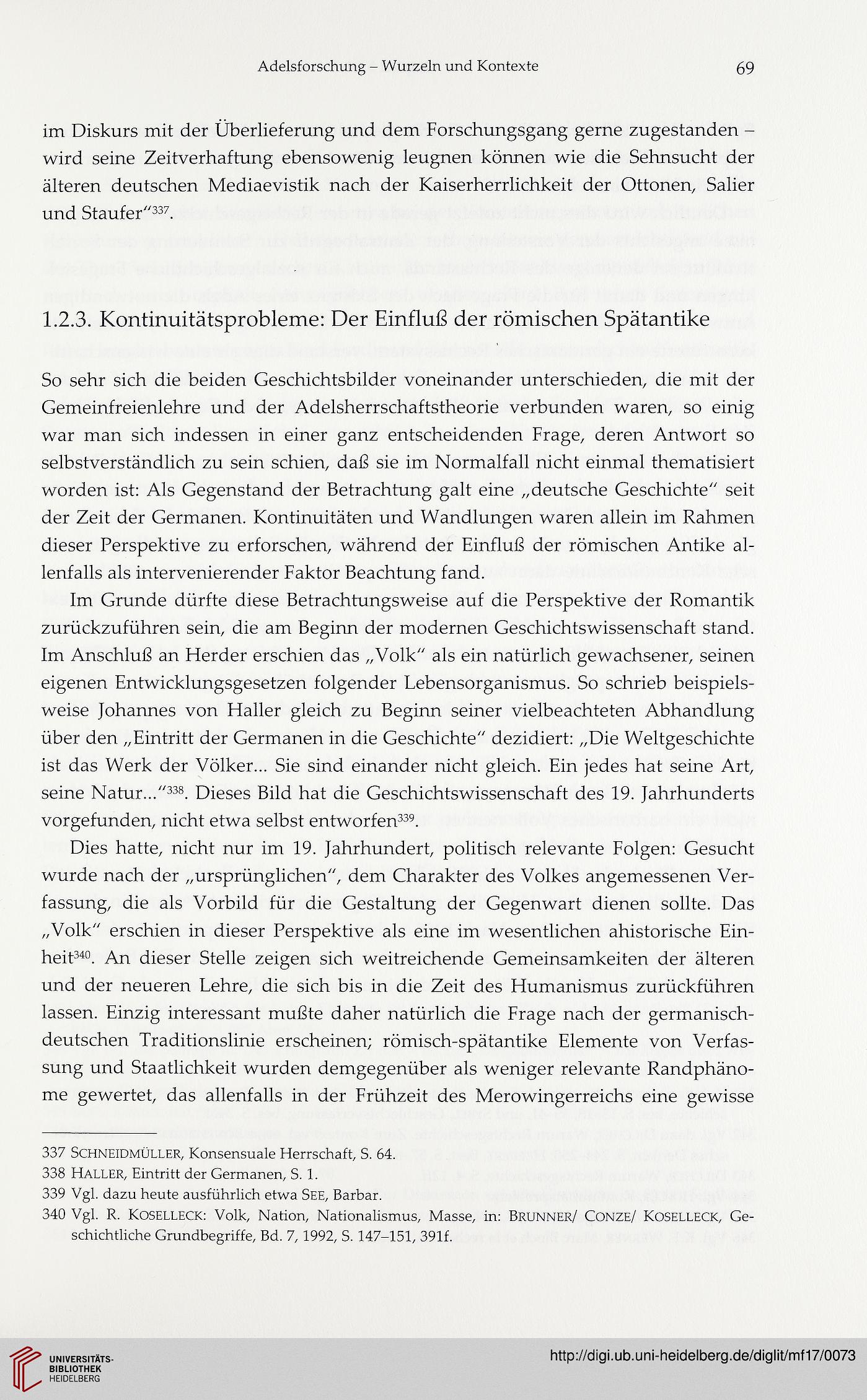Adelsforschung - Wurzeln und Kontexte
69
im Diskurs mit der Überlieferung und dem Forschungsgang gerne zugestanden -
wird seine Zeitverhaftung ebensowenig leugnen können wie die Sehnsucht der
älteren deutschen Mediaevistik nach der Kaiserherrlichkeit der Ottonen, Salier
und Staufer'^.
1.2.3. Kontinuitätsprobleme: Der Einfluß der römischen Spätantike
So sehr sich die beiden Geschichtsbilder voneinander unterschieden, die mit der
Gemeinfreienlehre und der Adelsherrschaftstheorie verbunden waren, so einig
war man sich indessen in einer ganz entscheidenden Frage, deren Antwort so
selbstverständlich zu sein schien, daß sie im Normalfall nicht einmal thematisiert
worden ist: Als Gegenstand der Betrachtung galt eine „deutsche Geschichte" seit
der Zeit der Germanen. Kontinuitäten und Wandlungen waren allein im Rahmen
dieser Perspektive zu erforschen, während der Einfluß der römischen Antike al-
lenfalls als intervenierender Faktor Beachtung fand.
Im Grunde dürfte diese Betrachtungsweise auf die Perspektive der Romantik
zurückzuführen sein, die am Beginn der modernen Geschichtswissenschaft stand.
Im Anschluß an Herder erschien das „Volk" als ein natürlich gewachsener, seinen
eigenen Entwicklungsgesetzen folgender Lebensorganismus. So schrieb beispiels-
weise Johannes von Haller gleich zu Beginn seiner vielbeachteten Abhandlung
über den „Eintritt der Germanen in die Geschichte" dezidiert: „Die Weltgeschichte
ist das Werk der Völker... Sie sind einander nicht gleich. Ein jedes hat seine Art,
seine Natur.Dieses Bild hat die Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts
vorgefunden, nicht etwa selbst entworfen^.
Dies hatte, nicht nur im 19. Jahrhundert, politisch relevante Folgen: Gesucht
wurde nach der „ursprünglichen", dem Charakter des Volkes angemessenen Ver-
fassung, die als Vorbild für die Gestaltung der Gegenwart dienen sollte. Das
„Volk" erschien in dieser Perspektive als eine im wesentlichen ahistorische Ein-
heit^. An dieser Stelle zeigen sich weitreichende Gemeinsamkeiten der älteren
und der neueren Lehre, die sich bis in die Zeit des Humanismus zurückführen
lassen. Einzig interessant mußte daher natürlich die Frage nach der germanisch-
deutschen Traditionslinie erscheinen; römisch-spätantike Elemente von Verfas-
sung und Staatlichkeit wurden demgegenüber als weniger relevante Randphäno-
me gewertet, das allenfalls in der Frühzeit des Merowingerreichs eine gewisse
337 SCHNEIDMÜLLER, Konsensuale Herrschaft, S. 64.
338 HALLER, Eintritt der Germanen, S. 1.
339 Vgl. dazu heute ausführlich etwa SEE, Barbar.
340 Vgl. R. KOSELLECK: Volk, Nation, Nationalismus, Masse, in: BRUNNER/ CONZE/ KOSELLECK, Ge-
schichtliche Grundbegriffe, Bd. 7,1992, S. 147-151, 391f.
69
im Diskurs mit der Überlieferung und dem Forschungsgang gerne zugestanden -
wird seine Zeitverhaftung ebensowenig leugnen können wie die Sehnsucht der
älteren deutschen Mediaevistik nach der Kaiserherrlichkeit der Ottonen, Salier
und Staufer'^.
1.2.3. Kontinuitätsprobleme: Der Einfluß der römischen Spätantike
So sehr sich die beiden Geschichtsbilder voneinander unterschieden, die mit der
Gemeinfreienlehre und der Adelsherrschaftstheorie verbunden waren, so einig
war man sich indessen in einer ganz entscheidenden Frage, deren Antwort so
selbstverständlich zu sein schien, daß sie im Normalfall nicht einmal thematisiert
worden ist: Als Gegenstand der Betrachtung galt eine „deutsche Geschichte" seit
der Zeit der Germanen. Kontinuitäten und Wandlungen waren allein im Rahmen
dieser Perspektive zu erforschen, während der Einfluß der römischen Antike al-
lenfalls als intervenierender Faktor Beachtung fand.
Im Grunde dürfte diese Betrachtungsweise auf die Perspektive der Romantik
zurückzuführen sein, die am Beginn der modernen Geschichtswissenschaft stand.
Im Anschluß an Herder erschien das „Volk" als ein natürlich gewachsener, seinen
eigenen Entwicklungsgesetzen folgender Lebensorganismus. So schrieb beispiels-
weise Johannes von Haller gleich zu Beginn seiner vielbeachteten Abhandlung
über den „Eintritt der Germanen in die Geschichte" dezidiert: „Die Weltgeschichte
ist das Werk der Völker... Sie sind einander nicht gleich. Ein jedes hat seine Art,
seine Natur.Dieses Bild hat die Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts
vorgefunden, nicht etwa selbst entworfen^.
Dies hatte, nicht nur im 19. Jahrhundert, politisch relevante Folgen: Gesucht
wurde nach der „ursprünglichen", dem Charakter des Volkes angemessenen Ver-
fassung, die als Vorbild für die Gestaltung der Gegenwart dienen sollte. Das
„Volk" erschien in dieser Perspektive als eine im wesentlichen ahistorische Ein-
heit^. An dieser Stelle zeigen sich weitreichende Gemeinsamkeiten der älteren
und der neueren Lehre, die sich bis in die Zeit des Humanismus zurückführen
lassen. Einzig interessant mußte daher natürlich die Frage nach der germanisch-
deutschen Traditionslinie erscheinen; römisch-spätantike Elemente von Verfas-
sung und Staatlichkeit wurden demgegenüber als weniger relevante Randphäno-
me gewertet, das allenfalls in der Frühzeit des Merowingerreichs eine gewisse
337 SCHNEIDMÜLLER, Konsensuale Herrschaft, S. 64.
338 HALLER, Eintritt der Germanen, S. 1.
339 Vgl. dazu heute ausführlich etwa SEE, Barbar.
340 Vgl. R. KOSELLECK: Volk, Nation, Nationalismus, Masse, in: BRUNNER/ CONZE/ KOSELLECK, Ge-
schichtliche Grundbegriffe, Bd. 7,1992, S. 147-151, 391f.