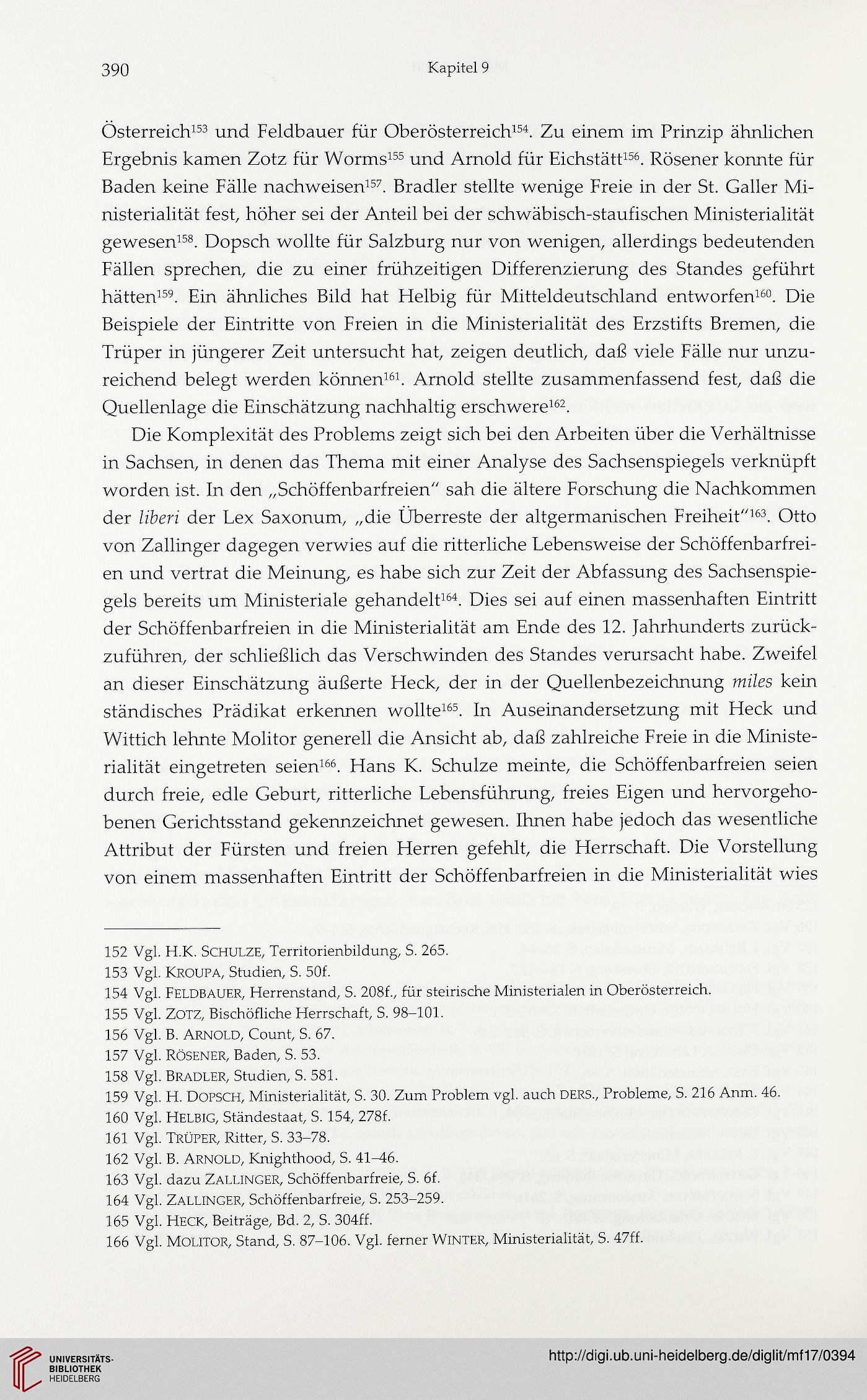390
Kapitel 9
Österreich^ und Feldbauer für Oberösterreicfü^. Zu einem im Prinzip ähnlichen
Ergebnis kamen Zotz für Worms^ und Arnold für Eichstätt^. Rösener konnte für
Baden keine Fälle nachweisen^?. Bradler stellte wenige Freie in der St. Galler Mi-
nisterialität fest, höher sei der Anteil bei der schwäbisch-staufischen Ministerialität
gewesenes. Dopsch wollte für Salzburg nur von wenigen, allerdings bedeutenden
Fällen sprechen, die zu einer frühzeitigen Differenzierung des Standes geführt
hätten^. Ein ähnliches Bild hat Helbig für Mitteldeutschland entworfen^". Die
Beispiele der Eintritte von Freien in die Ministerialität des Erzstifts Bremen, die
Trüper in jüngerer Zeit untersucht hat, zeigen deutlich, daß viele Fälle nur unzu-
reichend belegt werden könnende Arnold stellte zusammenfassend fest, daß die
Quellenlage die Einschätzung nachhaltig erschwere^.
Die Komplexität des Problems zeigt sich bei den Arbeiten über die Verhältnisse
in Sachsen, in denen das Thema mit einer Analyse des Sachsenspiegels verknüpft
worden ist. In den „Schöffenbarfreien" sah die ältere Forschung die Nachkommen
der dbvr;' der Lex Saxonum, „die Überreste der altgermanischen Freiheit"^. Otto
von Zallinger dagegen verwies auf die ritterliche Lebensweise der Schöffenbarfrei-
en und vertrat die Meinung, es habe sich zur Zeit der Abfassung des Sachsenspie-
gels bereits um Ministeriale gehandelt^. Dies sei auf einen massenhaften Eintritt
der Schöffenbarfreien in die Ministerialität am Ende des 12. Jahrhunderts zurück-
zuführen, der schließlich das Verschwinden des Standes verursacht habe. Zweifel
an dieser Einschätzung äußerte Fleck, der in der Quellenbezeichnung mz'les kein
ständisches Prädikat erkennen wollte^. In Auseinandersetzung mit Fleck und
Wittich lehnte Molitor generell die Ansicht ab, daß zahlreiche Freie in die Ministe-
rialität eingetreten seiend Hans K. Schulze meinte, die Schöffenbarfreien seien
durch freie, edle Geburt, ritterliche Lebensführung, freies Eigen und hervorgeho-
benen Gerichtsstand gekennzeichnet gewesen. Ihnen habe jedoch das wesentliche
Attribut der Fürsten und freien Herren gefehlt, die Herrschaft. Die Vorstellung
von einem massenhaften Eintritt der Schöffenbarfreien in die Ministerialität wies
152 Vgl. H.K. SCHULZE, Territorienbildung, S. 265.
153 Vgl. KROUPA, Studien, S. 50f.
154 Vgl. FELDBAUER, Herrenstand, S. 208f., für steirische Ministerialen in Oberösterreich.
155 Vgl. ZOTZ, Bischöfliche Herrschaft, S. 98-101.
156 Vgl. B. ARNOLD, Count, S. 67.
157 Vgl. RÖSENER, Baden, S. 53.
158 Vgl. BRADLER, Studien, S. 581.
159 Vgl. H. DOPSCH, Ministerialität, S. 30. Zum Problem vgl. auch DERS., Probleme, S. 216 Anm. 46.
160 Vgl. HELBIG, Ständestaat, S. 154, 278f.
161 Vgl. TRÜPER, Ritter, S. 33-78.
162 Vgl. B. ARNOLD, Knighthood, S. 41-46.
163 Vgl. dazu ZALLINGER, Schöffenbarfreie, S. 6f.
164 Vgl. ZALLINGER, Schöffenbarfreie, S. 253-259.
165 Vgl. HECK, Beiträge, Bd. 2, S. 304ff.
166 Vgl. MOLITOR, Stand, S. 87-106. Vgl. ferner WINTER, Ministerialität, S. 47ff.
Kapitel 9
Österreich^ und Feldbauer für Oberösterreicfü^. Zu einem im Prinzip ähnlichen
Ergebnis kamen Zotz für Worms^ und Arnold für Eichstätt^. Rösener konnte für
Baden keine Fälle nachweisen^?. Bradler stellte wenige Freie in der St. Galler Mi-
nisterialität fest, höher sei der Anteil bei der schwäbisch-staufischen Ministerialität
gewesenes. Dopsch wollte für Salzburg nur von wenigen, allerdings bedeutenden
Fällen sprechen, die zu einer frühzeitigen Differenzierung des Standes geführt
hätten^. Ein ähnliches Bild hat Helbig für Mitteldeutschland entworfen^". Die
Beispiele der Eintritte von Freien in die Ministerialität des Erzstifts Bremen, die
Trüper in jüngerer Zeit untersucht hat, zeigen deutlich, daß viele Fälle nur unzu-
reichend belegt werden könnende Arnold stellte zusammenfassend fest, daß die
Quellenlage die Einschätzung nachhaltig erschwere^.
Die Komplexität des Problems zeigt sich bei den Arbeiten über die Verhältnisse
in Sachsen, in denen das Thema mit einer Analyse des Sachsenspiegels verknüpft
worden ist. In den „Schöffenbarfreien" sah die ältere Forschung die Nachkommen
der dbvr;' der Lex Saxonum, „die Überreste der altgermanischen Freiheit"^. Otto
von Zallinger dagegen verwies auf die ritterliche Lebensweise der Schöffenbarfrei-
en und vertrat die Meinung, es habe sich zur Zeit der Abfassung des Sachsenspie-
gels bereits um Ministeriale gehandelt^. Dies sei auf einen massenhaften Eintritt
der Schöffenbarfreien in die Ministerialität am Ende des 12. Jahrhunderts zurück-
zuführen, der schließlich das Verschwinden des Standes verursacht habe. Zweifel
an dieser Einschätzung äußerte Fleck, der in der Quellenbezeichnung mz'les kein
ständisches Prädikat erkennen wollte^. In Auseinandersetzung mit Fleck und
Wittich lehnte Molitor generell die Ansicht ab, daß zahlreiche Freie in die Ministe-
rialität eingetreten seiend Hans K. Schulze meinte, die Schöffenbarfreien seien
durch freie, edle Geburt, ritterliche Lebensführung, freies Eigen und hervorgeho-
benen Gerichtsstand gekennzeichnet gewesen. Ihnen habe jedoch das wesentliche
Attribut der Fürsten und freien Herren gefehlt, die Herrschaft. Die Vorstellung
von einem massenhaften Eintritt der Schöffenbarfreien in die Ministerialität wies
152 Vgl. H.K. SCHULZE, Territorienbildung, S. 265.
153 Vgl. KROUPA, Studien, S. 50f.
154 Vgl. FELDBAUER, Herrenstand, S. 208f., für steirische Ministerialen in Oberösterreich.
155 Vgl. ZOTZ, Bischöfliche Herrschaft, S. 98-101.
156 Vgl. B. ARNOLD, Count, S. 67.
157 Vgl. RÖSENER, Baden, S. 53.
158 Vgl. BRADLER, Studien, S. 581.
159 Vgl. H. DOPSCH, Ministerialität, S. 30. Zum Problem vgl. auch DERS., Probleme, S. 216 Anm. 46.
160 Vgl. HELBIG, Ständestaat, S. 154, 278f.
161 Vgl. TRÜPER, Ritter, S. 33-78.
162 Vgl. B. ARNOLD, Knighthood, S. 41-46.
163 Vgl. dazu ZALLINGER, Schöffenbarfreie, S. 6f.
164 Vgl. ZALLINGER, Schöffenbarfreie, S. 253-259.
165 Vgl. HECK, Beiträge, Bd. 2, S. 304ff.
166 Vgl. MOLITOR, Stand, S. 87-106. Vgl. ferner WINTER, Ministerialität, S. 47ff.