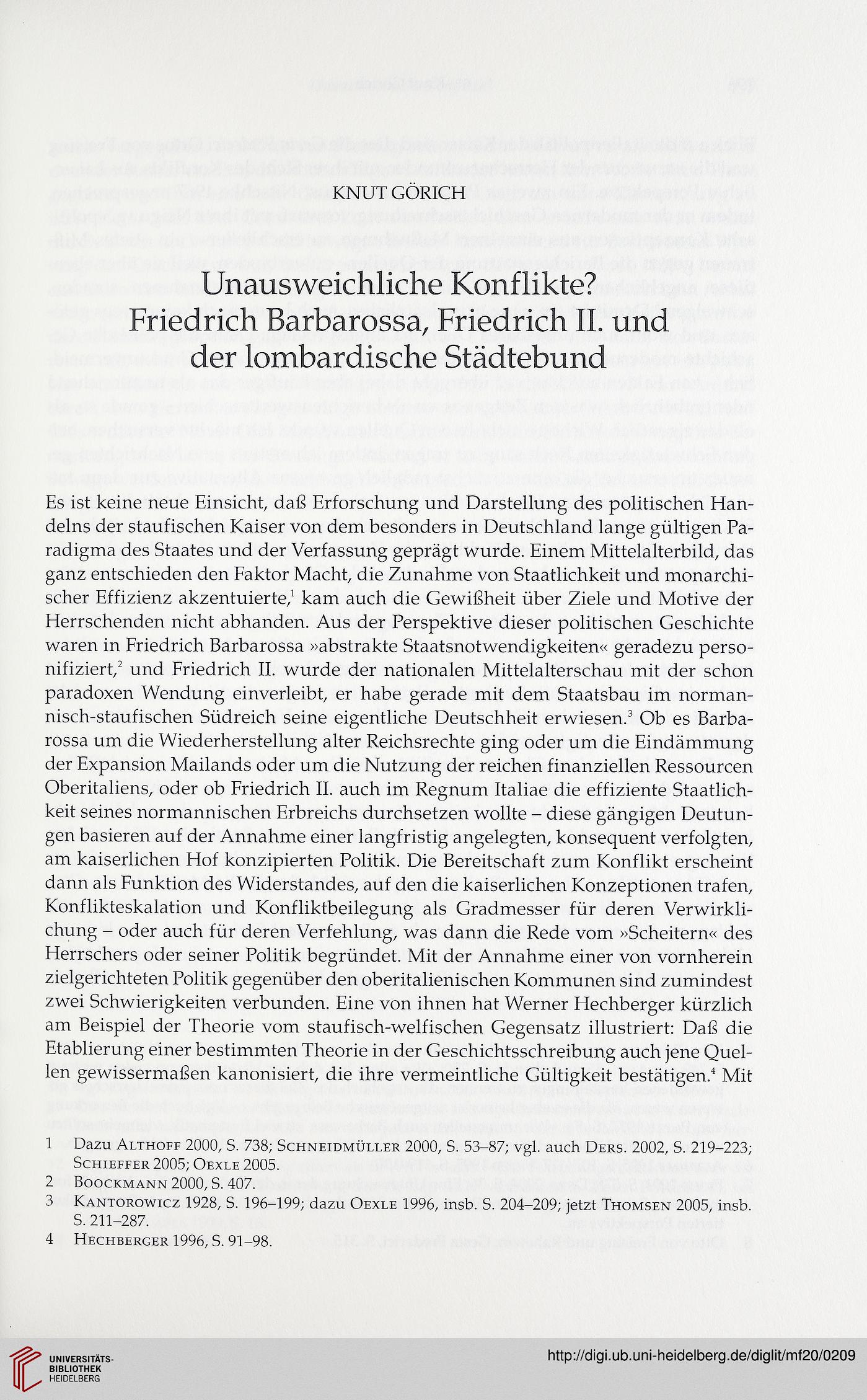KNUT GORICH
Unausweichliche Konflikte?
Friedrich Barbarossa, Friedrich II. und
der lombardische Städtebund
Es ist keine neue Einsicht, daß Erforschung und Darstellung des politischen Han-
delns der staufischen Kaiser von dem besonders in Deutschland lange gültigen Pa-
radigma des Staates und der Verfassung geprägt wurde. Einem Mittelalterbild, das
ganz entschieden den Faktor Macht, die Zunahme von Staatlichkeit und monarchi-
scher Effizienz akzentuierte,1 kam auch die Gewißheit über Ziele und Motive der
Herrschenden nicht abhanden. Aus der Perspektive dieser politischen Geschichte
waren in Friedrich Barbarossa »abstrakte Staatsnotwendigkeiten« geradezu perso-
nifiziert,2 und Friedrich II. wurde der nationalen Mittelalterschau mit der schon
paradoxen Wendung einverleibt, er habe gerade mit dem Staatsbau im norman-
nisch-staufischen Südreich seine eigentliche Deutschheit erwiesen.3 Ob es Barba-
rossa um die Wiederherstellung alter Reichsrechte ging oder um die Eindämmung
der Expansion Mailands oder um die Nutzung der reichen finanziellen Ressourcen
Oberitaliens, oder ob Friedrich II. auch im Regnum Italiae die effiziente Staatlich-
keit seines normannischen Erbreichs durchsetzen wollte - diese gängigen Deutun-
gen basieren auf der Annahme einer langfristig angelegten, konsequent verfolgten,
am kaiserlichen Hof konzipierten Politik. Die Bereitschaft zum Konflikt erscheint
dann als Funktion des Widerstandes, auf den die kaiserlichen Konzeptionen trafen,
Konflikteskalation und Konfliktbeilegung als Gradmesser für deren Verwirkli-
chung - oder auch für deren Verfehlung, was dann die Rede vom »Scheitern« des
Herrschers oder seiner Politik begründet. Mit der Annahme einer von vornherein
zielgerichteten Politik gegenüber den oberitalienischen Kommunen sind zumindest
zwei Schwierigkeiten verbunden. Eine von ihnen hat Werner Hechberger kürzlich
am Beispiel der Theorie vom staufisch-welfischen Gegensatz illustriert: Daß die
Etablierung einer bestimmten Theorie in der Geschichtsschreibung auch jene Quel-
len gewissermaßen kanonisiert, die ihre vermeintliche Gültigkeit bestätigen.4 Mit
1 Dazu Althoff 2000, S. 738; Schneidmüller 2000, S. 53-87; vgl. auch Ders. 2002, S. 219-223;
Schieffer 2005; Oexle 2005.
2 Boockmann 2000, S. 407.
3 Kantorowicz 1928, S. 196-199; dazu Oexle 1996, insb. S. 204-209; jetzt Thomsen 2005, insb.
S. 211-287.
4 Hechberger 1996, S. 91-98.
Unausweichliche Konflikte?
Friedrich Barbarossa, Friedrich II. und
der lombardische Städtebund
Es ist keine neue Einsicht, daß Erforschung und Darstellung des politischen Han-
delns der staufischen Kaiser von dem besonders in Deutschland lange gültigen Pa-
radigma des Staates und der Verfassung geprägt wurde. Einem Mittelalterbild, das
ganz entschieden den Faktor Macht, die Zunahme von Staatlichkeit und monarchi-
scher Effizienz akzentuierte,1 kam auch die Gewißheit über Ziele und Motive der
Herrschenden nicht abhanden. Aus der Perspektive dieser politischen Geschichte
waren in Friedrich Barbarossa »abstrakte Staatsnotwendigkeiten« geradezu perso-
nifiziert,2 und Friedrich II. wurde der nationalen Mittelalterschau mit der schon
paradoxen Wendung einverleibt, er habe gerade mit dem Staatsbau im norman-
nisch-staufischen Südreich seine eigentliche Deutschheit erwiesen.3 Ob es Barba-
rossa um die Wiederherstellung alter Reichsrechte ging oder um die Eindämmung
der Expansion Mailands oder um die Nutzung der reichen finanziellen Ressourcen
Oberitaliens, oder ob Friedrich II. auch im Regnum Italiae die effiziente Staatlich-
keit seines normannischen Erbreichs durchsetzen wollte - diese gängigen Deutun-
gen basieren auf der Annahme einer langfristig angelegten, konsequent verfolgten,
am kaiserlichen Hof konzipierten Politik. Die Bereitschaft zum Konflikt erscheint
dann als Funktion des Widerstandes, auf den die kaiserlichen Konzeptionen trafen,
Konflikteskalation und Konfliktbeilegung als Gradmesser für deren Verwirkli-
chung - oder auch für deren Verfehlung, was dann die Rede vom »Scheitern« des
Herrschers oder seiner Politik begründet. Mit der Annahme einer von vornherein
zielgerichteten Politik gegenüber den oberitalienischen Kommunen sind zumindest
zwei Schwierigkeiten verbunden. Eine von ihnen hat Werner Hechberger kürzlich
am Beispiel der Theorie vom staufisch-welfischen Gegensatz illustriert: Daß die
Etablierung einer bestimmten Theorie in der Geschichtsschreibung auch jene Quel-
len gewissermaßen kanonisiert, die ihre vermeintliche Gültigkeit bestätigen.4 Mit
1 Dazu Althoff 2000, S. 738; Schneidmüller 2000, S. 53-87; vgl. auch Ders. 2002, S. 219-223;
Schieffer 2005; Oexle 2005.
2 Boockmann 2000, S. 407.
3 Kantorowicz 1928, S. 196-199; dazu Oexle 1996, insb. S. 204-209; jetzt Thomsen 2005, insb.
S. 211-287.
4 Hechberger 1996, S. 91-98.