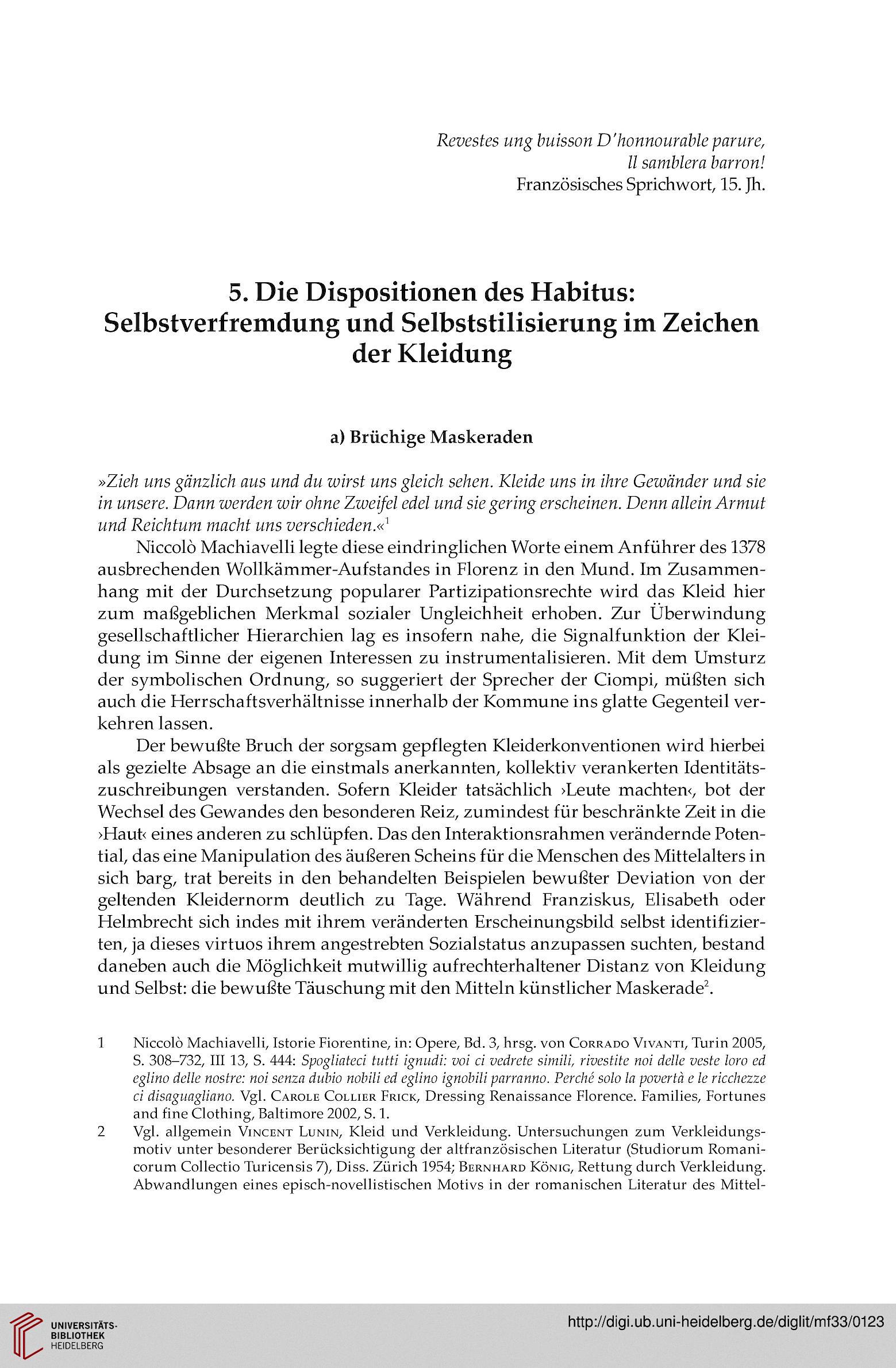Revestes ung buisson D'honnourable parure,
Il samblera burroni
Französisches Sprichwort, 15. Jh.
5. Die Dispositionen des Habitus:
Selbstverfremdung und Selbststilisierung im Zeichen
der Kleidung
a) Brüchige Maskeraden
»Zieh uns gänzlich aus und du wirst uns gleich sehen. Kleide uns in ihre Gewänder und sie
in unsere. Dann werden wir ohne Zweifel edel und sie gering erscheinen. Denn allein Armut
und Reichtum macht uns verschieden.«1
Niccolò Machiavelli legte diese eindringlichen Worte einem Anführer des 1378
ausbrechenden Wollkämmer-Auf Standes in Florenz in den Mund. Im Zusammen-
hang mit der Durchsetzung popularer Partizipationsrechte wird das Kleid hier
zum maßgeblichen Merkmal sozialer Ungleichheit erhoben. Zur Überwindung
gesellschaftlicher Hierarchien lag es insofern nahe, die Signalfunktion der Klei-
dung im Sinne der eigenen Interessen zu instrumentalisieren. Mit dem Umsturz
der symbolischen Ordnung, so suggeriert der Sprecher der Ciompi, müßten sich
auch die Herrschaftsverhältnisse innerhalb der Kommune ins glatte Gegenteil ver-
kehren lassen.
Der bewußte Bruch der sorgsam gepflegten Kleiderkonventionen wird hierbei
als gezielte Absage an die einstmals anerkannten, kollektiv verankerten Identitäts-
zuschreibungen verstanden. Sofern Kleider tatsächlich >Leute machten<, bot der
Wechsel des Gewandes den besonderen Reiz, zumindest für beschränkte Zeit in die
>Haut< eines anderen zu schlüpfen. Das den Interaktionsrahmen verändernde Poten-
tial, das eine Manipulation des äußeren Scheins für die Menschen des Mittelalters in
sich barg, trat bereits in den behandelten Beispielen bewußter Deviation von der
geltenden Kleidernorm deutlich zu Tage. Während Franziskus, Elisabeth oder
Helmbrecht sich indes mit ihrem veränderten Erscheinungsbild selbst identifizier-
ten, ja dieses virtuos ihrem angestrebten Sozialstatus anzupassen suchten, bestand
daneben auch die Möglichkeit mutwillig aufrechterhaltener Distanz von Kleidung
und Selbst: die bewußte Täuschung mit den Mitteln künstlicher Maskerade2.
1 Niccolò Machiavelli, Istorie Fiorentine, in: Opere, Bd. 3, hrsg. von Corrado Vivanti, Turin 2005,
S. 308-732, III 13, S. 444: Spogliateci tutti ignudi: voi ci vedrete simili, rivestite noi delle veste loro ed
eglino delle nostre: noi senza duino nobili ed eglino ignobili parranno. Perché solo la povertà e le ricchezze
ci disaguagliano. Vgl. Carole Collier Frick, Dressing Renaissance Florence. Families, Fortunes
and fine Clothing, Baltimore 2002, S. 1.
2 Vgl. allgemein Vincent Lunin, Kleid und Verkleidung. Untersuchungen zum Verkleidungs-
motiv unter besonderer Berücksichtigung der altfranzösischen Literatur (Studiorum Romani-
corum Collectio Turicensis 7), Diss. Zürich 1954; Bernhard König, Rettung durch Verkleidung.
Abwandlungen eines episch-novellistischen Motivs in der romanischen Literatur des Mittel-
Il samblera burroni
Französisches Sprichwort, 15. Jh.
5. Die Dispositionen des Habitus:
Selbstverfremdung und Selbststilisierung im Zeichen
der Kleidung
a) Brüchige Maskeraden
»Zieh uns gänzlich aus und du wirst uns gleich sehen. Kleide uns in ihre Gewänder und sie
in unsere. Dann werden wir ohne Zweifel edel und sie gering erscheinen. Denn allein Armut
und Reichtum macht uns verschieden.«1
Niccolò Machiavelli legte diese eindringlichen Worte einem Anführer des 1378
ausbrechenden Wollkämmer-Auf Standes in Florenz in den Mund. Im Zusammen-
hang mit der Durchsetzung popularer Partizipationsrechte wird das Kleid hier
zum maßgeblichen Merkmal sozialer Ungleichheit erhoben. Zur Überwindung
gesellschaftlicher Hierarchien lag es insofern nahe, die Signalfunktion der Klei-
dung im Sinne der eigenen Interessen zu instrumentalisieren. Mit dem Umsturz
der symbolischen Ordnung, so suggeriert der Sprecher der Ciompi, müßten sich
auch die Herrschaftsverhältnisse innerhalb der Kommune ins glatte Gegenteil ver-
kehren lassen.
Der bewußte Bruch der sorgsam gepflegten Kleiderkonventionen wird hierbei
als gezielte Absage an die einstmals anerkannten, kollektiv verankerten Identitäts-
zuschreibungen verstanden. Sofern Kleider tatsächlich >Leute machten<, bot der
Wechsel des Gewandes den besonderen Reiz, zumindest für beschränkte Zeit in die
>Haut< eines anderen zu schlüpfen. Das den Interaktionsrahmen verändernde Poten-
tial, das eine Manipulation des äußeren Scheins für die Menschen des Mittelalters in
sich barg, trat bereits in den behandelten Beispielen bewußter Deviation von der
geltenden Kleidernorm deutlich zu Tage. Während Franziskus, Elisabeth oder
Helmbrecht sich indes mit ihrem veränderten Erscheinungsbild selbst identifizier-
ten, ja dieses virtuos ihrem angestrebten Sozialstatus anzupassen suchten, bestand
daneben auch die Möglichkeit mutwillig aufrechterhaltener Distanz von Kleidung
und Selbst: die bewußte Täuschung mit den Mitteln künstlicher Maskerade2.
1 Niccolò Machiavelli, Istorie Fiorentine, in: Opere, Bd. 3, hrsg. von Corrado Vivanti, Turin 2005,
S. 308-732, III 13, S. 444: Spogliateci tutti ignudi: voi ci vedrete simili, rivestite noi delle veste loro ed
eglino delle nostre: noi senza duino nobili ed eglino ignobili parranno. Perché solo la povertà e le ricchezze
ci disaguagliano. Vgl. Carole Collier Frick, Dressing Renaissance Florence. Families, Fortunes
and fine Clothing, Baltimore 2002, S. 1.
2 Vgl. allgemein Vincent Lunin, Kleid und Verkleidung. Untersuchungen zum Verkleidungs-
motiv unter besonderer Berücksichtigung der altfranzösischen Literatur (Studiorum Romani-
corum Collectio Turicensis 7), Diss. Zürich 1954; Bernhard König, Rettung durch Verkleidung.
Abwandlungen eines episch-novellistischen Motivs in der romanischen Literatur des Mittel-