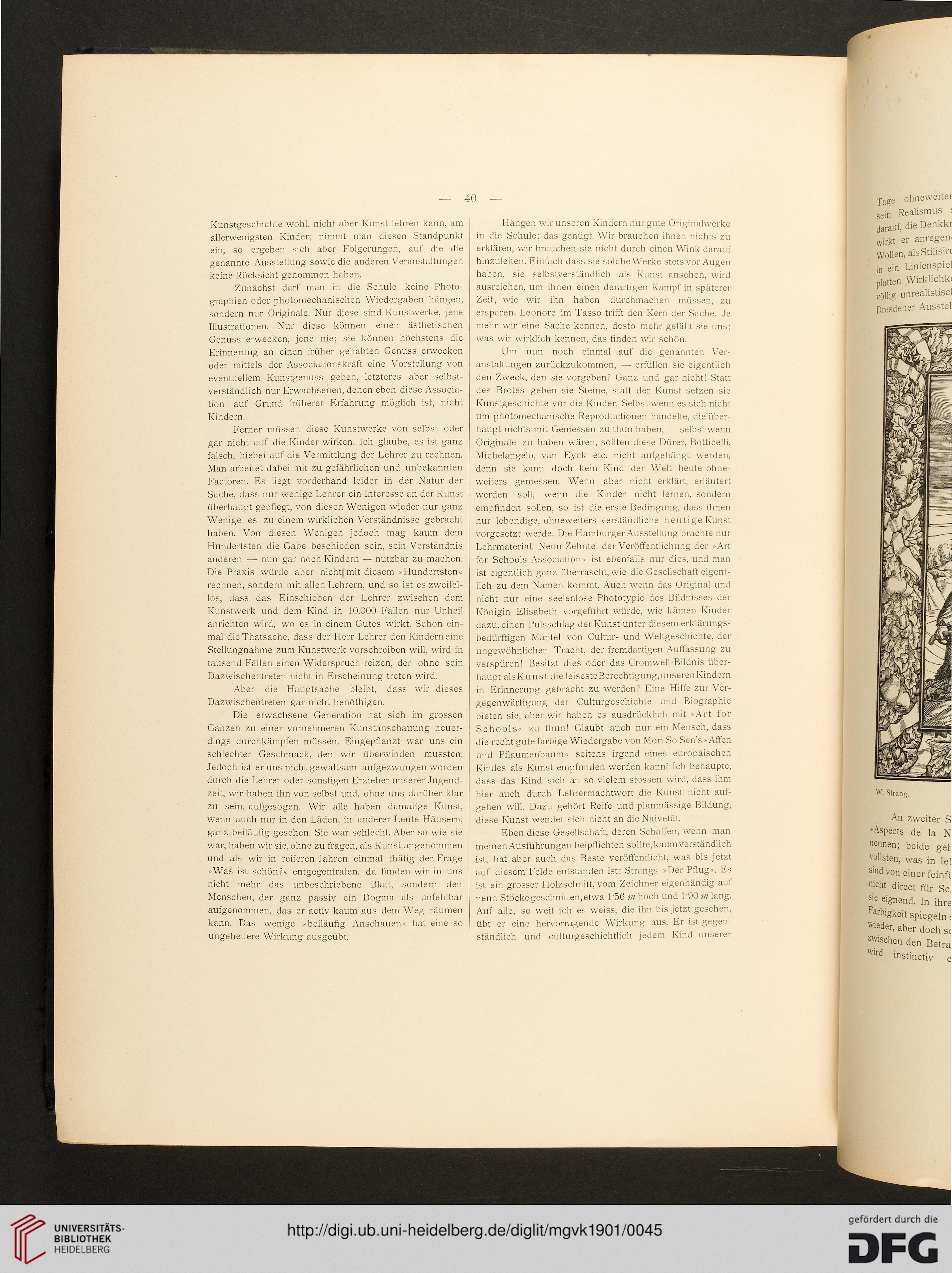— 40 —
Kunstgeschichte wohl, nicht aber Kunst lehren kann, am
allerwenigsten Kinder; nimmt man diesen Standpunkt
ein, so ergeben sich aber Folgerungen, auf die die
genannte Ausstellung sowie die anderen Veranstaltungen
keine Rücksicht genommen haben.
Zunächst darf man in die Schule keine Photo-
graphien oder photomechanischen Wiedergaben hängen,
sondern nur Originale. Nur diese sind Kunstwerke, jene
Illustrationen. Nur diese können einen ästhetischen
Genuss erwecken, jene nie; sie können höchstens die
Erinnerung an einen früher gehabten Genuss erwecken
oder mittels der Associationskraft eine Vorstellung von
eventuellem Kunstgenuss geben, letzteres aber selbst-
verständlich nur Erwachsenen, denen eben diese Associa-
tion auf Grund früherer Erfahrung möglich ist, nicht
Kindern.
Ferner müssen diese Kunstwerke von selbst oder
gar nicht auf die Kinder wirken. Ich glaube, es ist ganz
salsch, hiebei auf die Vermittlung der Lehrer zu rechnen.
Man arbeitet dabei mit zu gefährlichen und unbekannten
Factoren. Es liegt vorderhand leider in der Natur der
Sache, dass nur wenige Lehrer ein Interesse an der Kunst
überhaupt gepflegt, von diesen Wenigen wieder nur ganz
Wenige es zu einem wirklichen Verständnisse gebracht
haben. Von diesen Wenigen jedoch mag kaum dem
Hundertsten die Gabe beschieden sein, sein Verständnis
anderen — nun gar noch Kindern — nutzbar zu machen.
Die Praxis würde aber nicht(mit diesem »Hundertsten«
rechnen, sondern mit allen Lehrern, und so ist es zweifel-
los, dass das Einschieben der Lehrer zwischen dem
Kunstwerk und dem Kind in 10.000 Fällen nur Unheil
anrichten wird, wo es in einem Gutes wirkt. Schon ein-
mal die Thatsache, dass der Herr Lehrer den Kindern eine
Stellungnahme zum Kunstwerk vorschreiben will, wird in
tausend Fällen einen Widerspruch reizen, der ohne sein
Dazwischentreten nicht in Erscheinung treten wird.
Aber die Hauptsache bleibt, dass wir dieses
Dazwischentreten gar nicht benöthigen.
Die erwachsene Generation hat sich im grossen
Ganzen zu einer vornehmeren Kunstanschauung neuer-
dings durchkämpfen müssen. Eingepflanzt war uns ein
schlechter Geschmack, den wir überwinden mussten.
Jedoch ist er uns nicht gewaltsam aufgezwungen worden
durch die Lehrer oder sonstigen Erzieher unserer Jugend-
zeit, wir haben ihn von selbst und, ohne uns darüber klar
zu sein, aufgesogen. Wir alle haben damalige Kunst,
wenn auch nur in den Läden, in anderer Leute Häusern,
ganz beiläufig gesehen. Sie war schlecht. Aber so wie sie
war, haben wir sie, ohne zu fragen, als Kunst angenommen
und als wir in reiferen Jahren einmal thätig der Frage
»Was ist schön?« entgegentraten, da fanden wir in uns
nicht mehr das unbeschriebene Blatt, sondern den
Menschen, der ganz passiv ein Dogma als unfehlbar
aufgenommen, das er activ kaum aus dem Weg räumen
kann. Das wenige »beiläufig Anschauen« hat eine so
ungeheuere Wirkung ausgeübt.
Hängen wir unseren Kindern nur gute Originalwerke
in die Schule; das genügt. Wir brauchen ihnen nichts zu
erklären, wir brauchen sie nicht durch einen Wink daraus
hinzuleiten. Einsach dass sie solche Werke stets vor Augen
haben, sie selbstverständlich als Kunst ansehen, wird
ausreichen, um ihnen einen derartigen Kamps in späterer
Zeit, wie wir ihn haben durchmachen müssen, zu
ersparen. Leonore im Tasso trisst den Kern der Sache. Je
mehr wir eine Sache kennen, desto mehr gesällt sie uns;
was wir wirklich kennen, das finden wir schön.
Um nun noch einmal aus die genannten Ver-
anstaltungen zurückzukommen, — ersüllen sie eigentlich
den Zweck, den sie vorgeben? Ganz und gar nicht! Statt
des Brotes geben sie Steine, statt der Kunst setzen sie
Kunstgeschichte vor die Kinder. Selbst wenn es sich nicht
um photomechanische Reproductionen handelte, die über-
haupt nichts mit Geniessen zu thun haben, — selbst wenn
Originale zu haben wären, sollten diese Dürer, Botticelli,
Michelangelo, van Eyck etc. nicht ausgehängt werden,
denn sie kann doch kein Kind der Welt heute ohne-
weiters geniessen. Wenn aber nicht erklärt, erläutert
werden soll, wenn die Kinder nicht lernen, sondern
empfinden sollen, so ist die erste Bedingung, dass ihnen
nur lebendige, ohneweiters verständliche heutige Kunst
vorgesetzt werde. Die Hamburger Ausstellung brachte nur
Lehrmaterial. Neun Zehntel der Verösfentlichung der »Art
for Schools Association« ist ebensalls nur dies, und man
ist eigentlich ganz überrascht, wie die Gesellschast eigent-
lich zu dem Namen kommt. Auch wenn das Original und
nicht nur eine seelenlose Phototypie des Bildnisses der
Königin Elisabeth vorgesührt würde, wie kämen Kinder
dazu, einen Pulsschlag der Kunst unter diesem erklärungs-
bedürstigen Mantel von Cultur- und Weltgeschichte, der
ungewöhnlichen Tracht, der sremdartigen Ausfassung zu
verspüren! Besitzt dies oder das Cromwell-Bildnis über-
haupt als Kunst die leiseste Berechtigung, unseren Kindern
in Erinnerung gebracht zu werden? Eine Hilse zur Ver-
gegenwärtigung der Culturgeschichte und Biographie
bieten sie, aber wir haben es ausdrücklich mit »Art sor
Schools« zu thun! Glaubt auch nur ein Mensch, dass
die recht gute sarbige Wiedergabe von Mori So Sen's »Assen
und Pflaumenbaum« seitens irgend eines europäischen
Kindes als Kunst empsunden werden kann? Ich behaupte,
dass das Kind sich an so vielem stossen wird, dass ihm
hier auch durch Lehrermachtwort die Kunst nicht aus-
gehen will. Dazu gehört Reise und planmässige Bildung,
diese Kunst wendet sich nicht an die Naivetät.
Eben diese Gesellschast, deren Schassen, wenn man
meinen Aussührungen beipslichten sollte,kaum verständlich
ist, hat aber auch das Beste verössentlicht, was bis jetzt
aus diesem Felde entstanden ist: Strangs »Der Pslug«. Es
ist ein grosser Holzschnitt, vom Zeichner eigenhändig aus
neun Stöckegeschnitten, etwa L56 m hoch und L90 m lang.
Aus alle, so weit ich es weiss, die ihn bis jetzt gesehen,
übt er eine hervorragende Wirkung aus. Er ist gegen-
ständlich und culturgeschichtlich jedem Kind unserer
Kunstgeschichte wohl, nicht aber Kunst lehren kann, am
allerwenigsten Kinder; nimmt man diesen Standpunkt
ein, so ergeben sich aber Folgerungen, auf die die
genannte Ausstellung sowie die anderen Veranstaltungen
keine Rücksicht genommen haben.
Zunächst darf man in die Schule keine Photo-
graphien oder photomechanischen Wiedergaben hängen,
sondern nur Originale. Nur diese sind Kunstwerke, jene
Illustrationen. Nur diese können einen ästhetischen
Genuss erwecken, jene nie; sie können höchstens die
Erinnerung an einen früher gehabten Genuss erwecken
oder mittels der Associationskraft eine Vorstellung von
eventuellem Kunstgenuss geben, letzteres aber selbst-
verständlich nur Erwachsenen, denen eben diese Associa-
tion auf Grund früherer Erfahrung möglich ist, nicht
Kindern.
Ferner müssen diese Kunstwerke von selbst oder
gar nicht auf die Kinder wirken. Ich glaube, es ist ganz
salsch, hiebei auf die Vermittlung der Lehrer zu rechnen.
Man arbeitet dabei mit zu gefährlichen und unbekannten
Factoren. Es liegt vorderhand leider in der Natur der
Sache, dass nur wenige Lehrer ein Interesse an der Kunst
überhaupt gepflegt, von diesen Wenigen wieder nur ganz
Wenige es zu einem wirklichen Verständnisse gebracht
haben. Von diesen Wenigen jedoch mag kaum dem
Hundertsten die Gabe beschieden sein, sein Verständnis
anderen — nun gar noch Kindern — nutzbar zu machen.
Die Praxis würde aber nicht(mit diesem »Hundertsten«
rechnen, sondern mit allen Lehrern, und so ist es zweifel-
los, dass das Einschieben der Lehrer zwischen dem
Kunstwerk und dem Kind in 10.000 Fällen nur Unheil
anrichten wird, wo es in einem Gutes wirkt. Schon ein-
mal die Thatsache, dass der Herr Lehrer den Kindern eine
Stellungnahme zum Kunstwerk vorschreiben will, wird in
tausend Fällen einen Widerspruch reizen, der ohne sein
Dazwischentreten nicht in Erscheinung treten wird.
Aber die Hauptsache bleibt, dass wir dieses
Dazwischentreten gar nicht benöthigen.
Die erwachsene Generation hat sich im grossen
Ganzen zu einer vornehmeren Kunstanschauung neuer-
dings durchkämpfen müssen. Eingepflanzt war uns ein
schlechter Geschmack, den wir überwinden mussten.
Jedoch ist er uns nicht gewaltsam aufgezwungen worden
durch die Lehrer oder sonstigen Erzieher unserer Jugend-
zeit, wir haben ihn von selbst und, ohne uns darüber klar
zu sein, aufgesogen. Wir alle haben damalige Kunst,
wenn auch nur in den Läden, in anderer Leute Häusern,
ganz beiläufig gesehen. Sie war schlecht. Aber so wie sie
war, haben wir sie, ohne zu fragen, als Kunst angenommen
und als wir in reiferen Jahren einmal thätig der Frage
»Was ist schön?« entgegentraten, da fanden wir in uns
nicht mehr das unbeschriebene Blatt, sondern den
Menschen, der ganz passiv ein Dogma als unfehlbar
aufgenommen, das er activ kaum aus dem Weg räumen
kann. Das wenige »beiläufig Anschauen« hat eine so
ungeheuere Wirkung ausgeübt.
Hängen wir unseren Kindern nur gute Originalwerke
in die Schule; das genügt. Wir brauchen ihnen nichts zu
erklären, wir brauchen sie nicht durch einen Wink daraus
hinzuleiten. Einsach dass sie solche Werke stets vor Augen
haben, sie selbstverständlich als Kunst ansehen, wird
ausreichen, um ihnen einen derartigen Kamps in späterer
Zeit, wie wir ihn haben durchmachen müssen, zu
ersparen. Leonore im Tasso trisst den Kern der Sache. Je
mehr wir eine Sache kennen, desto mehr gesällt sie uns;
was wir wirklich kennen, das finden wir schön.
Um nun noch einmal aus die genannten Ver-
anstaltungen zurückzukommen, — ersüllen sie eigentlich
den Zweck, den sie vorgeben? Ganz und gar nicht! Statt
des Brotes geben sie Steine, statt der Kunst setzen sie
Kunstgeschichte vor die Kinder. Selbst wenn es sich nicht
um photomechanische Reproductionen handelte, die über-
haupt nichts mit Geniessen zu thun haben, — selbst wenn
Originale zu haben wären, sollten diese Dürer, Botticelli,
Michelangelo, van Eyck etc. nicht ausgehängt werden,
denn sie kann doch kein Kind der Welt heute ohne-
weiters geniessen. Wenn aber nicht erklärt, erläutert
werden soll, wenn die Kinder nicht lernen, sondern
empfinden sollen, so ist die erste Bedingung, dass ihnen
nur lebendige, ohneweiters verständliche heutige Kunst
vorgesetzt werde. Die Hamburger Ausstellung brachte nur
Lehrmaterial. Neun Zehntel der Verösfentlichung der »Art
for Schools Association« ist ebensalls nur dies, und man
ist eigentlich ganz überrascht, wie die Gesellschast eigent-
lich zu dem Namen kommt. Auch wenn das Original und
nicht nur eine seelenlose Phototypie des Bildnisses der
Königin Elisabeth vorgesührt würde, wie kämen Kinder
dazu, einen Pulsschlag der Kunst unter diesem erklärungs-
bedürstigen Mantel von Cultur- und Weltgeschichte, der
ungewöhnlichen Tracht, der sremdartigen Ausfassung zu
verspüren! Besitzt dies oder das Cromwell-Bildnis über-
haupt als Kunst die leiseste Berechtigung, unseren Kindern
in Erinnerung gebracht zu werden? Eine Hilse zur Ver-
gegenwärtigung der Culturgeschichte und Biographie
bieten sie, aber wir haben es ausdrücklich mit »Art sor
Schools« zu thun! Glaubt auch nur ein Mensch, dass
die recht gute sarbige Wiedergabe von Mori So Sen's »Assen
und Pflaumenbaum« seitens irgend eines europäischen
Kindes als Kunst empsunden werden kann? Ich behaupte,
dass das Kind sich an so vielem stossen wird, dass ihm
hier auch durch Lehrermachtwort die Kunst nicht aus-
gehen will. Dazu gehört Reise und planmässige Bildung,
diese Kunst wendet sich nicht an die Naivetät.
Eben diese Gesellschast, deren Schassen, wenn man
meinen Aussührungen beipslichten sollte,kaum verständlich
ist, hat aber auch das Beste verössentlicht, was bis jetzt
aus diesem Felde entstanden ist: Strangs »Der Pslug«. Es
ist ein grosser Holzschnitt, vom Zeichner eigenhändig aus
neun Stöckegeschnitten, etwa L56 m hoch und L90 m lang.
Aus alle, so weit ich es weiss, die ihn bis jetzt gesehen,
übt er eine hervorragende Wirkung aus. Er ist gegen-
ständlich und culturgeschichtlich jedem Kind unserer