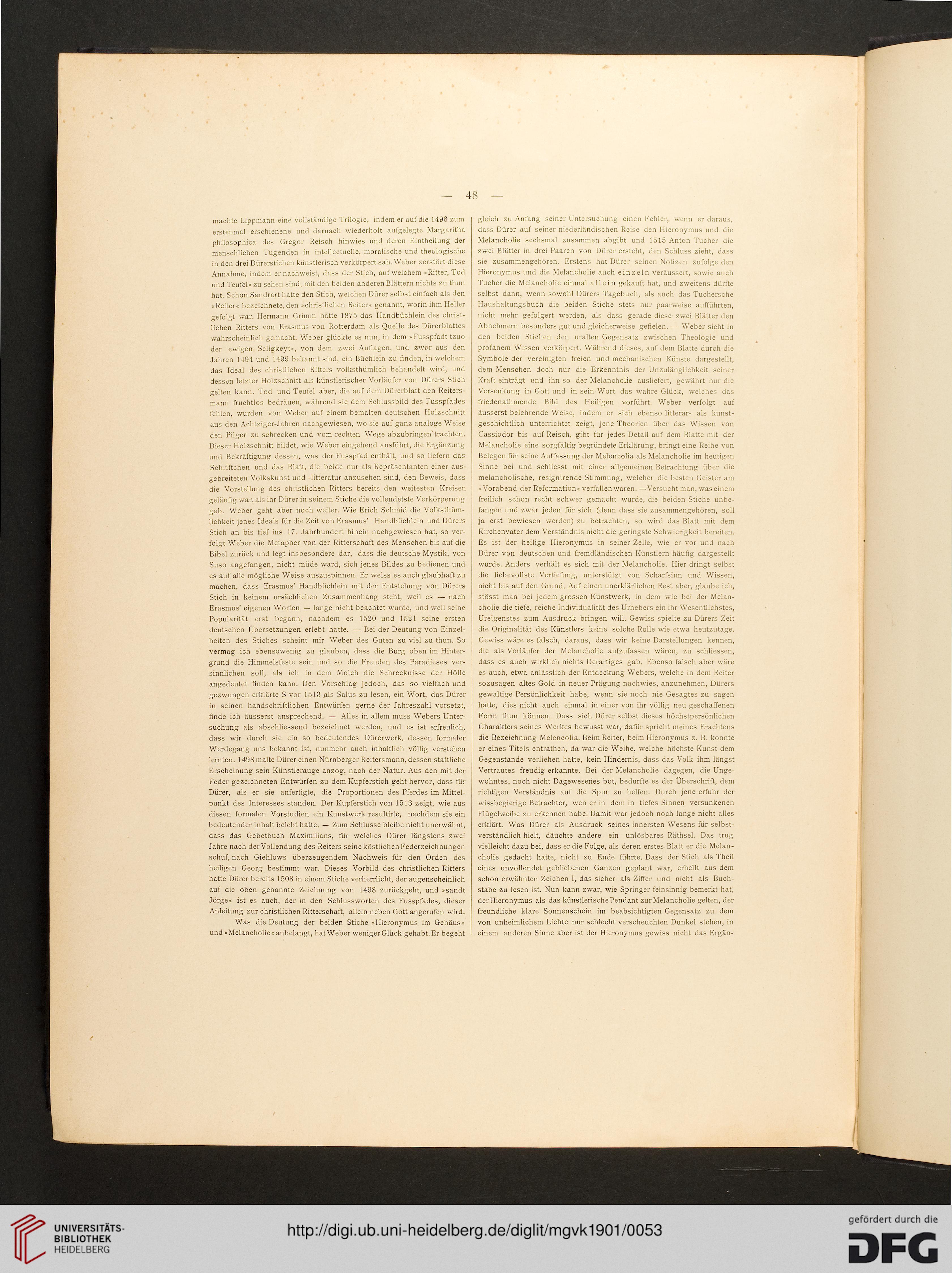— 48
machte Lippmann eine vollständige Trilogie, indem er aus die 1496 zum
erstenmal erschienene und darnach wiederholt ausgelegte Margaritha
philosophica des Gregor Reisch hinwies und deren Eintheilung der
menschlichen Tugenden in intellectuelle, moralische und theologische
in den drei Dürerstichen künstlerisch verkörpert sah. Weber zerstört diese
Annahme, indem er nachweist, dass der Stich, aus welchem »Ritter, Tod
und Teufel« zu sehen sind, mit den beiden anderen Blättern nichts zu thun
hat. Schon Sandrart hatte den Stich, welchen Dürer selbst einsach als den
»Reiter« bezeichnete, den »christlichen Reiter« genannt, worin ihm Heller
gefolgt war. Hermann Grimm hatte 1875 das Handbüchlein des christ-
lichen Ritters von Erasmus von Rotterdam als Quelle des Dürerblattes
wahrscheinlich gemacht. Weber glückte es nun, in dem »Fusspfadt tzuo
der ewigen Seligkeyt«, von dem zwei Auslagen, und zwar aus den
Jahren 1494 und 1499 bekannt sind, ein Büchlein zu finden, in welchem
das Ideal des christlichen Ritters volksthümlich behandelt wird, und
dessen letzter Holzschnitt als künstlerischer Vorläuser von Dürers Stich
gelten kann. Tod und Teusel aber, die aus dem Dürerblatt den Reiters-
mann sruchtlos bedräuen, während sie dem Schlussbild des Fusspsades
fehlen, wurden von Weber aus einem bemalten deutschen Holzschnitt
aus den Achtziger-Jahren nachgewiesen, wo sie auf ganz analoge Weise
den Pilger zu schrecken und vom rechten Wege abzubringen*trachten.
Dieser Holzschnitt bildet, wie Weber eingehend aussührt, die Ergänzung
und Bekrästigung dessen, was der Fusspsad enthält, und so liefern das
Schristchen und das Blatt, die beide nur als Repräsentanten einer aus-
gebreiteten Volkskunst und -litteratur anzusehen sind, den Beweis, dass
die Vorstellung des christlichen Ritters bereits den weitesten Kreisen
geläusig war, als ihr Dürer in seinem Stiche die vollendetste Verkörperung
gab. Weber geht aber noch weiter. Wie Erich Schmid die Volkstüm-
lichkeit jenes Ideals für die Zeit von Erasmus' Handbüchlein und Dürers
Stich an bis tief ins 17. Jahrhundert hinein nachgewiesen hat, so ver-
solgt Weber die Metapher von der Ritterschaft des Menschen bis auf die
Bibel zurück und legt insbesondere dar, dass die deutsche Mystik, von
Suso angesangen, nicht müde ward, sich jenes Bildes zu bedienen und
es aus alle mögliche Weise auszuspinnen. Er weiss es auch glaubhaft zu
machen, dass Erasmus' Handbüchlein mit der Entstehung von Dürers
Stich in keinem ursächlichen Zusammenhang steht, weil es — nach
Erasmus' eigenen Worten — lange nicht beachtet wurde, und weil seine
Popularität erst begann, nachdem es 1520 und 1521 seine ersten
deutschen Übersetzungen erlebt hatte. — Bei der Deutung von Einzel-
heiten des Stiches scheint mir Weber des Guten zu viel zu thun. So
vermag ich ebensowenig zu glauben, dass die Burg oben im Hinter-
grund die Himmelsseste sein und so die Freuden des Paradieses ver-
sinnlichen soll, als ich in dem Molch die Schrecknisse der Hölle
angedeutet finden kann. Den Vorschlag jedoch, das so vielfach und
gezwungen erklärte S vor 1513 .als Salus zu lesen, ein Wort, das Dürer
in seinen handschristlichen Entwürfen gerne der Jahreszahl vorsetzt,
finde ich äusserst ansprechend. — Alles in allem muss Webers Unter-
suchung als abschliessend bezeichnet werden, und es ist ersreulich,
dass wir durch sie ein so bedeutendes Dürerwerk, dessen sormaler
Werdegang uns bekannt ist, nunmehr auch inhaltlich völlig verstehen
lernten. 1498 malte Dürer einen Nürnberger Reitersmann, dessen stattliche
Erscheinung sein Künstlerauge anzog, nach der Natur. Aus den mit der
Feder gezeichneten Entwürfen zu dem Kupferstich geht hervor, dass für
Dürer, als er sie anfertigte, die Proportionen des Pferdes im Mittel-
punkt des Interesses standen. Der Kupferstich von 1513 zeigt, wie aus
diesen sormalen Vorstudien ein Kunstwerk resuhirte, nachdem sie ein
bedeutender Inhalt belebt hatte. — Zum Schlüsse bleibe nicht unerwähnt,
dass das Gebetbuch Maximilians, für welches Dürer längstens zwei
Jahre nach der Vollendung des Reiters seine köstlichen Federzeichnungen
schus, nach Giehlows überzeugendem Nachweis für den Orden des
heiligen Georg bestimmt war. Dieses Vorbild des christlichen Ritters
hatte Dürer bereits 1508 in einem Stiche verherrlicht, der augenscheinlich
aus die oben genannte Zeichnung von 1498 zurückgeht, und »sandt
Jörge« ist es auch, der in den Schlussworten des Fusspsades, dieser
Anleitung zur christlichen Ritterschast, allein neben Gott angerufen wird.
Was die Deutung der beiden Stiche »Hieronymus im Gehäus*
und »Melancholie« anbelangt, hat Weber weniger Glück gehabt. Er begeht
gleich zu Ansang seiner Untersuchung einen Kehler, wenn er daraus,
dass Dürer aus seiner niederländischen Reise den Hieronymus und die
Melancholie sechsmal zusammen abgibt und 1515 Anton Tucher die
zwei Blätter in drei Paaren von Dürer ersteht, den Schluss zieht, dass
sie zusammengehören. Erstens hat Dürer seinen Notizen zusolge den
Hieronymus und die Melancholie auch einzeln veräussert, sowie auch
Tucher die Melancholie einmal allein gekaust hat, und zweitens dürste
selbst dann, wenn sowohl Dürers Tagebuch, als auch das Tuchersche
Haushaltungsbuch die beiden Stiche stets nur paarweise aufsührten,
nicht mehr gesolgert werden, als dass gerade diese zwei Blätter den
Abnehmern besonders gut und gleicherweise gefielen. — Weber sieht in
den beiden Stichen den uralten Gegensatz zwischen Theologie und
profanem Wissen veikörpert. Während dieses, aus dem Blatte durch die
Symbole der vereinigten freien und mechanischen Künste dargestellt,
dem Menschen doch nur die Erkenntnis der Unzulänglichkeit seiner
Krast einträgt und ihn so der Melancholie ausliesert, gewährt nur die
Versenkung in Gott und in sein Wort das wahre Glück, welches das
fiiedenathmende Bild des Heiligen vorsührt. Weber versolgt auf
äusserst belehrende Weise, indem er sich ebenso litterar- als kunst-
geschichtlich unterrichtet zeigt, jene Theorien über das Wissen von
Cassiodor bis aus Reisch, gibt für jedes Detail aus dem Blatte mit der
Melancholie eine sorgsältig begründete Erklärung, bringt eine Reihe von
Belegen für seine Aussassung der Melencoiia als Melancholie im heutigen
Sinne bei und schliesst mit einer allgemeinen Betrachtung über die
melancholische, resignirende Stimmung, welcher die besten Geister am
»Vorabend der Reformation« verfallen waren. —Versucht man, was einem
freilich schon recht schwer gemacht wurde, die beiden Stiche unbe-
sangen und zwar jeden für sich (denn dass sie zusammengehören, soll
ja erst bewiesen werden) zu betrachten, so wird das Blatt mit dem
Kirchenvater dem Verständnis nicht die geringste Schwierigkeit bereiten.
Es ist der heilige Hieronymus in seiner Zelle, wie er vor und nach
Dürer von deutschen und sremdländischen Künstlern häufig dargestellt
wurde. Anders verhält es sich mit der Melancholie. Hier dringt selbst
die liebevollste Vertiesung, unterstützt von Scharssinn und Wissen,
nicht bis auf den Grund. Aus einen unerklärlichen Rest aber, glaube ich,
stösst man bei jedem grossen Kunstwerk, in dem wie bei der Melan-
cholie die tiefe, reiche Individualität des Urhebers ein ihr Wesentlichstes,
Ureigenstes zum Ausdruck bringen will. Gewiss spielte zu Dürers Zeit
die Originalität des Künstlers keine solche Rolle wie etwa heutzutage.
Gewiss wäre es salsch, daraus, dass wir keine Darstellungen kennen,
die als Vorläufer der Melancholie auszusassen wären, zu schliessen,
dass es auch wirklich nichts Derartiges gab. Ebenso falsch aber wäre
es auch, etwa anlässlich der Entdeckung Webers, welche in dem Reiter
sozusagen altes Gold in neuer Prägung nachwies, anzunehmen, Dürers
gewaltige Persönlichkeit habe, wenn sie noch nie Gesagtes zu sagen
hatte, dies nicht auch einmal in einer von ihr völlig neu geschasfenen
Form thun können. Dass sich Dürer selbst dieses höchstpersönlichen
Charakters seines Werkes bewusst war, dasür spricht meines Erachtens
die Bezeichnung Melencoiia. Beim Reiter, beim Hieronymus z. B. konnte
er eines Titels entrathen, da war die Weihe, welche höchste Kunst dem
Gegenstande verliehen hatte, kein Hindernis, dass das Volk ihm längst
Vertrautes freudig erkannte. Bei der Melancholie dagegen, die Unge-
wohntes, noch nicht Dagewesenes bot, bedurste es der Überschrist, dem
richtigen Verständnis auf die Spur zu helfen. Durch jene ersuhr der
wissbegierige Betrachter, wen er in dem in tiefes Sinnen versunkenen
Flügelweibe zu erkennen habe. Damit war jedoch noch lange nicht alles
erklärt. Was Dürer als Ausdruck seines innersten Wesens sür selbst-
verständlich hielt, däuchte andere ein unlösbares Räthsel. Das trug
vielleicht dazu bei, dass er die Folge, als deren erstes Blatt er die Melan-
cholie gedacht hatte, nicht zu Ende sührte. Dass der Stich als Theil
eines unvollendet gebliebenen Ganzen geplant war, erhellt aus dem
schon erwähnten Zeichen 1, das sicher als Zifser und nicht als Buch-
stabe zu lesen ist. Nun kann zwar, wie Springer feinsinnig bemerkt hat,
der Hieronymus als das künstlerischePendant zur Melancholie gelten, der
freundliche klare Sonnenschein im beabsichtigten Gegensatz zu dem
von unheimlichem Lichte nur schlecht verscheuchten Dunkel stehen, in
einem anderen Sinne aber ist der Hieronymus gewiss nicht das Ergän-
machte Lippmann eine vollständige Trilogie, indem er aus die 1496 zum
erstenmal erschienene und darnach wiederholt ausgelegte Margaritha
philosophica des Gregor Reisch hinwies und deren Eintheilung der
menschlichen Tugenden in intellectuelle, moralische und theologische
in den drei Dürerstichen künstlerisch verkörpert sah. Weber zerstört diese
Annahme, indem er nachweist, dass der Stich, aus welchem »Ritter, Tod
und Teufel« zu sehen sind, mit den beiden anderen Blättern nichts zu thun
hat. Schon Sandrart hatte den Stich, welchen Dürer selbst einsach als den
»Reiter« bezeichnete, den »christlichen Reiter« genannt, worin ihm Heller
gefolgt war. Hermann Grimm hatte 1875 das Handbüchlein des christ-
lichen Ritters von Erasmus von Rotterdam als Quelle des Dürerblattes
wahrscheinlich gemacht. Weber glückte es nun, in dem »Fusspfadt tzuo
der ewigen Seligkeyt«, von dem zwei Auslagen, und zwar aus den
Jahren 1494 und 1499 bekannt sind, ein Büchlein zu finden, in welchem
das Ideal des christlichen Ritters volksthümlich behandelt wird, und
dessen letzter Holzschnitt als künstlerischer Vorläuser von Dürers Stich
gelten kann. Tod und Teusel aber, die aus dem Dürerblatt den Reiters-
mann sruchtlos bedräuen, während sie dem Schlussbild des Fusspsades
fehlen, wurden von Weber aus einem bemalten deutschen Holzschnitt
aus den Achtziger-Jahren nachgewiesen, wo sie auf ganz analoge Weise
den Pilger zu schrecken und vom rechten Wege abzubringen*trachten.
Dieser Holzschnitt bildet, wie Weber eingehend aussührt, die Ergänzung
und Bekrästigung dessen, was der Fusspsad enthält, und so liefern das
Schristchen und das Blatt, die beide nur als Repräsentanten einer aus-
gebreiteten Volkskunst und -litteratur anzusehen sind, den Beweis, dass
die Vorstellung des christlichen Ritters bereits den weitesten Kreisen
geläusig war, als ihr Dürer in seinem Stiche die vollendetste Verkörperung
gab. Weber geht aber noch weiter. Wie Erich Schmid die Volkstüm-
lichkeit jenes Ideals für die Zeit von Erasmus' Handbüchlein und Dürers
Stich an bis tief ins 17. Jahrhundert hinein nachgewiesen hat, so ver-
solgt Weber die Metapher von der Ritterschaft des Menschen bis auf die
Bibel zurück und legt insbesondere dar, dass die deutsche Mystik, von
Suso angesangen, nicht müde ward, sich jenes Bildes zu bedienen und
es aus alle mögliche Weise auszuspinnen. Er weiss es auch glaubhaft zu
machen, dass Erasmus' Handbüchlein mit der Entstehung von Dürers
Stich in keinem ursächlichen Zusammenhang steht, weil es — nach
Erasmus' eigenen Worten — lange nicht beachtet wurde, und weil seine
Popularität erst begann, nachdem es 1520 und 1521 seine ersten
deutschen Übersetzungen erlebt hatte. — Bei der Deutung von Einzel-
heiten des Stiches scheint mir Weber des Guten zu viel zu thun. So
vermag ich ebensowenig zu glauben, dass die Burg oben im Hinter-
grund die Himmelsseste sein und so die Freuden des Paradieses ver-
sinnlichen soll, als ich in dem Molch die Schrecknisse der Hölle
angedeutet finden kann. Den Vorschlag jedoch, das so vielfach und
gezwungen erklärte S vor 1513 .als Salus zu lesen, ein Wort, das Dürer
in seinen handschristlichen Entwürfen gerne der Jahreszahl vorsetzt,
finde ich äusserst ansprechend. — Alles in allem muss Webers Unter-
suchung als abschliessend bezeichnet werden, und es ist ersreulich,
dass wir durch sie ein so bedeutendes Dürerwerk, dessen sormaler
Werdegang uns bekannt ist, nunmehr auch inhaltlich völlig verstehen
lernten. 1498 malte Dürer einen Nürnberger Reitersmann, dessen stattliche
Erscheinung sein Künstlerauge anzog, nach der Natur. Aus den mit der
Feder gezeichneten Entwürfen zu dem Kupferstich geht hervor, dass für
Dürer, als er sie anfertigte, die Proportionen des Pferdes im Mittel-
punkt des Interesses standen. Der Kupferstich von 1513 zeigt, wie aus
diesen sormalen Vorstudien ein Kunstwerk resuhirte, nachdem sie ein
bedeutender Inhalt belebt hatte. — Zum Schlüsse bleibe nicht unerwähnt,
dass das Gebetbuch Maximilians, für welches Dürer längstens zwei
Jahre nach der Vollendung des Reiters seine köstlichen Federzeichnungen
schus, nach Giehlows überzeugendem Nachweis für den Orden des
heiligen Georg bestimmt war. Dieses Vorbild des christlichen Ritters
hatte Dürer bereits 1508 in einem Stiche verherrlicht, der augenscheinlich
aus die oben genannte Zeichnung von 1498 zurückgeht, und »sandt
Jörge« ist es auch, der in den Schlussworten des Fusspsades, dieser
Anleitung zur christlichen Ritterschast, allein neben Gott angerufen wird.
Was die Deutung der beiden Stiche »Hieronymus im Gehäus*
und »Melancholie« anbelangt, hat Weber weniger Glück gehabt. Er begeht
gleich zu Ansang seiner Untersuchung einen Kehler, wenn er daraus,
dass Dürer aus seiner niederländischen Reise den Hieronymus und die
Melancholie sechsmal zusammen abgibt und 1515 Anton Tucher die
zwei Blätter in drei Paaren von Dürer ersteht, den Schluss zieht, dass
sie zusammengehören. Erstens hat Dürer seinen Notizen zusolge den
Hieronymus und die Melancholie auch einzeln veräussert, sowie auch
Tucher die Melancholie einmal allein gekaust hat, und zweitens dürste
selbst dann, wenn sowohl Dürers Tagebuch, als auch das Tuchersche
Haushaltungsbuch die beiden Stiche stets nur paarweise aufsührten,
nicht mehr gesolgert werden, als dass gerade diese zwei Blätter den
Abnehmern besonders gut und gleicherweise gefielen. — Weber sieht in
den beiden Stichen den uralten Gegensatz zwischen Theologie und
profanem Wissen veikörpert. Während dieses, aus dem Blatte durch die
Symbole der vereinigten freien und mechanischen Künste dargestellt,
dem Menschen doch nur die Erkenntnis der Unzulänglichkeit seiner
Krast einträgt und ihn so der Melancholie ausliesert, gewährt nur die
Versenkung in Gott und in sein Wort das wahre Glück, welches das
fiiedenathmende Bild des Heiligen vorsührt. Weber versolgt auf
äusserst belehrende Weise, indem er sich ebenso litterar- als kunst-
geschichtlich unterrichtet zeigt, jene Theorien über das Wissen von
Cassiodor bis aus Reisch, gibt für jedes Detail aus dem Blatte mit der
Melancholie eine sorgsältig begründete Erklärung, bringt eine Reihe von
Belegen für seine Aussassung der Melencoiia als Melancholie im heutigen
Sinne bei und schliesst mit einer allgemeinen Betrachtung über die
melancholische, resignirende Stimmung, welcher die besten Geister am
»Vorabend der Reformation« verfallen waren. —Versucht man, was einem
freilich schon recht schwer gemacht wurde, die beiden Stiche unbe-
sangen und zwar jeden für sich (denn dass sie zusammengehören, soll
ja erst bewiesen werden) zu betrachten, so wird das Blatt mit dem
Kirchenvater dem Verständnis nicht die geringste Schwierigkeit bereiten.
Es ist der heilige Hieronymus in seiner Zelle, wie er vor und nach
Dürer von deutschen und sremdländischen Künstlern häufig dargestellt
wurde. Anders verhält es sich mit der Melancholie. Hier dringt selbst
die liebevollste Vertiesung, unterstützt von Scharssinn und Wissen,
nicht bis auf den Grund. Aus einen unerklärlichen Rest aber, glaube ich,
stösst man bei jedem grossen Kunstwerk, in dem wie bei der Melan-
cholie die tiefe, reiche Individualität des Urhebers ein ihr Wesentlichstes,
Ureigenstes zum Ausdruck bringen will. Gewiss spielte zu Dürers Zeit
die Originalität des Künstlers keine solche Rolle wie etwa heutzutage.
Gewiss wäre es salsch, daraus, dass wir keine Darstellungen kennen,
die als Vorläufer der Melancholie auszusassen wären, zu schliessen,
dass es auch wirklich nichts Derartiges gab. Ebenso falsch aber wäre
es auch, etwa anlässlich der Entdeckung Webers, welche in dem Reiter
sozusagen altes Gold in neuer Prägung nachwies, anzunehmen, Dürers
gewaltige Persönlichkeit habe, wenn sie noch nie Gesagtes zu sagen
hatte, dies nicht auch einmal in einer von ihr völlig neu geschasfenen
Form thun können. Dass sich Dürer selbst dieses höchstpersönlichen
Charakters seines Werkes bewusst war, dasür spricht meines Erachtens
die Bezeichnung Melencoiia. Beim Reiter, beim Hieronymus z. B. konnte
er eines Titels entrathen, da war die Weihe, welche höchste Kunst dem
Gegenstande verliehen hatte, kein Hindernis, dass das Volk ihm längst
Vertrautes freudig erkannte. Bei der Melancholie dagegen, die Unge-
wohntes, noch nicht Dagewesenes bot, bedurste es der Überschrist, dem
richtigen Verständnis auf die Spur zu helfen. Durch jene ersuhr der
wissbegierige Betrachter, wen er in dem in tiefes Sinnen versunkenen
Flügelweibe zu erkennen habe. Damit war jedoch noch lange nicht alles
erklärt. Was Dürer als Ausdruck seines innersten Wesens sür selbst-
verständlich hielt, däuchte andere ein unlösbares Räthsel. Das trug
vielleicht dazu bei, dass er die Folge, als deren erstes Blatt er die Melan-
cholie gedacht hatte, nicht zu Ende sührte. Dass der Stich als Theil
eines unvollendet gebliebenen Ganzen geplant war, erhellt aus dem
schon erwähnten Zeichen 1, das sicher als Zifser und nicht als Buch-
stabe zu lesen ist. Nun kann zwar, wie Springer feinsinnig bemerkt hat,
der Hieronymus als das künstlerischePendant zur Melancholie gelten, der
freundliche klare Sonnenschein im beabsichtigten Gegensatz zu dem
von unheimlichem Lichte nur schlecht verscheuchten Dunkel stehen, in
einem anderen Sinne aber ist der Hieronymus gewiss nicht das Ergän-