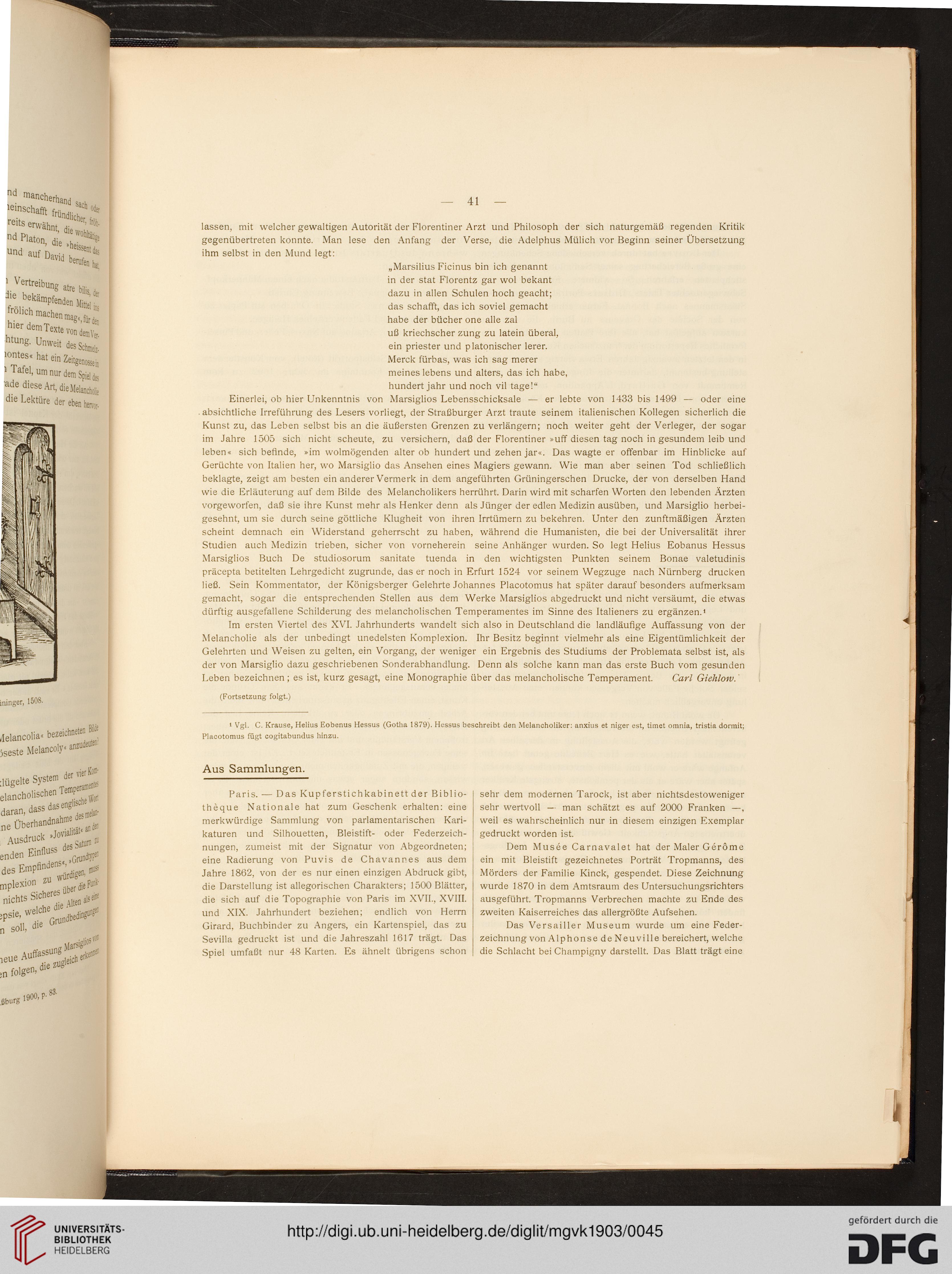lassen, mit welcher gewaltigen Autorität der Florentiner Arzt und Philosoph der sich naturgemäß regenden Kritik
gegenübertreten konnte. Man lese den Anfang der Verse, die Adelphus Mülich vor Beginn seiner Übersetzung
ihm selbst in den Mund legt:
„Marsilius Ficinus bin ich genannt
in der stat Florentz gar wol bekant
dazu in allen Schulen hoch geacht;
das schafst, das ich soviel gemacht
habe der bücher one alle zal
uß kriechscher zung zu latein liberal,
ein priester und platonischer lerer.
Merck fürbas, was ich sag merer
meines lebens und alters, das ich habe,
hundert jähr und noch vil tage!"
Einerlei, ob hier Unkenntnis von Marsiglios Lebensschicksale — er lebte von 1433 bis 1499 — oder eine
absichtliche Irreführung des Lesers vorliegt, der Straßburger Arzt traute seinem italienischen Kollegen sicherlich die
Kunst zu, das Leben selbst bis an die äußersten Grenzen zu verlängern; noch weiter geht der Verleger, der sogar
im Jahre 1505 sich nicht scheute, zu versichern, daß der Florentiner »uff diesen tag noch in gesundem leib und
leben« sich befinde, »im wolmögenden alter ob hundert und zehen jar«. Das wagte er offenbar im Hinblicke auf
Gerüchte von Italien her, wo Marsiglio das Ansehen eines Magiers gewann. Wie man aber seinen Tod schließlich
beklagte, zeigt am besten ein anderer Vermerk in dem angeführten Grüningerschen Drucke, der von derselben Hand
wie die Erläuterung auf dem Bilde des Melancholikers herrührt. Darin wird mit scharfen Worten den lebenden Ärzten
vorgeworfen, daß sie ihre Kunst mehr als Henker denn als Jünger der edlen Medizin ausüben, und Marsiglio herbei-
gesehnt, um sie durch seine göttliche Klugheit von ihren Irrtümern zu bekehren. Unter den zunftmäßigen Ärzten
scheint demnach ein Widerstand geherrscht zu haben, während die Humanisten, die bei der Universalität ihrer
Studien auch Medizin trieben, sicher von vorneherein seine Anhänger wurden. So legt Helius Eobanus Hessus
Marsiglios Buch De studiosorum sanitate tuenda in den wichtigsten Punkten seinem Bonae valetudinis
präcepta betitelten Lehrgedicht zugrunde, das er noch in Erfurt 1524 vor seinem Wegzuge nach Nürnberg drucken
ließ. Sein Kommentator, der Königsberger Gelehrte Johannes Placotomus hat später darauf besonders aufmerksam
gemacht, sogar die entsprechenden Stellen aus dem Werke Marsiglios abgedruckt und nicht versäumt, die etwas
dürftig ausgefallene Schilderung des melancholischen Temperamentes im Sinne des Italieners zu ergänzen.1
Im ersten Viertel des XVI. Jahrhunderts wandelt sich also in Deutschland die landläufige Auffassung von der
Melancholie als der unbedingt unedelsten Komplexion. Ihr Besitz beginnt vielmehr als eine Eigentümlichkeit der
Gelehrten und Weisen zu gelten, ein Vorgang, der weniger ein Ergebnis des Studiums der Problemata selbst ist, als
der von Marsiglio dazu geschriebenen Sonderabhandlung. Denn als solche kann man das erste Buch vom gesunden
Leben bezeichnen ; es ist, kurz gesagt, eine Monographie über das melancholische Temperament. Carl Giehlow.'
(Fortsetzung folgt.)
i Vgl. C. Krause, Helius Eobenus Hessus (Gotha 1879). Hessus beschreibt den Melancholiker: anxius et niger est, timet omnia, tristia dormit;
Placotomus fügt cogitabundus hinzu.
Aus Sammlungen.
Paris. — Das Kupferstichkabinett der Biblio-
theque Nationale hat zum Geschenk erhalten: eine
merkwürdige Sammlung von parlamentarischen Kari-
katuren und Silhouetten, Bleistift- oder Federzeich-
nungen, zumeist mit der Signatur von Abgeordneten;
eine Radierung von Puvis de Chavannes aus dem
Jahre 1862, von der es nur einen einzigen Abdruck gibt,
die Darstellung ist allegorischen Charakters; 1500 Blätter,
die sich auf die Topographie von Paris im XVII., XVIII.
und XIX. Jahrhundert beziehen; endlich von Herrn
Girard, Buchbinder zu Angers, ein Kartenspiel, das zu
Sevilla gedruckt ist und die Jahreszahl 1617 trägt. Das
Spiel umfaßt nur 48 Karten. Es ähnelt übrigens schon
sehr dem modernen Tarock, ist aber nichtsdestoweniger
sehr wertvoll — man schätzt es auf 2000 Franken —,
weil es wahrscheinlich nur in diesem einzigen Exemplar
gedruckt worden ist.
Dem Musee Carnavalet hat der Maler Gerome
ein mit Bleistift gezeichnetes Porträt Tropmanns, des
Mörders der Familie Kinck, gespendet. Diese Zeichnung
wurde 1870 in dem Amtsraum des Untersuchungsrichters
ausgeführt. Tropmanns Verbrechen machte zu Ende des
zweiten Kaiserreiches das allergrößte Aufsehen.
Das Versailler Museum wurde um eine Feder-
zeichnung von Alphonse de Neuville bereichert, welche
die Schlacht bei Champigny darstellt. Das Blatt trägt eine
gegenübertreten konnte. Man lese den Anfang der Verse, die Adelphus Mülich vor Beginn seiner Übersetzung
ihm selbst in den Mund legt:
„Marsilius Ficinus bin ich genannt
in der stat Florentz gar wol bekant
dazu in allen Schulen hoch geacht;
das schafst, das ich soviel gemacht
habe der bücher one alle zal
uß kriechscher zung zu latein liberal,
ein priester und platonischer lerer.
Merck fürbas, was ich sag merer
meines lebens und alters, das ich habe,
hundert jähr und noch vil tage!"
Einerlei, ob hier Unkenntnis von Marsiglios Lebensschicksale — er lebte von 1433 bis 1499 — oder eine
absichtliche Irreführung des Lesers vorliegt, der Straßburger Arzt traute seinem italienischen Kollegen sicherlich die
Kunst zu, das Leben selbst bis an die äußersten Grenzen zu verlängern; noch weiter geht der Verleger, der sogar
im Jahre 1505 sich nicht scheute, zu versichern, daß der Florentiner »uff diesen tag noch in gesundem leib und
leben« sich befinde, »im wolmögenden alter ob hundert und zehen jar«. Das wagte er offenbar im Hinblicke auf
Gerüchte von Italien her, wo Marsiglio das Ansehen eines Magiers gewann. Wie man aber seinen Tod schließlich
beklagte, zeigt am besten ein anderer Vermerk in dem angeführten Grüningerschen Drucke, der von derselben Hand
wie die Erläuterung auf dem Bilde des Melancholikers herrührt. Darin wird mit scharfen Worten den lebenden Ärzten
vorgeworfen, daß sie ihre Kunst mehr als Henker denn als Jünger der edlen Medizin ausüben, und Marsiglio herbei-
gesehnt, um sie durch seine göttliche Klugheit von ihren Irrtümern zu bekehren. Unter den zunftmäßigen Ärzten
scheint demnach ein Widerstand geherrscht zu haben, während die Humanisten, die bei der Universalität ihrer
Studien auch Medizin trieben, sicher von vorneherein seine Anhänger wurden. So legt Helius Eobanus Hessus
Marsiglios Buch De studiosorum sanitate tuenda in den wichtigsten Punkten seinem Bonae valetudinis
präcepta betitelten Lehrgedicht zugrunde, das er noch in Erfurt 1524 vor seinem Wegzuge nach Nürnberg drucken
ließ. Sein Kommentator, der Königsberger Gelehrte Johannes Placotomus hat später darauf besonders aufmerksam
gemacht, sogar die entsprechenden Stellen aus dem Werke Marsiglios abgedruckt und nicht versäumt, die etwas
dürftig ausgefallene Schilderung des melancholischen Temperamentes im Sinne des Italieners zu ergänzen.1
Im ersten Viertel des XVI. Jahrhunderts wandelt sich also in Deutschland die landläufige Auffassung von der
Melancholie als der unbedingt unedelsten Komplexion. Ihr Besitz beginnt vielmehr als eine Eigentümlichkeit der
Gelehrten und Weisen zu gelten, ein Vorgang, der weniger ein Ergebnis des Studiums der Problemata selbst ist, als
der von Marsiglio dazu geschriebenen Sonderabhandlung. Denn als solche kann man das erste Buch vom gesunden
Leben bezeichnen ; es ist, kurz gesagt, eine Monographie über das melancholische Temperament. Carl Giehlow.'
(Fortsetzung folgt.)
i Vgl. C. Krause, Helius Eobenus Hessus (Gotha 1879). Hessus beschreibt den Melancholiker: anxius et niger est, timet omnia, tristia dormit;
Placotomus fügt cogitabundus hinzu.
Aus Sammlungen.
Paris. — Das Kupferstichkabinett der Biblio-
theque Nationale hat zum Geschenk erhalten: eine
merkwürdige Sammlung von parlamentarischen Kari-
katuren und Silhouetten, Bleistift- oder Federzeich-
nungen, zumeist mit der Signatur von Abgeordneten;
eine Radierung von Puvis de Chavannes aus dem
Jahre 1862, von der es nur einen einzigen Abdruck gibt,
die Darstellung ist allegorischen Charakters; 1500 Blätter,
die sich auf die Topographie von Paris im XVII., XVIII.
und XIX. Jahrhundert beziehen; endlich von Herrn
Girard, Buchbinder zu Angers, ein Kartenspiel, das zu
Sevilla gedruckt ist und die Jahreszahl 1617 trägt. Das
Spiel umfaßt nur 48 Karten. Es ähnelt übrigens schon
sehr dem modernen Tarock, ist aber nichtsdestoweniger
sehr wertvoll — man schätzt es auf 2000 Franken —,
weil es wahrscheinlich nur in diesem einzigen Exemplar
gedruckt worden ist.
Dem Musee Carnavalet hat der Maler Gerome
ein mit Bleistift gezeichnetes Porträt Tropmanns, des
Mörders der Familie Kinck, gespendet. Diese Zeichnung
wurde 1870 in dem Amtsraum des Untersuchungsrichters
ausgeführt. Tropmanns Verbrechen machte zu Ende des
zweiten Kaiserreiches das allergrößte Aufsehen.
Das Versailler Museum wurde um eine Feder-
zeichnung von Alphonse de Neuville bereichert, welche
die Schlacht bei Champigny darstellt. Das Blatt trägt eine