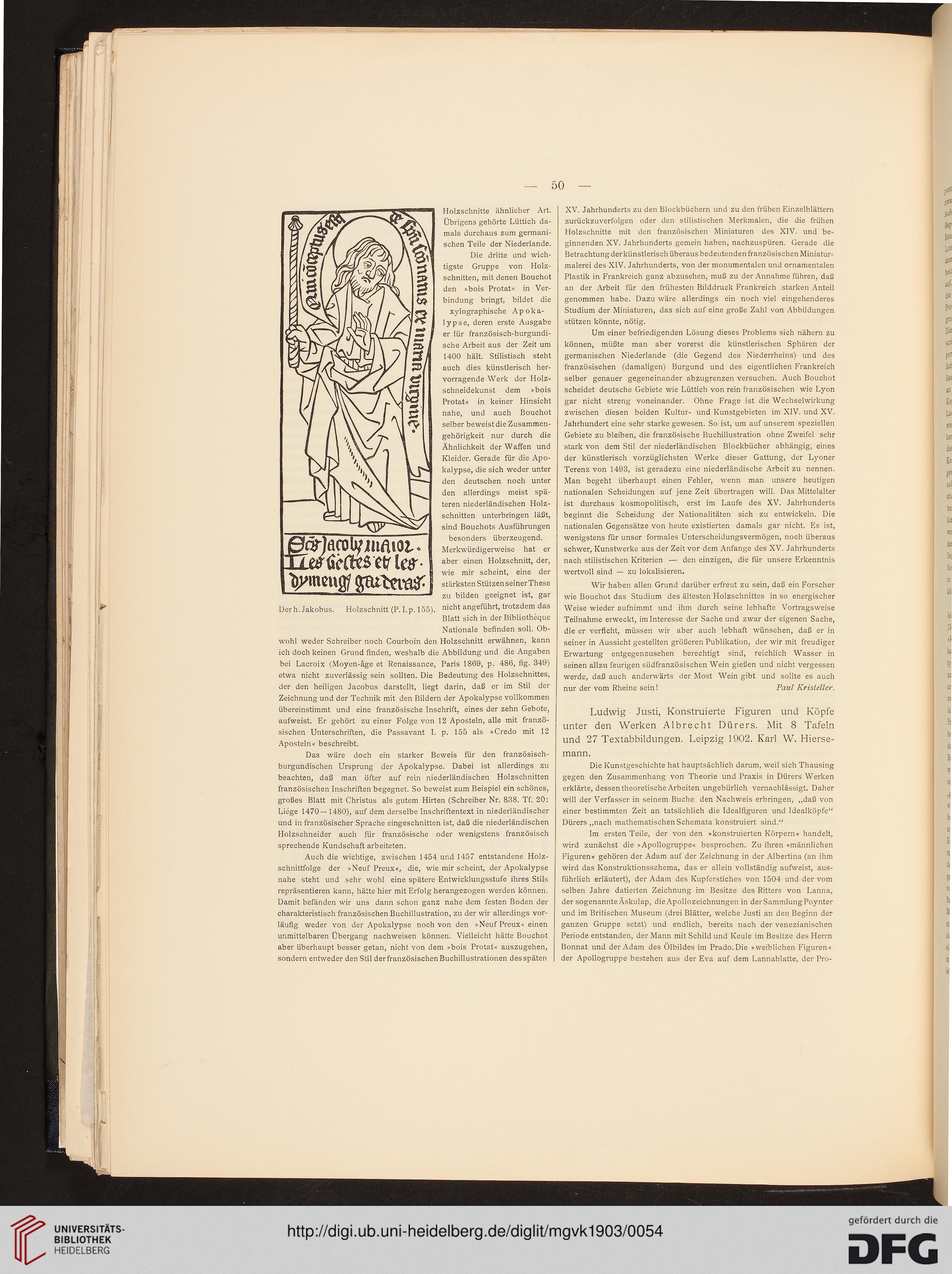— 50 —
löt tieste* etr \t&-
Holzschnitte ähnlicher Art.
Übrigens gehörte Lüttich da-
mals durchaus zum germani-
schen Teile der Niederlande.
Die dritte und wich-
tigste Gruppe von Holz-
schnitten, mit denen Bouchot
den »bois Protat« in Ver-
bindung bringt, bildet die
xylographische Apoka-
lypse, deren erste Ausgabe
er sür französisch-burgundi-
sche Arbeit aus der Zeit um
1400 hält. Stilistisch steht
auch dies künstlerisch her-
vorragende Werk der Holz-
schneidekunst dem »bois
Protat« in keiner Hinsicht
nahe, und auch Bouchot
selber beweist die Zusammen-
gehörigkeit nur durch die
Ähnlichkeit der Wafsen und
Kleider. Gerade für die Apo-
kalypse, die sich weder unter
den deutschen noch unter
den allerdings meist spä-
teren niederländischen Holz-
schnitten unterbringen läßt,
sind Bouchots Ausführungen
besonders überzeugend.
Merkwürdigerweise hat er
aber einen Holzschnitt, der,
wie mir scheint, eine der
stärksten Stützen seiner These
zu bilden geeignet ist, gar
Holzschnitt (P. I. p. 155). nicht angeführt, trotzdem das
Blatt sich in der Bibliotheque
Nationale befinden soll. Ob-
wohl weder Schreiber noch Courboin den Holzschnitt erwähnen, kann
ich doch keinen Grund sinden, weshalb die Abbildung und die Angaben
bei Lacroix (Moyen-äge et Renaissance, Paris 1869, p. 486, fig. 349)
etwa nicht zuverlässig sein sollten. Die Bedeutung des Holzschnittes,
der den heiligen Jacobus darstellt, liegt darin, daß er im Stil der
Zeichnung und der Technik mit den Bildern der Apokalypse vollkommen
übereinstimmt und eine französische Inschrist, eines der zehn Gebote,
aufweist. Er gehört zu einer Folge von 12 Aposteln, alle mit franzö-
sischen Unterschriften, die Passavant I. p. 155 als >Credo mit 12
Aposteln« beschreibt.
Das wäre doch ein starker Beweis für den französisch-
burgundischen Ursprung der Apokalypse. Dabei ist allerdings zu
beachten, daß man öfter auf rein niederländischen Holzschnitten
französischen Inschriften begegnet. So beweist zum Beispiel ein schönes,
großes Blatt mit Christus als gutem Hirten (Schreiber Nr. 838. Tf. 20:
Liege 1470— 1480), auf dem derselbe Inschriftentext in niederländischer
und in französischer Sprache eingeschnitten ist, daß die niederländischen
Holzschneider auch für französische oder wenigstens französisch
sprechende Kundschaft arbeiteten.
Auch die wichtige, zwischen 1454 und 1457 entstandene Holz-
schnittfolge der »Neuf Preux«, die, wie mir scheint, der Apokalypse
nahe steht und sehr wohl eine spätere Entwicklungsstufe ihres Stils
repräsentieren kann, hätte hier mit Erfolg herangezogen werden können.
Damit befänden wir uns dann schon ganz nahe dem festen Boden der
charakteristisch französischen Buchillustration, zu der wir allerdings vor-
läufig weder von der Apokalypse noch von den »Neus Preux« einen
unmittelbaren Übergang nachweisen können. Vielleicht hätte Bouchot
aber überhaupt besser getan, nicht von dem »bois Protat« auszugehen,
sondern entweder den Stil der französischen Buchillustrationen des späten
Der h. Jakobus.
XV. Jahrhunderts zu den Blockbüchern und zu den srühen Einzelblättern
zurückzuversolgen oder den stilistischen Merkmalen, die die srühen
Holzschnitte mit den französischen Miniaturen des XIV. und be-
ginnenden XV. Jahrhunderts gemein haben, nachzuspüren. Gerade die
Betrachtung der künstlerisch überaus bedeutenden französischen Miniatur-
malerei des XIV. Jahrhunderts, von der monumentalen und ornamentalen
Plastik in Frankreich ganz abzusehen, muß zu der Annahme führen, daß
an der Arbeit sür den frühesten Bilddruck Frankreich starken Anteil
genommen habe. Dazu wäre allerdings ein noch viel eingehenderes
Studium der Miniaturen, das sich auf eine große Zahl von Abbildungen
stützen könnte, nötig.
Um einer befriedigenden Lösung dieses Problems sich nähern zu
können, müßte man aber vorerst die künstlerischen Sphären der
germanischen Niederlande (die Gegend des Niederrheins) und des
französischen (damaligen) Burgund und des eigentlichen Frankreich
selber genauer gegeneinander abzugrenzen versuchen. Auch Bouchot
scheidet deutsche Gebiete wie Lüttich von rein französischen wie Lyon
gar nicht streng voneinander. Ohne Frage ist die Wechselwirkung
zwischen diesen beiden Kultur- und Kunstgebieten im XIV. und XV.
Jahrhundert eine sehr starke gewesen. So ist, um auf unserem speziellen
Gebiete zu bleiben, die französische Buchillustration ohne Zweifel sehr
stark von dem Stil der niederländischen Blockbücher abhängig, eines
der künstlerisch vorzüglichsten Werke dieser Gattung, der Lyoner
Terenz von 1493, ist geradezu eine niederländische Arbeit zu nennen.
Man begeht überhaupt einen Fehler, wenn man unsere heutigen
nationalen Scheidungen auf jene Zeit übertragen will. Das Mittelalter
ist durchaus kosmopolitisch, erst im Laufe des XV. Jahrhunderts
beginnt die Scheidung der Nationalitäten sich zu entwickeln. Die
nationalen Gegensätze von heute existierten damals gar nicht. Es ist,
wenigstens für unser formales Unterscheidungsvermögen, noch überaus
schwer, Kunstwerke aus der Zeit vor dem Anfange des XV. Jahrhunderts
nach stilistischen Kriterien — den einzigen, die für unsere Erkenntnis
wertvoll sind — zu lokalisieren.
Wir haben allen Grund darüber erfreut zu sein, daß ein Forscher
wie Bouchot das Studium des ältesten Holzschnittes in so energischer
Weise wieder ausnimmt und ihm durch seine lebhaste Vortragsweise
Teilnahme erweckt, im Interesse der Sache und zwar der eigenen Sache,
die er verficht, müssen wir aber auch lebhaft wünschen, daß er in
seiner in Aussicht gestellten größeren Publikation, der wir mit freudiger
Erwartung entgegenzusehen berechtigt sind, reichlich Wasser in
seinen allzu feurigen südfranzösischen Wein gießen und nicht vergessen
werde, daß auch anderwärts der Most Wein gibt und sollte es auch
nur der vom Rheine sein! Paul Krisleller.
Ludwig Justi, Konstruierte Figuren und Köpfe
unter den Werken Albrecht Dürers. Mit 8 Tafeln
und 27 Textabbildungen. Leipzig 1902. Karl W. Hierse-
mann.
Die Kunstgeschichte hat hauptsächlich darum, weil sich Thausing
gegen den Zusammenhang von Theorie und Praxis in Dürers Werken
erklärte, dessen theoretische Arbeiten ungebürlich vernachlässigt. Daher
will der Verfasser in seinem Buche den Nachweis erbringen, „daß von
einer bestimmten Zeit an tatsächlich die Idealfiguren und Idealköpfe"
Dürers „nach mathematischenSchemata konstruiert sind."
Im ersten Teile, der von den »konstruierten Körpern« handelt,
wird zunächst die »Apollogruppe« besprochen. Zu ihren »männlichen
Figuren« gehören der Adam aus der Zeichnung in der Albertina (an ihm
wird das Konstruktionsschema, das er allein vollständig aufweist, aus-
führlich erläutert), der Adam des Kupferstiches von 1504 und der vom
selben Jahre datierten Zeichnung im Besitze des Ritters von Lanna,
der sogenannte Äskulap, die Apollozcichnungen in der Sammlung Poynter
und im Britischen Museum (drei Blätter, welche Justi an den Beginn der
ganzen Gruppe setzt) und endlich, bereits nach der venezianischen
Periode entstanden, der Mann mit Schild und Keule im Besitze des Herrn
Bonnat und der Adam des Ölbildes im Prado.Die »weiblichen Figuren«
der Apollogruppe bestehen aus der Eva auf dem Lannablatte, der Pro-
löt tieste* etr \t&-
Holzschnitte ähnlicher Art.
Übrigens gehörte Lüttich da-
mals durchaus zum germani-
schen Teile der Niederlande.
Die dritte und wich-
tigste Gruppe von Holz-
schnitten, mit denen Bouchot
den »bois Protat« in Ver-
bindung bringt, bildet die
xylographische Apoka-
lypse, deren erste Ausgabe
er sür französisch-burgundi-
sche Arbeit aus der Zeit um
1400 hält. Stilistisch steht
auch dies künstlerisch her-
vorragende Werk der Holz-
schneidekunst dem »bois
Protat« in keiner Hinsicht
nahe, und auch Bouchot
selber beweist die Zusammen-
gehörigkeit nur durch die
Ähnlichkeit der Wafsen und
Kleider. Gerade für die Apo-
kalypse, die sich weder unter
den deutschen noch unter
den allerdings meist spä-
teren niederländischen Holz-
schnitten unterbringen läßt,
sind Bouchots Ausführungen
besonders überzeugend.
Merkwürdigerweise hat er
aber einen Holzschnitt, der,
wie mir scheint, eine der
stärksten Stützen seiner These
zu bilden geeignet ist, gar
Holzschnitt (P. I. p. 155). nicht angeführt, trotzdem das
Blatt sich in der Bibliotheque
Nationale befinden soll. Ob-
wohl weder Schreiber noch Courboin den Holzschnitt erwähnen, kann
ich doch keinen Grund sinden, weshalb die Abbildung und die Angaben
bei Lacroix (Moyen-äge et Renaissance, Paris 1869, p. 486, fig. 349)
etwa nicht zuverlässig sein sollten. Die Bedeutung des Holzschnittes,
der den heiligen Jacobus darstellt, liegt darin, daß er im Stil der
Zeichnung und der Technik mit den Bildern der Apokalypse vollkommen
übereinstimmt und eine französische Inschrist, eines der zehn Gebote,
aufweist. Er gehört zu einer Folge von 12 Aposteln, alle mit franzö-
sischen Unterschriften, die Passavant I. p. 155 als >Credo mit 12
Aposteln« beschreibt.
Das wäre doch ein starker Beweis für den französisch-
burgundischen Ursprung der Apokalypse. Dabei ist allerdings zu
beachten, daß man öfter auf rein niederländischen Holzschnitten
französischen Inschriften begegnet. So beweist zum Beispiel ein schönes,
großes Blatt mit Christus als gutem Hirten (Schreiber Nr. 838. Tf. 20:
Liege 1470— 1480), auf dem derselbe Inschriftentext in niederländischer
und in französischer Sprache eingeschnitten ist, daß die niederländischen
Holzschneider auch für französische oder wenigstens französisch
sprechende Kundschaft arbeiteten.
Auch die wichtige, zwischen 1454 und 1457 entstandene Holz-
schnittfolge der »Neuf Preux«, die, wie mir scheint, der Apokalypse
nahe steht und sehr wohl eine spätere Entwicklungsstufe ihres Stils
repräsentieren kann, hätte hier mit Erfolg herangezogen werden können.
Damit befänden wir uns dann schon ganz nahe dem festen Boden der
charakteristisch französischen Buchillustration, zu der wir allerdings vor-
läufig weder von der Apokalypse noch von den »Neus Preux« einen
unmittelbaren Übergang nachweisen können. Vielleicht hätte Bouchot
aber überhaupt besser getan, nicht von dem »bois Protat« auszugehen,
sondern entweder den Stil der französischen Buchillustrationen des späten
Der h. Jakobus.
XV. Jahrhunderts zu den Blockbüchern und zu den srühen Einzelblättern
zurückzuversolgen oder den stilistischen Merkmalen, die die srühen
Holzschnitte mit den französischen Miniaturen des XIV. und be-
ginnenden XV. Jahrhunderts gemein haben, nachzuspüren. Gerade die
Betrachtung der künstlerisch überaus bedeutenden französischen Miniatur-
malerei des XIV. Jahrhunderts, von der monumentalen und ornamentalen
Plastik in Frankreich ganz abzusehen, muß zu der Annahme führen, daß
an der Arbeit sür den frühesten Bilddruck Frankreich starken Anteil
genommen habe. Dazu wäre allerdings ein noch viel eingehenderes
Studium der Miniaturen, das sich auf eine große Zahl von Abbildungen
stützen könnte, nötig.
Um einer befriedigenden Lösung dieses Problems sich nähern zu
können, müßte man aber vorerst die künstlerischen Sphären der
germanischen Niederlande (die Gegend des Niederrheins) und des
französischen (damaligen) Burgund und des eigentlichen Frankreich
selber genauer gegeneinander abzugrenzen versuchen. Auch Bouchot
scheidet deutsche Gebiete wie Lüttich von rein französischen wie Lyon
gar nicht streng voneinander. Ohne Frage ist die Wechselwirkung
zwischen diesen beiden Kultur- und Kunstgebieten im XIV. und XV.
Jahrhundert eine sehr starke gewesen. So ist, um auf unserem speziellen
Gebiete zu bleiben, die französische Buchillustration ohne Zweifel sehr
stark von dem Stil der niederländischen Blockbücher abhängig, eines
der künstlerisch vorzüglichsten Werke dieser Gattung, der Lyoner
Terenz von 1493, ist geradezu eine niederländische Arbeit zu nennen.
Man begeht überhaupt einen Fehler, wenn man unsere heutigen
nationalen Scheidungen auf jene Zeit übertragen will. Das Mittelalter
ist durchaus kosmopolitisch, erst im Laufe des XV. Jahrhunderts
beginnt die Scheidung der Nationalitäten sich zu entwickeln. Die
nationalen Gegensätze von heute existierten damals gar nicht. Es ist,
wenigstens für unser formales Unterscheidungsvermögen, noch überaus
schwer, Kunstwerke aus der Zeit vor dem Anfange des XV. Jahrhunderts
nach stilistischen Kriterien — den einzigen, die für unsere Erkenntnis
wertvoll sind — zu lokalisieren.
Wir haben allen Grund darüber erfreut zu sein, daß ein Forscher
wie Bouchot das Studium des ältesten Holzschnittes in so energischer
Weise wieder ausnimmt und ihm durch seine lebhaste Vortragsweise
Teilnahme erweckt, im Interesse der Sache und zwar der eigenen Sache,
die er verficht, müssen wir aber auch lebhaft wünschen, daß er in
seiner in Aussicht gestellten größeren Publikation, der wir mit freudiger
Erwartung entgegenzusehen berechtigt sind, reichlich Wasser in
seinen allzu feurigen südfranzösischen Wein gießen und nicht vergessen
werde, daß auch anderwärts der Most Wein gibt und sollte es auch
nur der vom Rheine sein! Paul Krisleller.
Ludwig Justi, Konstruierte Figuren und Köpfe
unter den Werken Albrecht Dürers. Mit 8 Tafeln
und 27 Textabbildungen. Leipzig 1902. Karl W. Hierse-
mann.
Die Kunstgeschichte hat hauptsächlich darum, weil sich Thausing
gegen den Zusammenhang von Theorie und Praxis in Dürers Werken
erklärte, dessen theoretische Arbeiten ungebürlich vernachlässigt. Daher
will der Verfasser in seinem Buche den Nachweis erbringen, „daß von
einer bestimmten Zeit an tatsächlich die Idealfiguren und Idealköpfe"
Dürers „nach mathematischenSchemata konstruiert sind."
Im ersten Teile, der von den »konstruierten Körpern« handelt,
wird zunächst die »Apollogruppe« besprochen. Zu ihren »männlichen
Figuren« gehören der Adam aus der Zeichnung in der Albertina (an ihm
wird das Konstruktionsschema, das er allein vollständig aufweist, aus-
führlich erläutert), der Adam des Kupferstiches von 1504 und der vom
selben Jahre datierten Zeichnung im Besitze des Ritters von Lanna,
der sogenannte Äskulap, die Apollozcichnungen in der Sammlung Poynter
und im Britischen Museum (drei Blätter, welche Justi an den Beginn der
ganzen Gruppe setzt) und endlich, bereits nach der venezianischen
Periode entstanden, der Mann mit Schild und Keule im Besitze des Herrn
Bonnat und der Adam des Ölbildes im Prado.Die »weiblichen Figuren«
der Apollogruppe bestehen aus der Eva auf dem Lannablatte, der Pro-