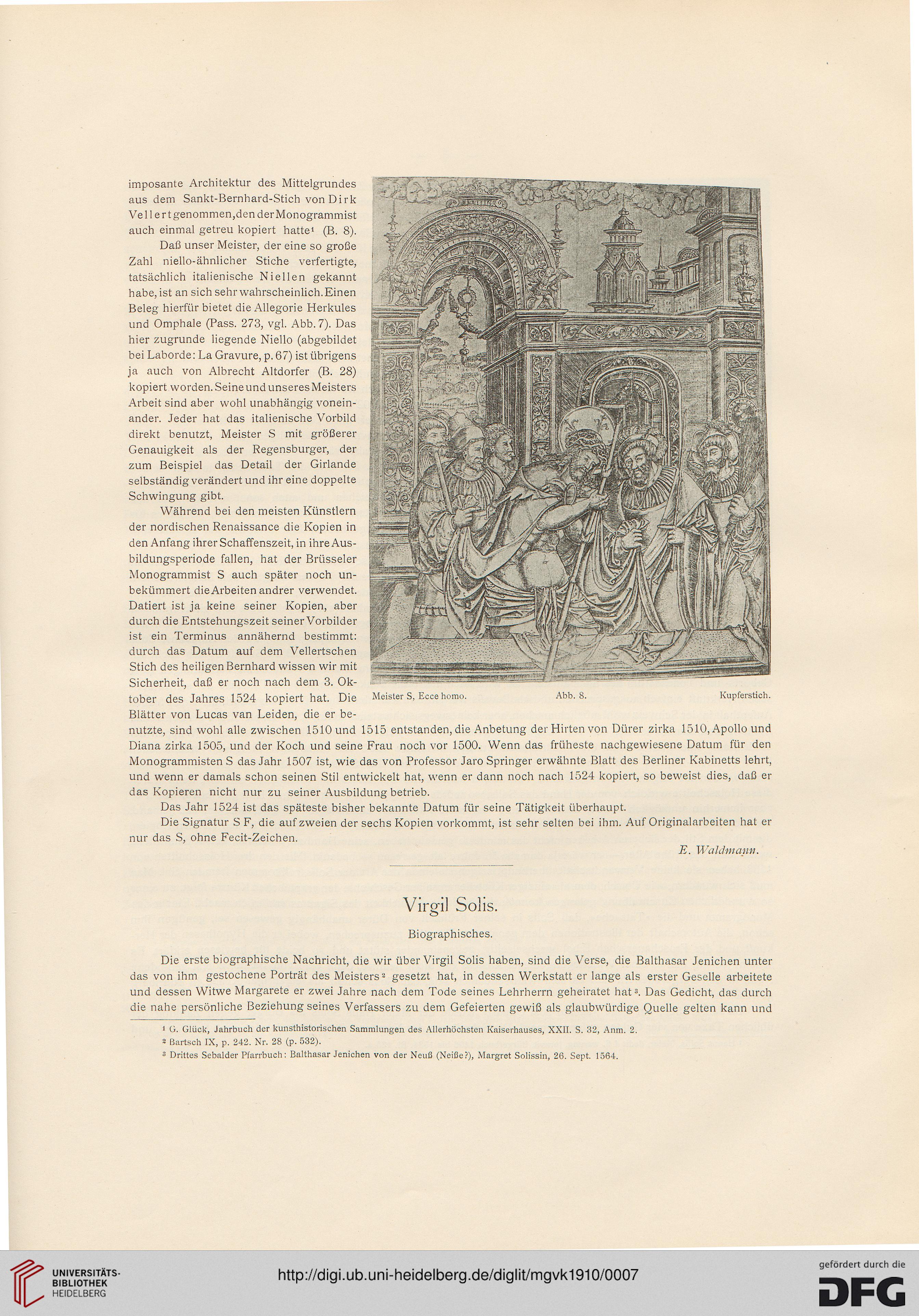imposante Architektur des Mittelgrundes
aus dem Sankt-Bernhard-Stich von Dirk
Vellertgenommen,denderMonogrammist
auch einmal getreu kopiert hatte1 (B. 8).
Daß unser Meister, der eine so große
Zahl niello-ähnlicher Stiche verfertigte,
tatsächlich italienische Niellen gekannt
habe, ist an sich sehr wahrscheinlich. Einen
Beleg hierfür bietet die Allegorie Herkules
und Omphale (Pass. 273, vgl. Abb. 7). Das
hier zugrunde liegende Niello (abgebildet
bei Laborde: La Gravüre, p. 67) ist übrigens
ja auch von Albrecht Altdorfer (B. 28)
kopiert worden. Seine und unseres Meisters
Arbeit sind aber wohl unabhängig vonein-
ander. Jeder hat das italienische Vorbild
direkt benutzt, Meister S mit größerer
Genauigkeit als der Regensburger, der
zum Beispiel das Detail der Girlande
selbständig verändert und ihr eine doppelte
Schwingung gibt.
Während bei den meisten Künstlern
der nordischen Renaissance die Kopien in
den Anfang ihrer Schaffenszeit, in ihre Aus-
bildungsperiode fallen, hat der Brüsseler
Monogrammist S auch später noch un-
bekümmert dieArbeiten andrer verwendet.
Datiert ist ja keine seiner Kopien, aber
durch die Entstehungszeit seiner Vorbilder
ist ein Terminus annähernd bestimmt:
durch das Datum auf dem Vellertschen
Stich des heiligen Bernhard wissen wir mit
Sicherheit, daß er noch nach dem 3. Ok-
tober des Jahres 1524 kopiert hat. Die
Blätter von Lucas van Leiden, die er be-
nutzte, sind wohl alle zwischen 1510 und 1515 entstanden, die Anbetung der Hirten von Dürer zirka 1510, Apollo und
Diana zirka 1505, und der Koch und seine Frau noch vor 1500. Wenn das früheste nachgewiesene Datum für den
Monogrammisten S das Jahr 1507 ist, wie das von Professor Jaro Springer erwähnte Blatt des Berliner Kabinetts lehrt,
und wenn er damals schon seinen Stil entwickelt hat, wenn er dann noch nach 1524 kopiert, so beweist dies, daß er
das Kopieren nicht nur zu seiner Ausbildung betrieb.
Das Jahr 1524 ist das späteste bisher bekannte Datum für seine Tätigkeit überhaupt.
Die Signatur S F, die auf zweien der sechs Kopien vorkommt, ist sehr selten bei ihm. Auf Originalarbeiten hat er
nur das S, ohne Fecit-Zeichen.
E. Waldmann.
Meister S, Ecce homo.
Abb. 8.
Kupferstich.
Virgil Solis.
Biographisches.
Die erste biographische Nachricht, die wir über Virgil Solis haben, sind die Verse, die Balthasar Jenichen unter
das von ihm gestochene Porträt des Meisters2 gesetzt hat, in dessen Werkstatt er lange als erster Geselle arbeitete
und dessen Witwe Margarete er zwei Jahre nach dem Tode seines Lehrherrn geheiratet hat3. Das Gedicht, das durch
die nahe persönliche Beziehung seines Verfassers zu dem Gefeierten gewiß als glaubwürdige Quelle gelten kann und
1 ü. Glück, Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, XXII. S. 32, Anm. 2.
2 Bartsch IX, p. 242. Nr. 28 (p. 532).
3 Drittes Sebalder Pfarrbuch: Balthasar Jenichen von der Neuß (Neiße?), Margret Solissin, 26. Sept. 1564.
aus dem Sankt-Bernhard-Stich von Dirk
Vellertgenommen,denderMonogrammist
auch einmal getreu kopiert hatte1 (B. 8).
Daß unser Meister, der eine so große
Zahl niello-ähnlicher Stiche verfertigte,
tatsächlich italienische Niellen gekannt
habe, ist an sich sehr wahrscheinlich. Einen
Beleg hierfür bietet die Allegorie Herkules
und Omphale (Pass. 273, vgl. Abb. 7). Das
hier zugrunde liegende Niello (abgebildet
bei Laborde: La Gravüre, p. 67) ist übrigens
ja auch von Albrecht Altdorfer (B. 28)
kopiert worden. Seine und unseres Meisters
Arbeit sind aber wohl unabhängig vonein-
ander. Jeder hat das italienische Vorbild
direkt benutzt, Meister S mit größerer
Genauigkeit als der Regensburger, der
zum Beispiel das Detail der Girlande
selbständig verändert und ihr eine doppelte
Schwingung gibt.
Während bei den meisten Künstlern
der nordischen Renaissance die Kopien in
den Anfang ihrer Schaffenszeit, in ihre Aus-
bildungsperiode fallen, hat der Brüsseler
Monogrammist S auch später noch un-
bekümmert dieArbeiten andrer verwendet.
Datiert ist ja keine seiner Kopien, aber
durch die Entstehungszeit seiner Vorbilder
ist ein Terminus annähernd bestimmt:
durch das Datum auf dem Vellertschen
Stich des heiligen Bernhard wissen wir mit
Sicherheit, daß er noch nach dem 3. Ok-
tober des Jahres 1524 kopiert hat. Die
Blätter von Lucas van Leiden, die er be-
nutzte, sind wohl alle zwischen 1510 und 1515 entstanden, die Anbetung der Hirten von Dürer zirka 1510, Apollo und
Diana zirka 1505, und der Koch und seine Frau noch vor 1500. Wenn das früheste nachgewiesene Datum für den
Monogrammisten S das Jahr 1507 ist, wie das von Professor Jaro Springer erwähnte Blatt des Berliner Kabinetts lehrt,
und wenn er damals schon seinen Stil entwickelt hat, wenn er dann noch nach 1524 kopiert, so beweist dies, daß er
das Kopieren nicht nur zu seiner Ausbildung betrieb.
Das Jahr 1524 ist das späteste bisher bekannte Datum für seine Tätigkeit überhaupt.
Die Signatur S F, die auf zweien der sechs Kopien vorkommt, ist sehr selten bei ihm. Auf Originalarbeiten hat er
nur das S, ohne Fecit-Zeichen.
E. Waldmann.
Meister S, Ecce homo.
Abb. 8.
Kupferstich.
Virgil Solis.
Biographisches.
Die erste biographische Nachricht, die wir über Virgil Solis haben, sind die Verse, die Balthasar Jenichen unter
das von ihm gestochene Porträt des Meisters2 gesetzt hat, in dessen Werkstatt er lange als erster Geselle arbeitete
und dessen Witwe Margarete er zwei Jahre nach dem Tode seines Lehrherrn geheiratet hat3. Das Gedicht, das durch
die nahe persönliche Beziehung seines Verfassers zu dem Gefeierten gewiß als glaubwürdige Quelle gelten kann und
1 ü. Glück, Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, XXII. S. 32, Anm. 2.
2 Bartsch IX, p. 242. Nr. 28 (p. 532).
3 Drittes Sebalder Pfarrbuch: Balthasar Jenichen von der Neuß (Neiße?), Margret Solissin, 26. Sept. 1564.