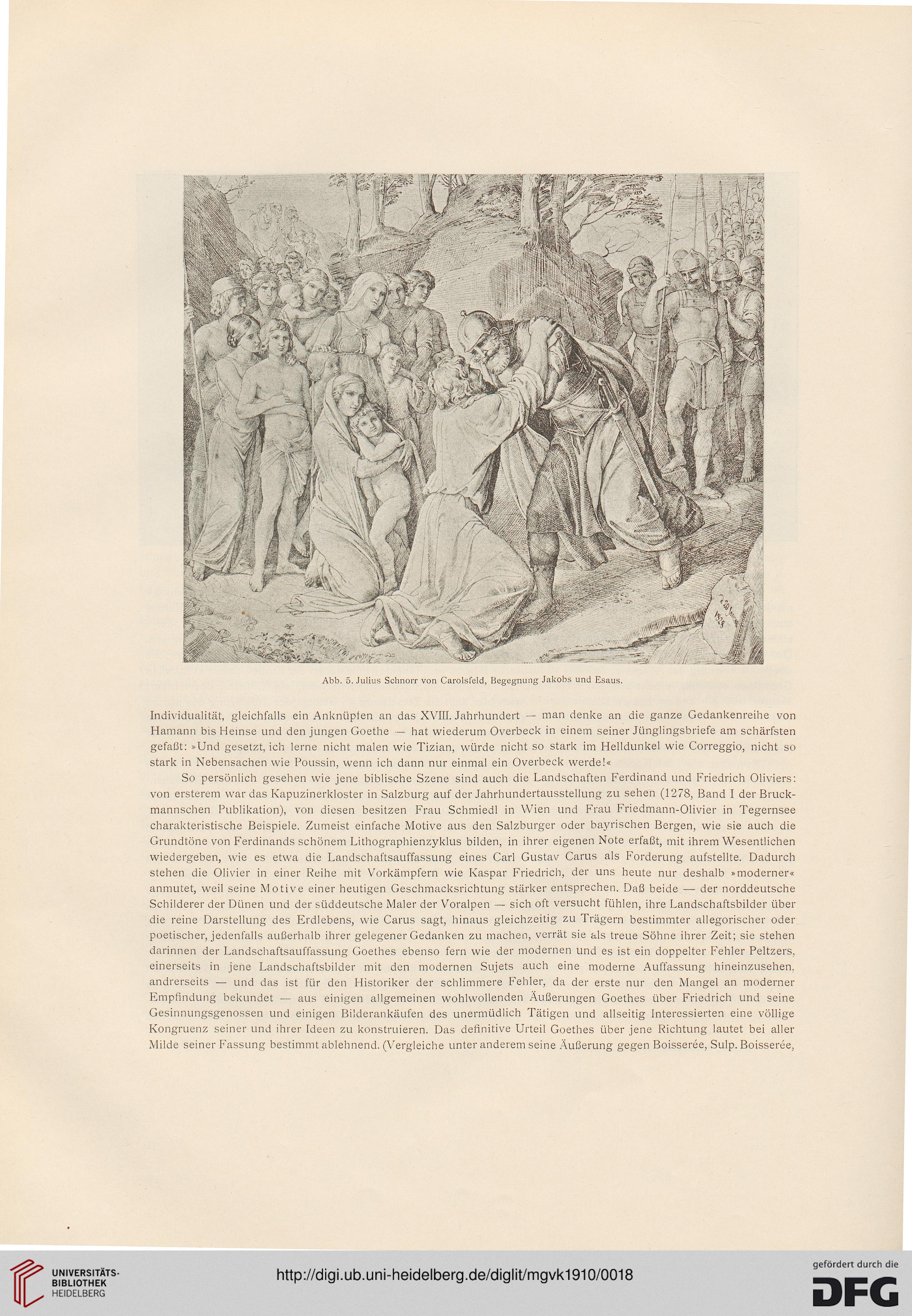Abb. 5. Julius Schnorr von Carolsfeld, Begegnung Jakobs und Esaus.
Individualität, gleichfalls ein Anknüpfen an das XVIII. Jahrhundert — man denke an die ganze Gedankenreihe von
Hamann bis Heinse und den jungen Goethe — hat wiederum Overbeck in einem seiner Jünglingsbriefe am schärfsten
gefaßt: »Und gesetzt, ich lerne nicht malen wie Tizian, würde nicht so stark im Helldunkel wie Correggio, nicht so
stark in Nebensachen wie Poussin, wenn ich dann nur einmal ein Overbeck werde!«
So persönlich gesehen wie jene biblische Szene sind auch die Landschaften Ferdinand und Friedrich Oliviers:
von ersterem war das Kapuzinerkloster in Salzburg auf der Jahrhundertausstellung zu sehen (1278, Band I der Bruck-
mannschen Publikation), von diesen besitzen Frau Schmiedl in Wien und Frau Friedmann-Olivier in Tegernsee
charakteristische Beispiele. Zumeist einfache Motive aus den Salzburger oder bayrischen Bergen, wie sie auch die
Grundtöne von Ferdinands schönem Lithographienzyklus bilden, in ihrer eigenen Note erfaßt, mit ihrem Wesentlichen
wiedergeben, wie es etwa die Landschaftsauffassung eines Carl Gustav Carus als Forderung aufstellte. Dadurch
stehen die Olivier in einer Reihe mit Vorkämpfern wie Kaspar Friedrich, der uns heute nur deshalb »moderner«
anmutet, weil seine Motive einer heutigen Geschmacksrichtung stärker entsprechen. Daß beide — der norddeutsche
Schilderer der Dünen und der süddeutsche Maler der Voralpen — sich oft versucht fühlen, ihre Landschaftsbilder über
die reine Darstellung des Erdlebens, wie Carus sagt, hinaus gleichzeitig zu Trägern bestimmter allegorischer oder
poetischer, jedenfalls außerhalb ihrer gelegener Gedanken zu machen, verrät sie als treue Söhne ihrer Zeit; sie stehen
darinnen der Landschaftsauffassung Goethes ebenso fern wie der modernen und es ist ein doppelter Fehler Peltzers,
einerseits in jene Landschaftsbilder mit den modernen Sujets auch eine moderne Auffassung hineinzusehen,
andrerseits — und das ist für den Historiker der schlimmere Fehler, da der erste nur den Mangel an moderner
Empfindung bekundet — aus einigen allgemeinen wohlwollenden Äußerungen Goethes über Friedrich und seine
Gesinnungsgenossen und einigen Bilderankäufen des unermüdlich Tätigen und allseitig Interessierten eine völlige
Kongruenz seiner und ihrer Ideen zu konstruieren. Das definitive Urteil Goethes über jene Richtung lautet bei aller
Milde seiner Fassung bestimmt ablehnend. (Vergleiche unter anderem seine Äußerung gegen Boisseree, Sulp. Boisseree,
Individualität, gleichfalls ein Anknüpfen an das XVIII. Jahrhundert — man denke an die ganze Gedankenreihe von
Hamann bis Heinse und den jungen Goethe — hat wiederum Overbeck in einem seiner Jünglingsbriefe am schärfsten
gefaßt: »Und gesetzt, ich lerne nicht malen wie Tizian, würde nicht so stark im Helldunkel wie Correggio, nicht so
stark in Nebensachen wie Poussin, wenn ich dann nur einmal ein Overbeck werde!«
So persönlich gesehen wie jene biblische Szene sind auch die Landschaften Ferdinand und Friedrich Oliviers:
von ersterem war das Kapuzinerkloster in Salzburg auf der Jahrhundertausstellung zu sehen (1278, Band I der Bruck-
mannschen Publikation), von diesen besitzen Frau Schmiedl in Wien und Frau Friedmann-Olivier in Tegernsee
charakteristische Beispiele. Zumeist einfache Motive aus den Salzburger oder bayrischen Bergen, wie sie auch die
Grundtöne von Ferdinands schönem Lithographienzyklus bilden, in ihrer eigenen Note erfaßt, mit ihrem Wesentlichen
wiedergeben, wie es etwa die Landschaftsauffassung eines Carl Gustav Carus als Forderung aufstellte. Dadurch
stehen die Olivier in einer Reihe mit Vorkämpfern wie Kaspar Friedrich, der uns heute nur deshalb »moderner«
anmutet, weil seine Motive einer heutigen Geschmacksrichtung stärker entsprechen. Daß beide — der norddeutsche
Schilderer der Dünen und der süddeutsche Maler der Voralpen — sich oft versucht fühlen, ihre Landschaftsbilder über
die reine Darstellung des Erdlebens, wie Carus sagt, hinaus gleichzeitig zu Trägern bestimmter allegorischer oder
poetischer, jedenfalls außerhalb ihrer gelegener Gedanken zu machen, verrät sie als treue Söhne ihrer Zeit; sie stehen
darinnen der Landschaftsauffassung Goethes ebenso fern wie der modernen und es ist ein doppelter Fehler Peltzers,
einerseits in jene Landschaftsbilder mit den modernen Sujets auch eine moderne Auffassung hineinzusehen,
andrerseits — und das ist für den Historiker der schlimmere Fehler, da der erste nur den Mangel an moderner
Empfindung bekundet — aus einigen allgemeinen wohlwollenden Äußerungen Goethes über Friedrich und seine
Gesinnungsgenossen und einigen Bilderankäufen des unermüdlich Tätigen und allseitig Interessierten eine völlige
Kongruenz seiner und ihrer Ideen zu konstruieren. Das definitive Urteil Goethes über jene Richtung lautet bei aller
Milde seiner Fassung bestimmt ablehnend. (Vergleiche unter anderem seine Äußerung gegen Boisseree, Sulp. Boisseree,