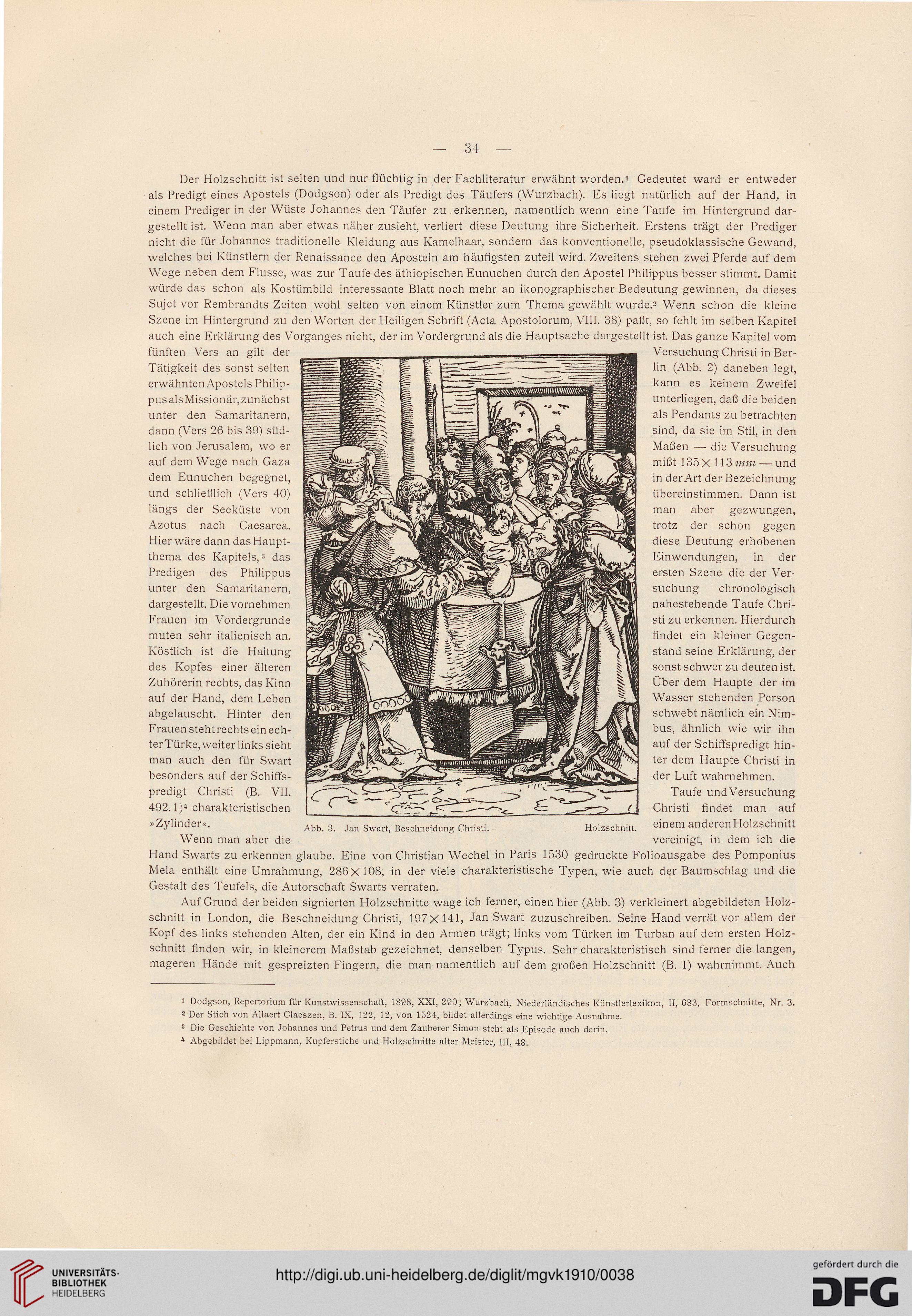— 34 —
Der Holzschnitt ist selten und nur flüchtig in der Fachliteratur erwähnt worden.1 Gedeutet ward er entweder
als Predigt eines Apostels (Dodgson) oder als Predigt des Täufers (Wurzbach). Es liegt natürlich auf der Hand, in
einem Prediger in der Wüste Johannes den Täufer zu erkennen, namentlich wenn eine Taufe im Hintergrund dar-
gestellt ist. Wenn man aber etwas näher zusieht, verliert diese Deutung ihre Sicherheit. Erstens trägt der Prediger
nicht die für Johannes traditionelle Kleidung aus Kamelhaar, sondern das konventionelle, pseudoklassische Gewand,
welches bei Künstlern der Renaissance den Aposteln am häufigsten zuteil wird. Zweitens stehen zwei Pferde auf dem
Wege neben dem Flusse, was zur Taufe des äthiopischen Eunuchen durch den Apostel Philippus besser stimmt. Damit
würde das schon als Kostümbild interessante Blatt noch mehr an ikonographischer Bedeutung gewinnen, da dieses
Sujet vor Rembrandts Zeiten wohl selten von einem Künstler zum Thema gewählt wurde.2 Wenn schon die kleine
Szene im Hintergrund zu den Worten der Heiligen Schrift (Acta Apostolorum, VIII. 38) paßt, so fehlt im selben Kapitel
auch eine Erklärung des Vorganges nicht, der im Vordergrund als die Hauptsache dargestellt ist. Das ganze Kapitel vom
fünften Vers an gilt der
Tätigkeit des sonst selten
erwähnten Apostels Philip-
pus als Missionär, zunächst
unter den Samaritanern,
dann (Vers 26 bis 39) süd-
lich von Jerusalem, wo er
auf dem Wege nach Gaza
dem Eunuchen begegnet,
und schließlich (Vers 40)
längs der Seeküste von
Azotus nach Caesarea.
Hier wäre dann das Haupt-
thema des Kapitels,3 das
Predigen des Philippus
unter den Samaritanern,
dargestellt. Die vornehmen
Frauen im Vordergrunde
muten sehr italienisch an.
Köstlich ist die Haltung
des Kopfes einer älteren
Zuhörerin rechts, das Kinn
auf der Hand, dem Leben
abgelauscht. Hinter den
Frauen stehtrechts ein ech-
ter Türke, weiter links sieht
man auch den für Swart
besonders auf der Schiffs-
predigt Christi (B. VII.
492.1)* charakteristischen
»Zylinder«.
Wenn man aber die
Abb. 3. Jan Swart, Beschneidung Christi.
Holzschnitt.
Versuchung Christi in Ber-
lin (Abb. 2) daneben legt,
kann es keinem Zweifel
unterliegen, daß die beiden
als Pendants zu betrachten
sind, da sie im Stil, in den
Maßen — die Versuchung
mißt 135 X 113 mm — und
in der Art der Bezeichnung
übereinstimmen. Dann ist
man aber gezwungen,
trotz der schon gegen
diese Deutung erhobenen
Einwendungen, in der
ersten Szene die der Ver-
suchung chronologisch
nahestehende Taufe Chri-
sti zu erkennen. Hierdurch
findet ein kleiner Gegen-
stand seine Erklärung, der
sonst schwer zu deuten ist.
Über dem Haupte der im
Wasser stehenden Person
schwebt nämlich ein Nim-
bus, ähnlich wie wir ihn
auf der Schiffspredigt hin-
ter dem Haupte Christi in
der Luft wahrnehmen.
Taufe und Versuchung
Christi findet man auf
einem anderen Holzschnitt
vereinigt, in dem ich die
Hand Swarts zu erkennen glaube. Eine von Christian Wechel in Paris 1530 gedruckte Folioausgabe des Pomponius
Mela enthält eine Umrahmung, 286X108, in der viele charakteristische Typen, wie auch der Baumschlag und die
Gestalt des Teufels, die Autorschaft Swarts verraten.
Auf Grund der beiden signierten Holzschnitte wage ich ferner, einen hier (Abb. 3) verkleinert abgebildeten Holz-
schnitt in London, die Beschneidung Christi, 197x141, Jan Swart zuzuschreiben. Seine Hand verrät vor allem der
Kopf des links stehenden Alten, der ein Kind in den Armen trägt; links vom Türken im Turban auf dem ersten Holz-
schnitt finden wir, in kleinerem Maßstab gezeichnet, denselben Typus. Sehr charakteristisch sind ferner die langen,
mageren Hände mit gespreizten Fingern, die man namentlich auf dem großen Holzschnitt (B. 1) wahrnimmt. Auch
1 Dodgson, Repertorium für Kunstwissenschaft, 1898, XXI, 290; Wurzbach, Niederländisches Künstlerlexikon, II, 683, Formschnitte, Nr. 3.
2 Der Stich von Allaert Claeszen, B. IX, 122, 12, von 1524, bildet allerdings eine wichtige Ausnahme.
3 Die Geschichte von Johannes und Petrus und dem Zauberer Simon steht als Episode auch darin.
* Abgebildet bei Lippmann, Kupferstiche und Holzschnitte alter Meister, III, 48.
Der Holzschnitt ist selten und nur flüchtig in der Fachliteratur erwähnt worden.1 Gedeutet ward er entweder
als Predigt eines Apostels (Dodgson) oder als Predigt des Täufers (Wurzbach). Es liegt natürlich auf der Hand, in
einem Prediger in der Wüste Johannes den Täufer zu erkennen, namentlich wenn eine Taufe im Hintergrund dar-
gestellt ist. Wenn man aber etwas näher zusieht, verliert diese Deutung ihre Sicherheit. Erstens trägt der Prediger
nicht die für Johannes traditionelle Kleidung aus Kamelhaar, sondern das konventionelle, pseudoklassische Gewand,
welches bei Künstlern der Renaissance den Aposteln am häufigsten zuteil wird. Zweitens stehen zwei Pferde auf dem
Wege neben dem Flusse, was zur Taufe des äthiopischen Eunuchen durch den Apostel Philippus besser stimmt. Damit
würde das schon als Kostümbild interessante Blatt noch mehr an ikonographischer Bedeutung gewinnen, da dieses
Sujet vor Rembrandts Zeiten wohl selten von einem Künstler zum Thema gewählt wurde.2 Wenn schon die kleine
Szene im Hintergrund zu den Worten der Heiligen Schrift (Acta Apostolorum, VIII. 38) paßt, so fehlt im selben Kapitel
auch eine Erklärung des Vorganges nicht, der im Vordergrund als die Hauptsache dargestellt ist. Das ganze Kapitel vom
fünften Vers an gilt der
Tätigkeit des sonst selten
erwähnten Apostels Philip-
pus als Missionär, zunächst
unter den Samaritanern,
dann (Vers 26 bis 39) süd-
lich von Jerusalem, wo er
auf dem Wege nach Gaza
dem Eunuchen begegnet,
und schließlich (Vers 40)
längs der Seeküste von
Azotus nach Caesarea.
Hier wäre dann das Haupt-
thema des Kapitels,3 das
Predigen des Philippus
unter den Samaritanern,
dargestellt. Die vornehmen
Frauen im Vordergrunde
muten sehr italienisch an.
Köstlich ist die Haltung
des Kopfes einer älteren
Zuhörerin rechts, das Kinn
auf der Hand, dem Leben
abgelauscht. Hinter den
Frauen stehtrechts ein ech-
ter Türke, weiter links sieht
man auch den für Swart
besonders auf der Schiffs-
predigt Christi (B. VII.
492.1)* charakteristischen
»Zylinder«.
Wenn man aber die
Abb. 3. Jan Swart, Beschneidung Christi.
Holzschnitt.
Versuchung Christi in Ber-
lin (Abb. 2) daneben legt,
kann es keinem Zweifel
unterliegen, daß die beiden
als Pendants zu betrachten
sind, da sie im Stil, in den
Maßen — die Versuchung
mißt 135 X 113 mm — und
in der Art der Bezeichnung
übereinstimmen. Dann ist
man aber gezwungen,
trotz der schon gegen
diese Deutung erhobenen
Einwendungen, in der
ersten Szene die der Ver-
suchung chronologisch
nahestehende Taufe Chri-
sti zu erkennen. Hierdurch
findet ein kleiner Gegen-
stand seine Erklärung, der
sonst schwer zu deuten ist.
Über dem Haupte der im
Wasser stehenden Person
schwebt nämlich ein Nim-
bus, ähnlich wie wir ihn
auf der Schiffspredigt hin-
ter dem Haupte Christi in
der Luft wahrnehmen.
Taufe und Versuchung
Christi findet man auf
einem anderen Holzschnitt
vereinigt, in dem ich die
Hand Swarts zu erkennen glaube. Eine von Christian Wechel in Paris 1530 gedruckte Folioausgabe des Pomponius
Mela enthält eine Umrahmung, 286X108, in der viele charakteristische Typen, wie auch der Baumschlag und die
Gestalt des Teufels, die Autorschaft Swarts verraten.
Auf Grund der beiden signierten Holzschnitte wage ich ferner, einen hier (Abb. 3) verkleinert abgebildeten Holz-
schnitt in London, die Beschneidung Christi, 197x141, Jan Swart zuzuschreiben. Seine Hand verrät vor allem der
Kopf des links stehenden Alten, der ein Kind in den Armen trägt; links vom Türken im Turban auf dem ersten Holz-
schnitt finden wir, in kleinerem Maßstab gezeichnet, denselben Typus. Sehr charakteristisch sind ferner die langen,
mageren Hände mit gespreizten Fingern, die man namentlich auf dem großen Holzschnitt (B. 1) wahrnimmt. Auch
1 Dodgson, Repertorium für Kunstwissenschaft, 1898, XXI, 290; Wurzbach, Niederländisches Künstlerlexikon, II, 683, Formschnitte, Nr. 3.
2 Der Stich von Allaert Claeszen, B. IX, 122, 12, von 1524, bildet allerdings eine wichtige Ausnahme.
3 Die Geschichte von Johannes und Petrus und dem Zauberer Simon steht als Episode auch darin.
* Abgebildet bei Lippmann, Kupferstiche und Holzschnitte alter Meister, III, 48.