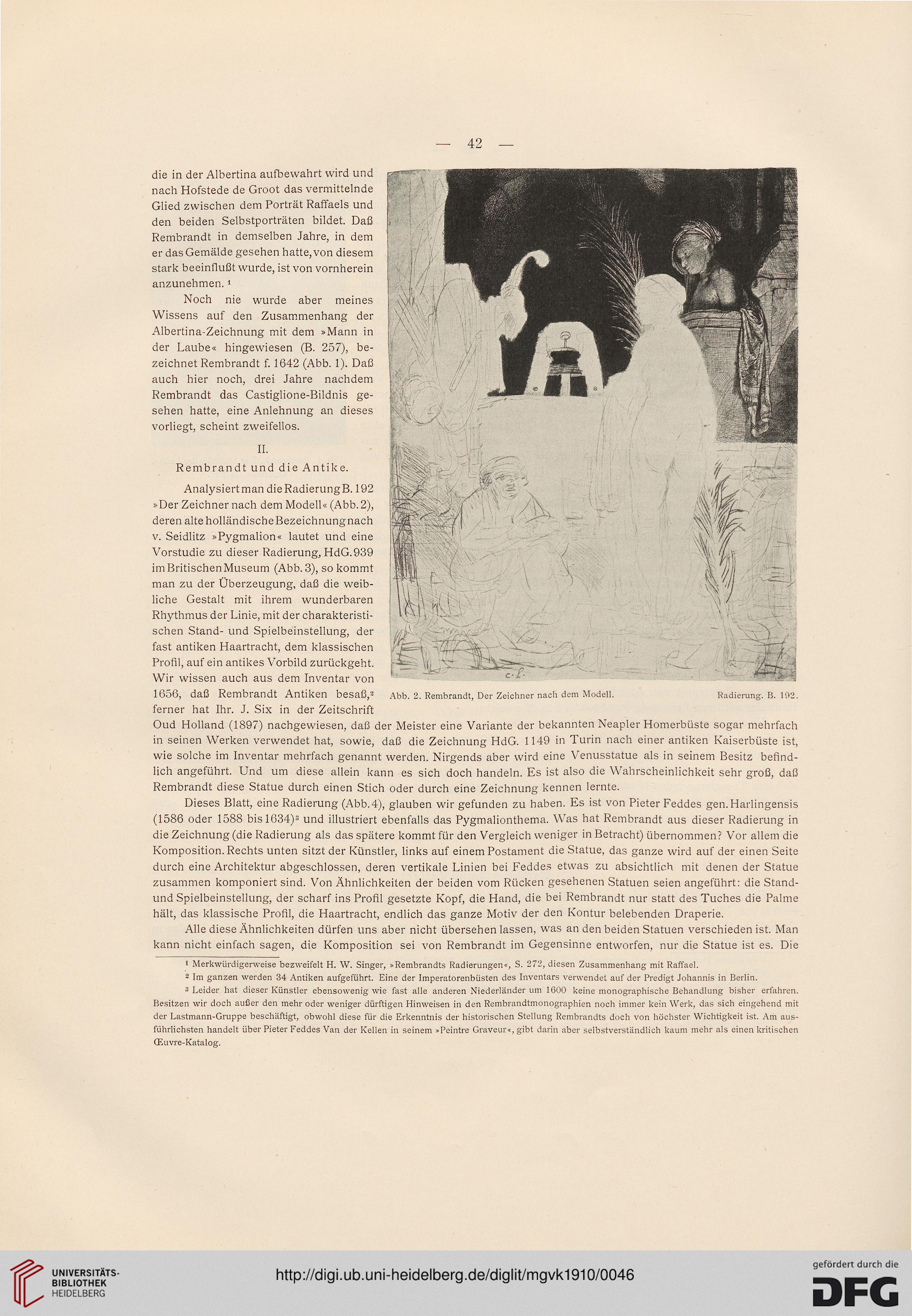— 42 —
die in der Albertina aufbewahrt wird und
nach Hofstede de Groot das vermittelnde
Glied zwischen dem Porträt Raffaels und
den beiden Selbstporträten bildet. Daß
Rembrandt in demselben Jahre, in dem
er das Gemälde gesehen hatte, von diesem
stark beeinflußt wurde, ist von vornherein
anzunehmen.1
Noch nie wurde aber meines
Wissens auf den Zusammenhang der
Albertina-Zeichnung mit dem »Mann in
der Laube« hingewiesen (B. 257), be-
zeichnet Rembrandt f. 1642 (Abb. 1). Daß
auch hier noch, drei Jahre nachdem
Rembrandt das Castiglione-Bildnis ge-
sehen hatte, eine Anlehnung an dieses
vorliegt, scheint zweifellos.
II.
Rembrandt und die Antike.
Analysiert man die Radierung B. 192
»Der Zeichner nach dem Modell« (Abb. 2),
deren alteholländiscbeBezeichnungnach
v. Seidlitz »Pygmalion« lautet und eine
Vorstudie zu dieser Radierung, HdG.939
im Britischen Museum (Abb. 3), so kommt
man zu der Überzeugung, daß die weib-
liche Gestalt mit ihrem wunderbaren
Rhythmus der Linie, mit der charakteristi-
schen Stand- und Spielbeinstellung, der
fast antiken Haartracht, dem klassischen
Profil, auf ein antikes Vorbild zurückgeht.
Wir wissen auch aus dem Inventar von
1656, daß Rembrandt Antiken besaß,»
ferner hat Ihr. J. Six in der Zeitschrift
Oud Holland (1897) nachgewiesen, daß der Meister eine Variante der bekannten Neapler Homerbüste sogar mehrfach
in seinen Werken verwendet hat, sowie, daß die Zeichnung HdG. 1149 in Turin nach einer antiken Kaiserbüste ist,
wie solche im Inventar mehrfach genannt werden. Nirgends aber wird eine Venusstatue als in seinem Besitz befind-
lich angeführt. Und um diese allein kann es sich doch handeln. Es ist also die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß
Rembrandt diese Statue durch einen Stich oder durch eine Zeichnung kennen lernte.
Dieses Blatt, eine Radierung (Abb.4), glauben wir gefunden zu haben. Es ist von Pieter Feddes gen.Harlingensis
(1586 oder 1588 bisl634)3 und illustriert ebenfalls das Pygmalionthema. Was hat Rembrandt aus dieser Radierung in
die Zeichnung (die Radierung als das spätere kommt für den Vergleich weniger in Betracht) übernommen? Vor allem die
Komposition. Rechts unten sitzt der Künstler, links auf einem Postament die Statue, das ganze wird auf der einen Seite
durch eine Architektur abgeschlossen, deren vertikale Linien bei Feddes etwas zu absichtlich mit denen der Statue
zusammen komponiert sind. Von Ähnlichkeiten der beiden vom Rücken gesehenen Statuen seien angeführt: die Stand-
und Spielbeinstellung, der scharf ins Profil gesetzte Kopf, die Hand, die bei Rembrandt nur statt des Tuches die Palme
hält, das klassische Profil, die Haartracht, endlich das ganze Motiv der den Kontur belebenden Draperie.
Alle diese Ähnlichkeiten dürfen uns aber nicht übersehen lassen, was an den beiden Statuen verschieden ist. Man
kann nicht einfach sagen, die Komposition sei von Rembrandt im Gegensinne entworfen, nur die Statue ist es. Die
< Merkwürdigerweise bezweifelt H. W. Singer, »Rembrandts Radierungen*, S. 272, diesen Zusammenhang mit Raffael.
2 Im ganzen werden 34 Antiken aufgeführt. Eine der Imperatorenbüsten des Inventars verwendet auf der Predigt Johannis in Berlin.
s Leider hat dieser Künstler ebensowenig wie fast alle anderen Niederländer um 1600 keine monographische Behandlung bisher erfahren.
Besitzen wir doch außer den mehr oder weniger dürftigen Hinweisen in den Rembrandtmonographien noch immer kein Werk, das sich eingehend mit
der Lastmann-Gruppe beschäftigt, obwohl diese für die Erkenntnis der historischen Stellung Rembrandts doch von höchster Wichtigkeit ist. Am aus-
führlichsten handelt über Pieter Feddes Van der Kellen in seinem >Peintre Graveur«, gibt darin aber selbstverständlich kaum mehr als einen kritischen
Oeuvre-Katalog.
Abb. 2. Rembrandt, Der Zeichner nach dem Modell. Radierung. B. 192
die in der Albertina aufbewahrt wird und
nach Hofstede de Groot das vermittelnde
Glied zwischen dem Porträt Raffaels und
den beiden Selbstporträten bildet. Daß
Rembrandt in demselben Jahre, in dem
er das Gemälde gesehen hatte, von diesem
stark beeinflußt wurde, ist von vornherein
anzunehmen.1
Noch nie wurde aber meines
Wissens auf den Zusammenhang der
Albertina-Zeichnung mit dem »Mann in
der Laube« hingewiesen (B. 257), be-
zeichnet Rembrandt f. 1642 (Abb. 1). Daß
auch hier noch, drei Jahre nachdem
Rembrandt das Castiglione-Bildnis ge-
sehen hatte, eine Anlehnung an dieses
vorliegt, scheint zweifellos.
II.
Rembrandt und die Antike.
Analysiert man die Radierung B. 192
»Der Zeichner nach dem Modell« (Abb. 2),
deren alteholländiscbeBezeichnungnach
v. Seidlitz »Pygmalion« lautet und eine
Vorstudie zu dieser Radierung, HdG.939
im Britischen Museum (Abb. 3), so kommt
man zu der Überzeugung, daß die weib-
liche Gestalt mit ihrem wunderbaren
Rhythmus der Linie, mit der charakteristi-
schen Stand- und Spielbeinstellung, der
fast antiken Haartracht, dem klassischen
Profil, auf ein antikes Vorbild zurückgeht.
Wir wissen auch aus dem Inventar von
1656, daß Rembrandt Antiken besaß,»
ferner hat Ihr. J. Six in der Zeitschrift
Oud Holland (1897) nachgewiesen, daß der Meister eine Variante der bekannten Neapler Homerbüste sogar mehrfach
in seinen Werken verwendet hat, sowie, daß die Zeichnung HdG. 1149 in Turin nach einer antiken Kaiserbüste ist,
wie solche im Inventar mehrfach genannt werden. Nirgends aber wird eine Venusstatue als in seinem Besitz befind-
lich angeführt. Und um diese allein kann es sich doch handeln. Es ist also die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß
Rembrandt diese Statue durch einen Stich oder durch eine Zeichnung kennen lernte.
Dieses Blatt, eine Radierung (Abb.4), glauben wir gefunden zu haben. Es ist von Pieter Feddes gen.Harlingensis
(1586 oder 1588 bisl634)3 und illustriert ebenfalls das Pygmalionthema. Was hat Rembrandt aus dieser Radierung in
die Zeichnung (die Radierung als das spätere kommt für den Vergleich weniger in Betracht) übernommen? Vor allem die
Komposition. Rechts unten sitzt der Künstler, links auf einem Postament die Statue, das ganze wird auf der einen Seite
durch eine Architektur abgeschlossen, deren vertikale Linien bei Feddes etwas zu absichtlich mit denen der Statue
zusammen komponiert sind. Von Ähnlichkeiten der beiden vom Rücken gesehenen Statuen seien angeführt: die Stand-
und Spielbeinstellung, der scharf ins Profil gesetzte Kopf, die Hand, die bei Rembrandt nur statt des Tuches die Palme
hält, das klassische Profil, die Haartracht, endlich das ganze Motiv der den Kontur belebenden Draperie.
Alle diese Ähnlichkeiten dürfen uns aber nicht übersehen lassen, was an den beiden Statuen verschieden ist. Man
kann nicht einfach sagen, die Komposition sei von Rembrandt im Gegensinne entworfen, nur die Statue ist es. Die
< Merkwürdigerweise bezweifelt H. W. Singer, »Rembrandts Radierungen*, S. 272, diesen Zusammenhang mit Raffael.
2 Im ganzen werden 34 Antiken aufgeführt. Eine der Imperatorenbüsten des Inventars verwendet auf der Predigt Johannis in Berlin.
s Leider hat dieser Künstler ebensowenig wie fast alle anderen Niederländer um 1600 keine monographische Behandlung bisher erfahren.
Besitzen wir doch außer den mehr oder weniger dürftigen Hinweisen in den Rembrandtmonographien noch immer kein Werk, das sich eingehend mit
der Lastmann-Gruppe beschäftigt, obwohl diese für die Erkenntnis der historischen Stellung Rembrandts doch von höchster Wichtigkeit ist. Am aus-
führlichsten handelt über Pieter Feddes Van der Kellen in seinem >Peintre Graveur«, gibt darin aber selbstverständlich kaum mehr als einen kritischen
Oeuvre-Katalog.
Abb. 2. Rembrandt, Der Zeichner nach dem Modell. Radierung. B. 192