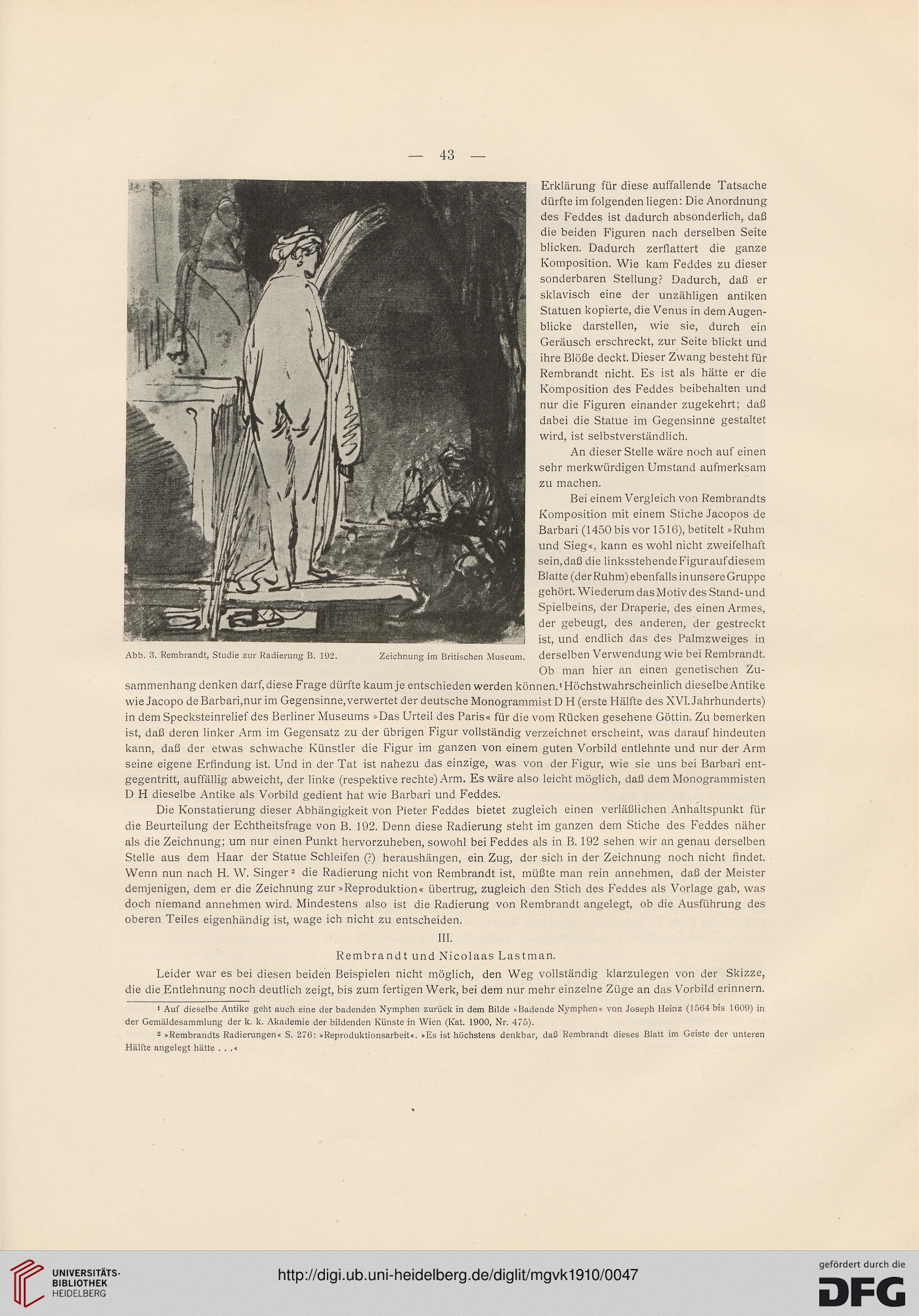— 43 —
Erklärung für diese auffallende Tatsache
dürfte im folgenden liegen: Die Anordnung
des Feddes ist dadurch absonderlich, daß
die beiden Figuren nach derselben Seite
blicken. Dadurch zerflattert die ganze
Komposition. Wie kam Feddes zu dieser
sonderbaren Stellung? Dadurch, daß er
sklavisch eine der unzähligen antiken
Statuen kopierte, die Venus in dem Augen-
blicke darstellen, wie sie, durch ein
Geräusch erschreckt, zur Seite blickt und
ihre Blöße deckt. Dieser Zwang besteht für
Rembrandt nicht. Es ist als hätte er die
Komposition des Feddes beibehalten und
nur die Figuren einander zugekehrt; daß
dabei die Statue im Gegensinne gestaltet
wird, ist selbstverständlich.
An dieser Stelle wäre noch auf einen
sehr merkwürdigen Umstand aufmerksam
zu machen.
Bei einem Vergleich von Rembrandts
Komposition mit einem Stiche Jacopos de
Barbari (1450 bis vor 1516), betitelt »Ruhm
und Sieg«, kann es wohl nicht zweifelhaft
sein,daß die linksstehende Figurauf diesem
Blatte (der Ruhm) ebenfalls in unsere Gruppe
gehört. Wiederum das Motiv des Stand- und
Spielbeins, der Draperie, des einen Armes,
der gebeugt, des anderen, der gestreckt
ist, und endlich das des Palmzweiges in
Abb. 3. Rembrandt, Studie zur Radierung B. 192. Zeichnung im Britischen Museum. derselben Verwendung wie bei Rembrandt.
Ob man hier an einen genetischen Zu-
sammenhangdenken darf, diese Frage dürfte kaum je entschieden werden können.1 Höchstwahrscheinlich dieselbe Antike
wie Jacopo de Barbari,nur im Gegensinne, verwertet der deutsche Monogrammist D H (erste Hälfte des XVI. Jahrhunderts)
in dem Specksteinrelief des Berliner Museums »Das Urteil des Paris« für die vom Rücken gesehene Göttin. Zu bemerken
ist, daß deren linker Arm im Gegensatz zu der übrigen Figur vollständig verzeichnet erscheint, was darauf hindeuten
kann, daß der etwas schwache Künstler die Figur im ganzen von einem guten Vorbild entlehnte und nur der Arm
seine eigene Erfindung ist. Und in der Tat ist nahezu das einzige, was von der Figur, wie sie uns bei Barbari ent-
gegentritt, auffällig abweicht, der linke (respektive rechte) Arm. Es wäre also leicht möglich, daß dem Monogrammisten
D H dieselbe Antike als Vorbild gedient hat wie Barbari und Feddes.
Die Konstatierung dieser Abhängigkeit von Pieter Feddes bietet zugleich einen verläßlichen Anhaltspunkt für
die Beurteilung der Echtheitsfrage von B. 192. Denn diese Radierung steht im ganzen dem Stiche des Feddes näher
als die Zeichnung; um nur einen Punkt hervorzuheben, sowohl bei Feddes als in B. 192 sehen wir an genau derselben
Stelle aus dem Haar der Statue Schleifen (?) heraushängen, ein Zug, der sich in der Zeichnung noch nicht findet.
Wenn nun nach H. W. Singer3 die Radierung nicht von Rembrandt ist, müßte man rein annehmen, daß der Meister
demjenigen, dem er die Zeichnung zur »Reproduktion« übertrug, zugleich den Stich des Feddes als Vorlage gab, was
doch niemand annehmen wird. Mindestens also ist die Radierung von Rembrandt angelegt, ob die Ausführung des
oberen Teiles eigenhändig ist, wage ich nicht zu entscheiden.
III.
Rembrandt und Nicolaas Lastman.
Leider war es bei diesen beiden Beispielen nicht möglich, den Weg vollständig klarzulegen von der Skizze,
die die Entlehnung noch deutlich zeigt, bis zum fertigen Werk, bei dem nur mehr einzelne Züge an das Vorbild erinnern.
1 Auf dieselbe Antike geht auch eine der badenden Nymphen zurück in dem Bilde »Badende Nymphen« von Joseph Heinz (1564 bis 1609) in
der Gemäldesammlung der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien (Kat. 1900, Nr. 475).
2 >Rembrandts Radierungen« S. 276: »Reproduktionsarbeit«. »Es ist höchstens denkbar, daß Rembrandt dieses Blatt im Geiste der unteren
Hälfte angelegt hätte . . .«
Erklärung für diese auffallende Tatsache
dürfte im folgenden liegen: Die Anordnung
des Feddes ist dadurch absonderlich, daß
die beiden Figuren nach derselben Seite
blicken. Dadurch zerflattert die ganze
Komposition. Wie kam Feddes zu dieser
sonderbaren Stellung? Dadurch, daß er
sklavisch eine der unzähligen antiken
Statuen kopierte, die Venus in dem Augen-
blicke darstellen, wie sie, durch ein
Geräusch erschreckt, zur Seite blickt und
ihre Blöße deckt. Dieser Zwang besteht für
Rembrandt nicht. Es ist als hätte er die
Komposition des Feddes beibehalten und
nur die Figuren einander zugekehrt; daß
dabei die Statue im Gegensinne gestaltet
wird, ist selbstverständlich.
An dieser Stelle wäre noch auf einen
sehr merkwürdigen Umstand aufmerksam
zu machen.
Bei einem Vergleich von Rembrandts
Komposition mit einem Stiche Jacopos de
Barbari (1450 bis vor 1516), betitelt »Ruhm
und Sieg«, kann es wohl nicht zweifelhaft
sein,daß die linksstehende Figurauf diesem
Blatte (der Ruhm) ebenfalls in unsere Gruppe
gehört. Wiederum das Motiv des Stand- und
Spielbeins, der Draperie, des einen Armes,
der gebeugt, des anderen, der gestreckt
ist, und endlich das des Palmzweiges in
Abb. 3. Rembrandt, Studie zur Radierung B. 192. Zeichnung im Britischen Museum. derselben Verwendung wie bei Rembrandt.
Ob man hier an einen genetischen Zu-
sammenhangdenken darf, diese Frage dürfte kaum je entschieden werden können.1 Höchstwahrscheinlich dieselbe Antike
wie Jacopo de Barbari,nur im Gegensinne, verwertet der deutsche Monogrammist D H (erste Hälfte des XVI. Jahrhunderts)
in dem Specksteinrelief des Berliner Museums »Das Urteil des Paris« für die vom Rücken gesehene Göttin. Zu bemerken
ist, daß deren linker Arm im Gegensatz zu der übrigen Figur vollständig verzeichnet erscheint, was darauf hindeuten
kann, daß der etwas schwache Künstler die Figur im ganzen von einem guten Vorbild entlehnte und nur der Arm
seine eigene Erfindung ist. Und in der Tat ist nahezu das einzige, was von der Figur, wie sie uns bei Barbari ent-
gegentritt, auffällig abweicht, der linke (respektive rechte) Arm. Es wäre also leicht möglich, daß dem Monogrammisten
D H dieselbe Antike als Vorbild gedient hat wie Barbari und Feddes.
Die Konstatierung dieser Abhängigkeit von Pieter Feddes bietet zugleich einen verläßlichen Anhaltspunkt für
die Beurteilung der Echtheitsfrage von B. 192. Denn diese Radierung steht im ganzen dem Stiche des Feddes näher
als die Zeichnung; um nur einen Punkt hervorzuheben, sowohl bei Feddes als in B. 192 sehen wir an genau derselben
Stelle aus dem Haar der Statue Schleifen (?) heraushängen, ein Zug, der sich in der Zeichnung noch nicht findet.
Wenn nun nach H. W. Singer3 die Radierung nicht von Rembrandt ist, müßte man rein annehmen, daß der Meister
demjenigen, dem er die Zeichnung zur »Reproduktion« übertrug, zugleich den Stich des Feddes als Vorlage gab, was
doch niemand annehmen wird. Mindestens also ist die Radierung von Rembrandt angelegt, ob die Ausführung des
oberen Teiles eigenhändig ist, wage ich nicht zu entscheiden.
III.
Rembrandt und Nicolaas Lastman.
Leider war es bei diesen beiden Beispielen nicht möglich, den Weg vollständig klarzulegen von der Skizze,
die die Entlehnung noch deutlich zeigt, bis zum fertigen Werk, bei dem nur mehr einzelne Züge an das Vorbild erinnern.
1 Auf dieselbe Antike geht auch eine der badenden Nymphen zurück in dem Bilde »Badende Nymphen« von Joseph Heinz (1564 bis 1609) in
der Gemäldesammlung der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien (Kat. 1900, Nr. 475).
2 >Rembrandts Radierungen« S. 276: »Reproduktionsarbeit«. »Es ist höchstens denkbar, daß Rembrandt dieses Blatt im Geiste der unteren
Hälfte angelegt hätte . . .«