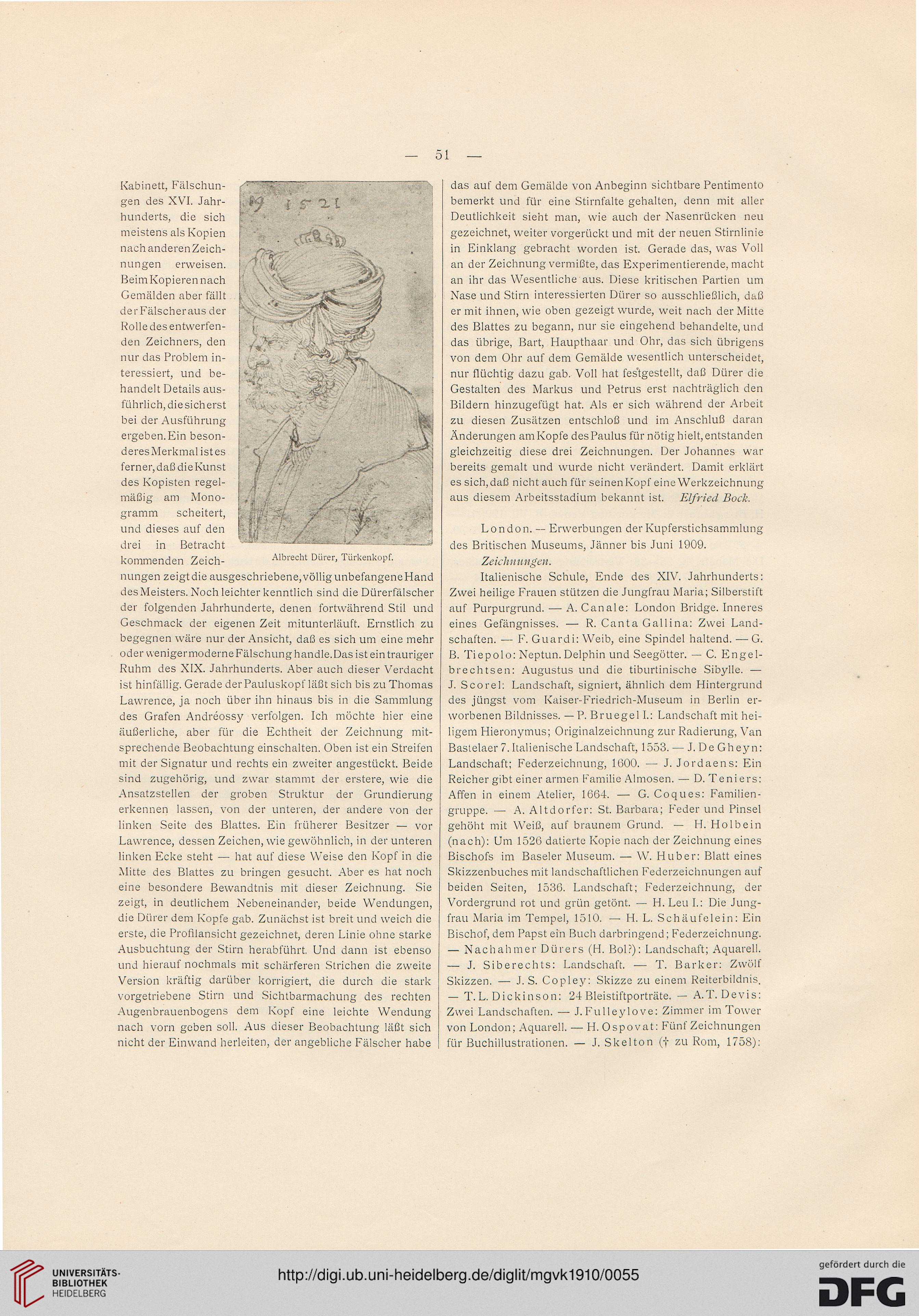51
Kabinett. Fälschun-
gen des XVI. Jahr-
hunderts, die sich
meistens als Kopien
nach anderen Zeich-
nungen erweisen.
Beim Kopieren nach
Gemälden aber fällt
der Fälscheraus der
Rolle des entwerfen-
den Zeichners, den
nur das Problem in-
teressiert, und be-
handelt Details aus-
führlich, die sicherst
bei der Ausführung
ergeben. Ein beson-
deres Merkmal ist es
ferner, daß die Kunst
des Kopisten regel-
mäßig am Mono-
gramm scheitert,
und dieses auf den
drei in Betracht
kommenden Zeich- Albrecht Dürer, Türkenkopf.
nungen zeigt die ausgeschriebene, völlig unbefangene Hand
des Meisters. Noch leichter kenntlich sind die Dürerfälscher
der folgenden Jahrhunderte, denen fortwährend Stil und
Geschmack der eigenen Zeit mitunterläuft. Ernstlich zu
begegnen wäre nur der Ansicht, daß es sich um eine mehr
oder weniger moderne Fälschung handle.Das ist ein trauriger
Ruhm des XIX. Jahrhunderts. Aber auch dieser Verdacht
ist hinfällig. Gerade der Pauluskopf läßt sich bis zu Thomas
Lawrence, ja noch über ihn hinaus bis in die Sammlung
des Grafen Andreossy verfolgen. Ich möchte hier eine
äußerliche, aber für die Echtheit der Zeichnung mit-
sprechende Beobachtung einschalten. Oben ist ein Streifen
mit der Signatur und rechts ein zweiter angestückt. Beide
sind zugehörig, und zwar stammt der erstere, wie die
Ansatzstellen der groben Struktur der Grundierung
erkennen lassen, von der unteren, der andere von der
linken Seite des Blattes. Ein früherer Besitzer — vor
Lawrence, dessen Zeichen, wie gewöhnlich, in der unteren
linken Ecke steht — hat auf diese Weise den Kopf in die
Mitte des Blattes zu bringen gesucht. Aber es hat noch
eine besondere Bewandtnis mit dieser Zeichnung. Sie
zeigt, in deutlichem Nebeneinander, beide Wendlingen,
die Dürer dem Kopfe gab. Zunächst ist breit und weich die
erste, die Profilansicht gezeichnet, deren Linie ohne starke
Ausbuchtung der Stirn herabführt. Und dann ist ebenso
und hierauf nochmals mit schärferen Strichen die zweite
Version kräftig darüber korrigiert, die durch die stark
vorgetriebene Stirn und Sichtbarmachung des rechten
Augenbrauenbogens dem Kopf eine leichte Wendung
nach vorn geben soll. Aus dieser Beobachtung läßt sich
nicht der Einwand herleiten, der angebliche Fälscher habe
das auf dem Gemälde von Anbeginn sichtbare Pentimento
bemerkt und für eine Stirnfalte gehalten, denn mit aller
Deutlichkeit sieht man, wie auch der Nasenrücken neu
gezeichnet, weiter vorgerückt und mit der neuen Stirnlinie
in Einklang gebracht worden ist. Gerade das, was Voll
an der Zeichnung vermißte, das Experimentierende, macht
an ihr das Wesentliche aus. Diese kritischen Partien um
Nase und Stirn interessierten Dürer so ausschließlich, daß
er mit ihnen, wie oben gezeigt wurde, weit nach der Mitte
des Blattes zu begann, nur sie eingehend behandelte, und
das übrige, Bart, Haupthaar und Ohr, das sich übrigens
von dem Ohr auf dem Gemälde wesentlich unterscheidet,
nur flüchtig dazu gab. Voll hat festgestellt, daß Dürer die
Gestalten des Markus und Petrus erst nachträglich den
Bildern hinzugefügt hat. Als er sich während der Arbeit
zu diesen Zusätzen entschloß und irn Anschluß daran
Änderungen am Kopfe des Paulus für nötig hielt, entstanden
gleichzeitig diese drei Zeichnungen. Der Johannes war
bereits gemalt und wurde nicht verändert. Damit erklärt
es sich, daß nicht auch für seinen Kopf eine Werkzeichnung
aus diesem Arbeitsstadium bekannt ist. Elfried Bock.
London. — Erwerbungen der Kupferstichsammlung
des Britischen Museums, Jänner bis Juni 1909.
Zeichnungen.
Italienische Schule, Ende des XIV. Jahrhunderts:
Zwei heilige Frauen stützen die Jungfrau Maria; Silberstift
auf Purpurgrund. — A. Canale: London Bridge. Inneres
eines Gefängnisses. — R. Canta Gallina: Zwei Land-
schaften. — F. Guardi: Weib, eine Spindel haltend. —G.
B. Tiepolo: Neptun. Delphin und Seegötter. — C. Engel-
brechtsen: Augustus und die tiburtinische Sibylle. —
J. Scorel: Landschaft, signiert, ähnlich dem Hintergrund
des jüngst vom Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin er-
worbenen Bildnisses. — P. Bruegel I.: Landschaft mit hei-
ligem Hieronymus; Originalzeichnung zur Radierung, Van
Bastelaer 7. Italienische Landschaft, 1553. — J. DeGheyn:
Landschaft; Federzeichnung, 1600. — J. Jordaens: Ein
Reicher gibt einer armen Familie Almosen. — D. Teniers:
Affen in einem Atelier, 1064. — G. Coques: Familien-
gruppe. — A. Altdorfer: St. Barbara; Feder und Pinsel
gehöht mit Weiß, auf braunem Grund. — H. Holbein
(nach): Um 1526 datierte Kopie nach der Zeichnung eines
Bischofs im Baseler Museum. — W. Huber: Blatt eines
Skizzenbuches mit landschaftlichen Federzeichnungen auf
beiden Seiten, 1536. Landschaft; Federzeichnung, der
Vordergrund rot und grün getönt. — H. Leu I.: Die Jung-
frau Maria im Tempel, 1510. — H. L. Schäufelein: Ein
Bischof, dem Papst ein Buch darbringend; Federzeichnung.
— Nachahmer Dürers (H. Bol?): Landschaft; Aquarell.
— J. Siberechts: Landschaft. — T. Barker: Zwölf
Skizzen. — J. S. Copley: Skizze zu einem Reiterbildnis.
— T. L. Dickinson: 24 Bleistiftporträte. - A.T. De vis:
Zwei Landschaften. — J. Fulleylove: Zimmer im Tower
von London; Aquarell. — H. Ospovat: Fünf Zeichnungen
für Buchillustrationen, — J. Skelton (f zu Rom, 1758):
Kabinett. Fälschun-
gen des XVI. Jahr-
hunderts, die sich
meistens als Kopien
nach anderen Zeich-
nungen erweisen.
Beim Kopieren nach
Gemälden aber fällt
der Fälscheraus der
Rolle des entwerfen-
den Zeichners, den
nur das Problem in-
teressiert, und be-
handelt Details aus-
führlich, die sicherst
bei der Ausführung
ergeben. Ein beson-
deres Merkmal ist es
ferner, daß die Kunst
des Kopisten regel-
mäßig am Mono-
gramm scheitert,
und dieses auf den
drei in Betracht
kommenden Zeich- Albrecht Dürer, Türkenkopf.
nungen zeigt die ausgeschriebene, völlig unbefangene Hand
des Meisters. Noch leichter kenntlich sind die Dürerfälscher
der folgenden Jahrhunderte, denen fortwährend Stil und
Geschmack der eigenen Zeit mitunterläuft. Ernstlich zu
begegnen wäre nur der Ansicht, daß es sich um eine mehr
oder weniger moderne Fälschung handle.Das ist ein trauriger
Ruhm des XIX. Jahrhunderts. Aber auch dieser Verdacht
ist hinfällig. Gerade der Pauluskopf läßt sich bis zu Thomas
Lawrence, ja noch über ihn hinaus bis in die Sammlung
des Grafen Andreossy verfolgen. Ich möchte hier eine
äußerliche, aber für die Echtheit der Zeichnung mit-
sprechende Beobachtung einschalten. Oben ist ein Streifen
mit der Signatur und rechts ein zweiter angestückt. Beide
sind zugehörig, und zwar stammt der erstere, wie die
Ansatzstellen der groben Struktur der Grundierung
erkennen lassen, von der unteren, der andere von der
linken Seite des Blattes. Ein früherer Besitzer — vor
Lawrence, dessen Zeichen, wie gewöhnlich, in der unteren
linken Ecke steht — hat auf diese Weise den Kopf in die
Mitte des Blattes zu bringen gesucht. Aber es hat noch
eine besondere Bewandtnis mit dieser Zeichnung. Sie
zeigt, in deutlichem Nebeneinander, beide Wendlingen,
die Dürer dem Kopfe gab. Zunächst ist breit und weich die
erste, die Profilansicht gezeichnet, deren Linie ohne starke
Ausbuchtung der Stirn herabführt. Und dann ist ebenso
und hierauf nochmals mit schärferen Strichen die zweite
Version kräftig darüber korrigiert, die durch die stark
vorgetriebene Stirn und Sichtbarmachung des rechten
Augenbrauenbogens dem Kopf eine leichte Wendung
nach vorn geben soll. Aus dieser Beobachtung läßt sich
nicht der Einwand herleiten, der angebliche Fälscher habe
das auf dem Gemälde von Anbeginn sichtbare Pentimento
bemerkt und für eine Stirnfalte gehalten, denn mit aller
Deutlichkeit sieht man, wie auch der Nasenrücken neu
gezeichnet, weiter vorgerückt und mit der neuen Stirnlinie
in Einklang gebracht worden ist. Gerade das, was Voll
an der Zeichnung vermißte, das Experimentierende, macht
an ihr das Wesentliche aus. Diese kritischen Partien um
Nase und Stirn interessierten Dürer so ausschließlich, daß
er mit ihnen, wie oben gezeigt wurde, weit nach der Mitte
des Blattes zu begann, nur sie eingehend behandelte, und
das übrige, Bart, Haupthaar und Ohr, das sich übrigens
von dem Ohr auf dem Gemälde wesentlich unterscheidet,
nur flüchtig dazu gab. Voll hat festgestellt, daß Dürer die
Gestalten des Markus und Petrus erst nachträglich den
Bildern hinzugefügt hat. Als er sich während der Arbeit
zu diesen Zusätzen entschloß und irn Anschluß daran
Änderungen am Kopfe des Paulus für nötig hielt, entstanden
gleichzeitig diese drei Zeichnungen. Der Johannes war
bereits gemalt und wurde nicht verändert. Damit erklärt
es sich, daß nicht auch für seinen Kopf eine Werkzeichnung
aus diesem Arbeitsstadium bekannt ist. Elfried Bock.
London. — Erwerbungen der Kupferstichsammlung
des Britischen Museums, Jänner bis Juni 1909.
Zeichnungen.
Italienische Schule, Ende des XIV. Jahrhunderts:
Zwei heilige Frauen stützen die Jungfrau Maria; Silberstift
auf Purpurgrund. — A. Canale: London Bridge. Inneres
eines Gefängnisses. — R. Canta Gallina: Zwei Land-
schaften. — F. Guardi: Weib, eine Spindel haltend. —G.
B. Tiepolo: Neptun. Delphin und Seegötter. — C. Engel-
brechtsen: Augustus und die tiburtinische Sibylle. —
J. Scorel: Landschaft, signiert, ähnlich dem Hintergrund
des jüngst vom Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin er-
worbenen Bildnisses. — P. Bruegel I.: Landschaft mit hei-
ligem Hieronymus; Originalzeichnung zur Radierung, Van
Bastelaer 7. Italienische Landschaft, 1553. — J. DeGheyn:
Landschaft; Federzeichnung, 1600. — J. Jordaens: Ein
Reicher gibt einer armen Familie Almosen. — D. Teniers:
Affen in einem Atelier, 1064. — G. Coques: Familien-
gruppe. — A. Altdorfer: St. Barbara; Feder und Pinsel
gehöht mit Weiß, auf braunem Grund. — H. Holbein
(nach): Um 1526 datierte Kopie nach der Zeichnung eines
Bischofs im Baseler Museum. — W. Huber: Blatt eines
Skizzenbuches mit landschaftlichen Federzeichnungen auf
beiden Seiten, 1536. Landschaft; Federzeichnung, der
Vordergrund rot und grün getönt. — H. Leu I.: Die Jung-
frau Maria im Tempel, 1510. — H. L. Schäufelein: Ein
Bischof, dem Papst ein Buch darbringend; Federzeichnung.
— Nachahmer Dürers (H. Bol?): Landschaft; Aquarell.
— J. Siberechts: Landschaft. — T. Barker: Zwölf
Skizzen. — J. S. Copley: Skizze zu einem Reiterbildnis.
— T. L. Dickinson: 24 Bleistiftporträte. - A.T. De vis:
Zwei Landschaften. — J. Fulleylove: Zimmer im Tower
von London; Aquarell. — H. Ospovat: Fünf Zeichnungen
für Buchillustrationen, — J. Skelton (f zu Rom, 1758):