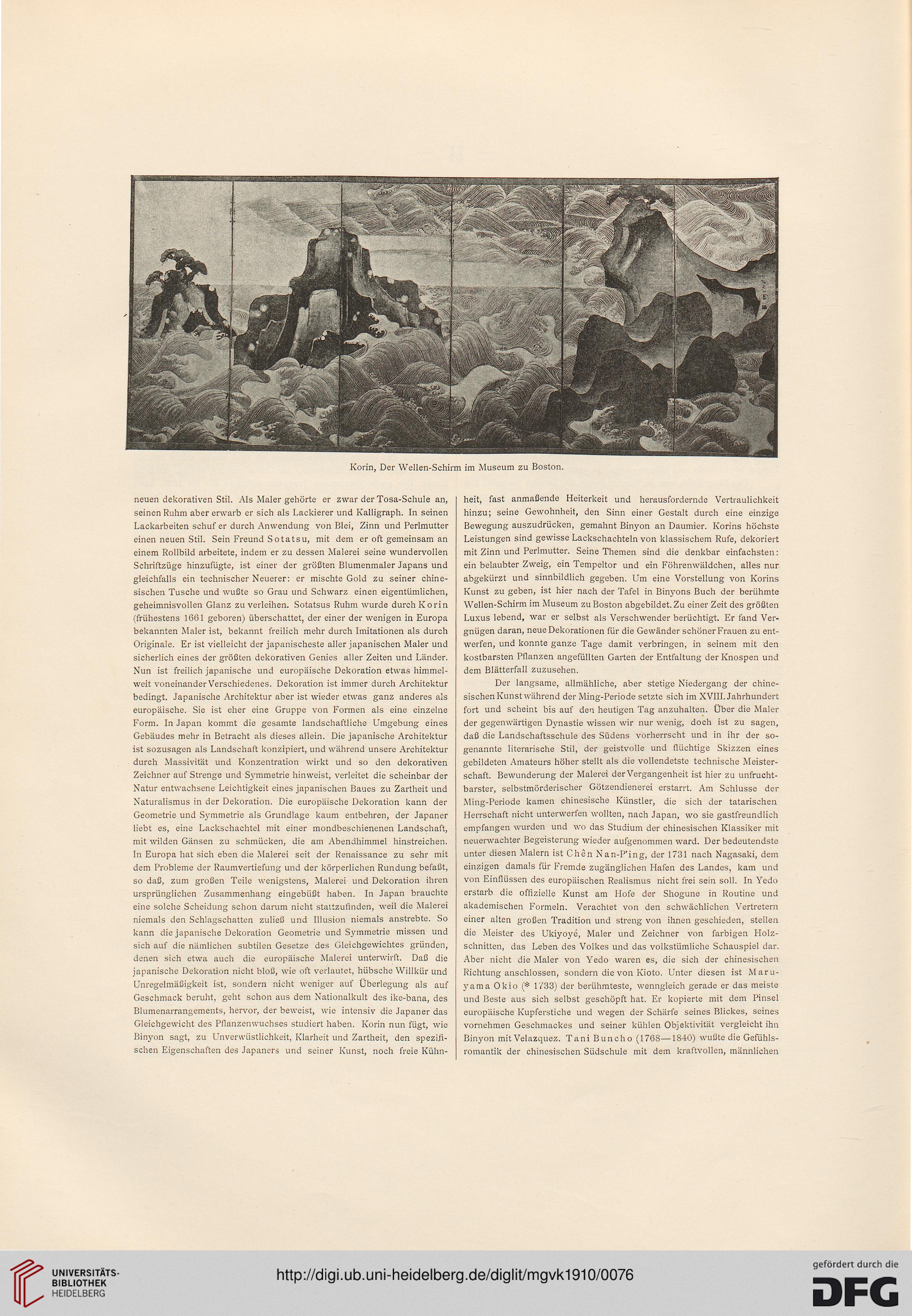Korin, Der Wellen-Schirm im Museum zu Boston.
neuen dekorativen Stil. Als Maler gehörte er zwar der Tosa-Schule an,
seinen Ruhm aber erwarb er sich als Lackierer und Kalligraph. In seinen
Lackarbeiten schuf er durch Anwendung von Blei, Zinn und Perlmutter
einen neuen Stil. Sein Freund Sotatsu, mit dem er oft gemeinsam an
einem Rollbild arbeitete, indem er zu dessen Malerei seine wundervollen
Schriftzüge hinzufügte, ist einer der größten Blumenmaler Japans und
gleichfalls ein technischer Neuerer: er mischte Gold zu seiner chine-
sischen Tusche und wußte so Grau und Schwarz einen eigentümlichen,
geheimnisvollen Glanz zu verleihen. Sotatsus Ruhm wurde durch Korin
(frühestens 1661 geboren) überschattet, der einer der wenigen in Europa
bekannten Maler ist, bekannt freilich mehr durch Imitationen als durch
Originale. Er ist vielleicht der japanischeste aller japanischen Maler und
sicherlich eines der größten dekorativen Genies aller Zeiten und Länder.
Nun ist freilich japanische und europäische Dekoration etwas himmel-
weit voneinander Verschiedenes. Dekoration ist immer durch Architektur
bedingt. Japanische Architektur aber ist wieder etwas ganz anderes als
europäische. Sie ist eher eine Gruppe von Formen als eine einzelne
Form. In Japan kommt die gesamte landschaftliche Umgebung eines
Gebäudes mehr in Betracht als dieses allein. Die japanische Architektur
ist sozusagen als Landschaft konzipiert, und während unsere Architektur
durch Massivität und Konzentration wirkt und so den dekorativen
Zeichner auf Strenge und Symmetrie hinweist, verleitet die scheinbar der
Natur entwachsene Leichtigkeit eines japanischen Baues zu Zartheit und
Naturalismus in der Dekoration. Die europäische Dekoration kann der
Geometrie und Symmetrie als Grundlage kaum entbehren, der Japaner
liebt es, eine Lackschachtel mit einer mondbeschienenen Landschaft,
mit wilden Gänsen zu schmücken, die am Abendhimmel hinstreichen.
In Europa hat sich eben die Malerei seit der Renaissance zu sehr mit
dem Probleme der Raumvertiefung und der körperlichen Rundung befaßt,
so daß, zum großen Teile wenigstens, Malerei und Dekoration ihren
ursprünglichen Zusammenhang eingebüßt haben. In Japan brauchte
eine solche Scheidung schon darum nicht stattzufinden, weil die Malerei
niemals den Schlagschatten zuließ und Illusion niemals anstrebte. So
kann die japanische Dekoration Geometrie und Symmetrie missen und
sich auf die nämlichen subtilen Gesetze des Gleichgewichtes gründen,
denen sich etwa auch die europäische Malerei unterwirft. Daß die
japanische Dekoration nicht bloß, wie oft verlautet, hübsche Willkür und
Unregelmäßigkeit ist, sondern nicht weniger auf Überlegung als auf
Geschmack beruht, geht schon aus dem Nationalkult des ike-bana, des
Blumenarrangements, hervor, der beweist, wie intensiv die Japaner das
Gleichgewicht des Pflanzenwuchses studiert haben. Korin nun fügt, wie
Binyon sagt, zu Unverwüstlichkeit, Klarheit und Zartheit, den spezifi-
schen Eigenschaften des Japaners und seiner Kunst, noch freie Kühn-
heit, fast anmaßende Heiterkeit und herausfordernde Vertraulichkeit
hinzu; seine Gewohnheit, den Sinn einer Gestalt durch eine einzige
Bewegung auszudrücken, gemahnt Binyon an Daumier. Korins höchste
Leistungen sind gewisse Lackschachteln von klassischem Rufe, dekoriert
mit Zinn und Perlmutter. Seine Themen sind die denkbar einfachsten:
ein belaubter Zweig, ein Tempeltor und ein Föhrenwäldchen, alles nur
abgekürzt und sinnbildlich gegeben. Um eine Vorstellung von Korins
Kunst zu geben, ist hier nach der Tafel in Binyons Buch der berühmte
Wellen-Schirm im Museum zu Boston abgebildet. Zu einer Zeit des größten
Luxus lebend, war er selbst als Verschwender berüchtigt. Er fand Ver-
gnügen daran, neue Dekorationen für die Gewänder schöner Frauen zu ent-
werfen, und konnte ganze Tage damit verbringen, in seinem mit den
kostbarsten Pflanzen angefüllten Garten der Entfaltung der Knospen und
dem Blätterfall zuzusehen.
Der langsame, allmähliche, aber stetige Niedergang der chine-
sischen Kunst während der Ming-Periode setzte sich im XVIII. Jahrhundert
fort und scheint bis auf den heutigen Tag anzuhalten. Über die Maler
der gegenwärtigen Dynastie wissen wir nur wenig, doch ist zu sagen,
daß die Landschaftsschule des Südens vorherrscht und in ihr der so-
genannte literarische Stil, der geistvolle und flüchtige Skizzen eines
gebildeten Amateurs höher stellt als die vollendetste technische Meister-
schaft. Bewunderung der Malerei der Vergangenheit ist hier zu unfrucht-
barster, selbstmörderischer Götzendienerei erstarrt. Am Schlüsse der
Ming-Periode kamen chinesische Künstler, die sich der tatarischen
Herrschaft nicht unterwerfen wollten, nach Japan, wo sie gastfreundlich
empfangen wurden und wo das Studium der chinesischen Klassiker mit
neuerwachter Begeisterung wieder aufgenommen ward. Der bedeutendste
unter diesen Malern ist Chen Nan-P'ing, der 1731 nach Nagasaki, dem
einzigen damals für Fremde zugänglichen Hafen des Landes, kam und
von Einflüssen des europäischen Realismus nicht frei sein soll. In Yedo
erstarb die offizielle Kunst am Hofe der Shogune in Routine und
akademischen Formeln. Verachtet von den schwächlichen Vertretern
einer alten großen Tradition und streng von ihnen geschieden, stellen
die Meister des Ukiyoye, Maler und Zeichner von farbigen Holz-
schnitten, das Leben des Volkes und das volkstümliche Schauspiel dar.
Aber nicht die Maler von Yedo waren es, die sich der chinesischen
Richtung anschlössen, sondern die von Kioto. Unter diesen ist Maru-
yama Okio (* 1733) der berühmteste, wenngleich gerade er das meiste
und Beste aus sich selbst geschöpft hat. Er kopierte mit dem Pinsel
europäische Kupferstiche und wegen der Schärfe seines Blickes, seines
vornehmen Geschmackes und seiner kühlen Objektivität vergleicht ihn
Binyon mit Velazquez. TaniBuncho (1768—1840) wußte die Gefühls-
romantik der chinesischen Südschule mit dem kraftvollen, männlichen
neuen dekorativen Stil. Als Maler gehörte er zwar der Tosa-Schule an,
seinen Ruhm aber erwarb er sich als Lackierer und Kalligraph. In seinen
Lackarbeiten schuf er durch Anwendung von Blei, Zinn und Perlmutter
einen neuen Stil. Sein Freund Sotatsu, mit dem er oft gemeinsam an
einem Rollbild arbeitete, indem er zu dessen Malerei seine wundervollen
Schriftzüge hinzufügte, ist einer der größten Blumenmaler Japans und
gleichfalls ein technischer Neuerer: er mischte Gold zu seiner chine-
sischen Tusche und wußte so Grau und Schwarz einen eigentümlichen,
geheimnisvollen Glanz zu verleihen. Sotatsus Ruhm wurde durch Korin
(frühestens 1661 geboren) überschattet, der einer der wenigen in Europa
bekannten Maler ist, bekannt freilich mehr durch Imitationen als durch
Originale. Er ist vielleicht der japanischeste aller japanischen Maler und
sicherlich eines der größten dekorativen Genies aller Zeiten und Länder.
Nun ist freilich japanische und europäische Dekoration etwas himmel-
weit voneinander Verschiedenes. Dekoration ist immer durch Architektur
bedingt. Japanische Architektur aber ist wieder etwas ganz anderes als
europäische. Sie ist eher eine Gruppe von Formen als eine einzelne
Form. In Japan kommt die gesamte landschaftliche Umgebung eines
Gebäudes mehr in Betracht als dieses allein. Die japanische Architektur
ist sozusagen als Landschaft konzipiert, und während unsere Architektur
durch Massivität und Konzentration wirkt und so den dekorativen
Zeichner auf Strenge und Symmetrie hinweist, verleitet die scheinbar der
Natur entwachsene Leichtigkeit eines japanischen Baues zu Zartheit und
Naturalismus in der Dekoration. Die europäische Dekoration kann der
Geometrie und Symmetrie als Grundlage kaum entbehren, der Japaner
liebt es, eine Lackschachtel mit einer mondbeschienenen Landschaft,
mit wilden Gänsen zu schmücken, die am Abendhimmel hinstreichen.
In Europa hat sich eben die Malerei seit der Renaissance zu sehr mit
dem Probleme der Raumvertiefung und der körperlichen Rundung befaßt,
so daß, zum großen Teile wenigstens, Malerei und Dekoration ihren
ursprünglichen Zusammenhang eingebüßt haben. In Japan brauchte
eine solche Scheidung schon darum nicht stattzufinden, weil die Malerei
niemals den Schlagschatten zuließ und Illusion niemals anstrebte. So
kann die japanische Dekoration Geometrie und Symmetrie missen und
sich auf die nämlichen subtilen Gesetze des Gleichgewichtes gründen,
denen sich etwa auch die europäische Malerei unterwirft. Daß die
japanische Dekoration nicht bloß, wie oft verlautet, hübsche Willkür und
Unregelmäßigkeit ist, sondern nicht weniger auf Überlegung als auf
Geschmack beruht, geht schon aus dem Nationalkult des ike-bana, des
Blumenarrangements, hervor, der beweist, wie intensiv die Japaner das
Gleichgewicht des Pflanzenwuchses studiert haben. Korin nun fügt, wie
Binyon sagt, zu Unverwüstlichkeit, Klarheit und Zartheit, den spezifi-
schen Eigenschaften des Japaners und seiner Kunst, noch freie Kühn-
heit, fast anmaßende Heiterkeit und herausfordernde Vertraulichkeit
hinzu; seine Gewohnheit, den Sinn einer Gestalt durch eine einzige
Bewegung auszudrücken, gemahnt Binyon an Daumier. Korins höchste
Leistungen sind gewisse Lackschachteln von klassischem Rufe, dekoriert
mit Zinn und Perlmutter. Seine Themen sind die denkbar einfachsten:
ein belaubter Zweig, ein Tempeltor und ein Föhrenwäldchen, alles nur
abgekürzt und sinnbildlich gegeben. Um eine Vorstellung von Korins
Kunst zu geben, ist hier nach der Tafel in Binyons Buch der berühmte
Wellen-Schirm im Museum zu Boston abgebildet. Zu einer Zeit des größten
Luxus lebend, war er selbst als Verschwender berüchtigt. Er fand Ver-
gnügen daran, neue Dekorationen für die Gewänder schöner Frauen zu ent-
werfen, und konnte ganze Tage damit verbringen, in seinem mit den
kostbarsten Pflanzen angefüllten Garten der Entfaltung der Knospen und
dem Blätterfall zuzusehen.
Der langsame, allmähliche, aber stetige Niedergang der chine-
sischen Kunst während der Ming-Periode setzte sich im XVIII. Jahrhundert
fort und scheint bis auf den heutigen Tag anzuhalten. Über die Maler
der gegenwärtigen Dynastie wissen wir nur wenig, doch ist zu sagen,
daß die Landschaftsschule des Südens vorherrscht und in ihr der so-
genannte literarische Stil, der geistvolle und flüchtige Skizzen eines
gebildeten Amateurs höher stellt als die vollendetste technische Meister-
schaft. Bewunderung der Malerei der Vergangenheit ist hier zu unfrucht-
barster, selbstmörderischer Götzendienerei erstarrt. Am Schlüsse der
Ming-Periode kamen chinesische Künstler, die sich der tatarischen
Herrschaft nicht unterwerfen wollten, nach Japan, wo sie gastfreundlich
empfangen wurden und wo das Studium der chinesischen Klassiker mit
neuerwachter Begeisterung wieder aufgenommen ward. Der bedeutendste
unter diesen Malern ist Chen Nan-P'ing, der 1731 nach Nagasaki, dem
einzigen damals für Fremde zugänglichen Hafen des Landes, kam und
von Einflüssen des europäischen Realismus nicht frei sein soll. In Yedo
erstarb die offizielle Kunst am Hofe der Shogune in Routine und
akademischen Formeln. Verachtet von den schwächlichen Vertretern
einer alten großen Tradition und streng von ihnen geschieden, stellen
die Meister des Ukiyoye, Maler und Zeichner von farbigen Holz-
schnitten, das Leben des Volkes und das volkstümliche Schauspiel dar.
Aber nicht die Maler von Yedo waren es, die sich der chinesischen
Richtung anschlössen, sondern die von Kioto. Unter diesen ist Maru-
yama Okio (* 1733) der berühmteste, wenngleich gerade er das meiste
und Beste aus sich selbst geschöpft hat. Er kopierte mit dem Pinsel
europäische Kupferstiche und wegen der Schärfe seines Blickes, seines
vornehmen Geschmackes und seiner kühlen Objektivität vergleicht ihn
Binyon mit Velazquez. TaniBuncho (1768—1840) wußte die Gefühls-
romantik der chinesischen Südschule mit dem kraftvollen, männlichen