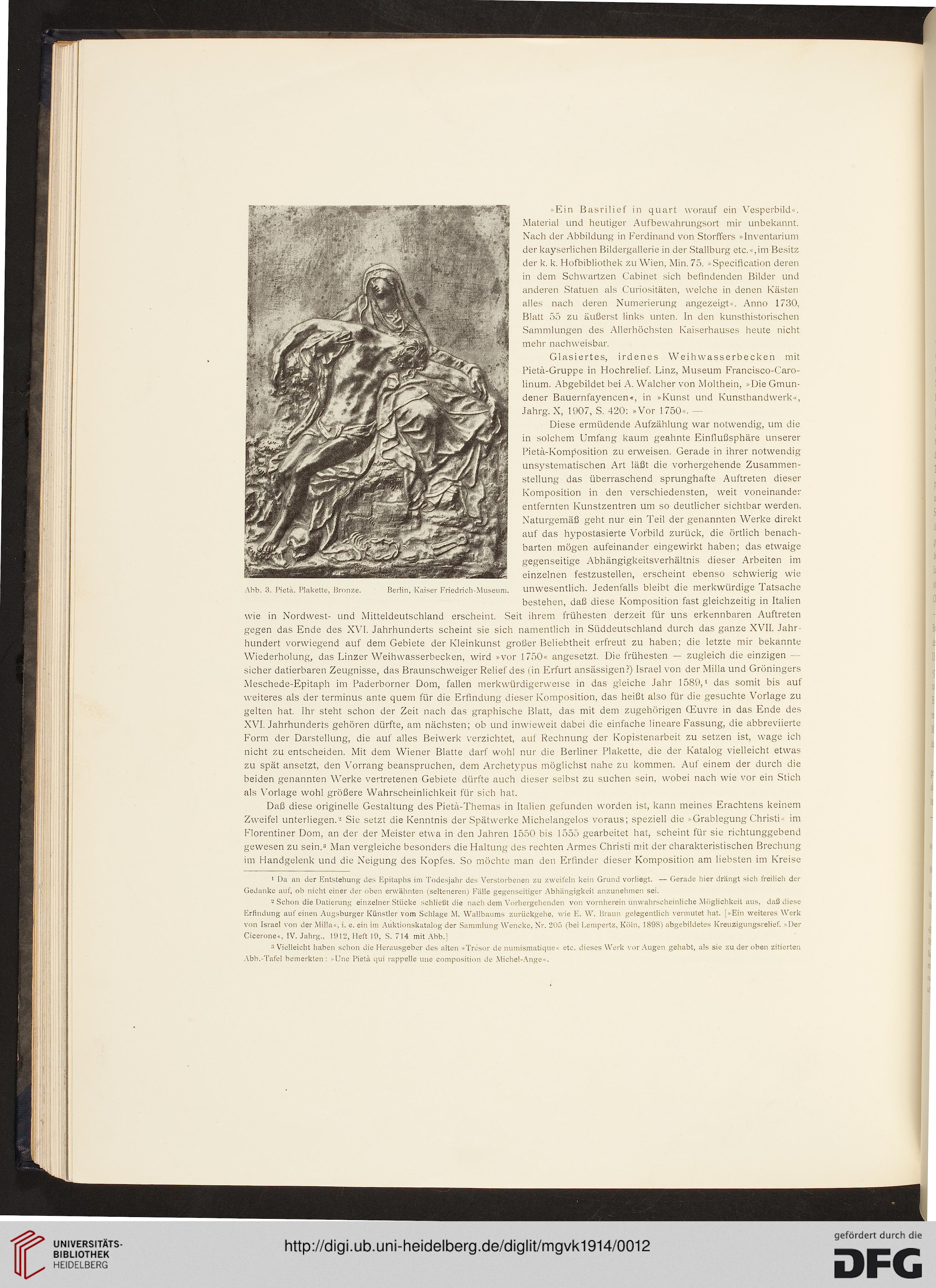»Ein Basrilief in quart worauf ein Vesperbild«.
Material und heutiger Aufbewahrungsort mir unbekannt.
Nach der Abbildung in Ferdinand von Storffers »Inventarium
der kayserlichen Bildergallerie in der Stallburg etc.«,im Besitz
der k. k. Hofbibliothek zu Wien, Min. 75. »Specification deren
in dem Schwartzen Cabinet sich befindenden Bilder und
anderen Statuen als Curiositäten, welche in denen Kästen
alles nach deren Numerierung angezeigt«. Anno 1730,
Blatt 55 zu äußerst links unten. In den kunsthistorischen
Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses heute nicht
mehr nachweisbar.
Glasiertes, irdenes Weihwasserbecken mit
Pietä-Gruppe in Hochrelief. Linz, Museum Francisco-Caro-
linum. Abgebildet bei A. Walcher von Molthein, »Die Gmun-
dener Bauernfayencen«, in »Kunst und Kunsthandwerk«,
Jahrg. X, 1907, S. 420: »Vor 1750«. —
Diese ermüdende Aufzählung war notwendig, um die
in solchem Umfang kaum geahnte Einflußsphäre unserer
Pietä-Komposition zu erweisen. Gerade in ihrer notwendig
unsystematischen Art läßt die vorhergehende Zusammen-
stellung das überraschend sprunghafte Auftreten dieser
Komposition in den verschiedensten, weit voneinander
entfernten Kunstzentren um so deutlicher sichtbar werden.
Naturgemäß geht nur ein Teil der genannten Werke direkt
auf das hypostasierte Vorbild zurück, die örtlich benach-
barten mögen aufeinander eingewirkt haben; das etwaige
gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis dieser Arbeiten im
einzelnen festzustellen, erscheint ebenso schwierig wie
unwesentlich. Jedenfalls bleibt die merkwürdige Tatsache
bestehen, daß diese Komposition fast gleichzeitig in Italien
wie in Nordwest- und Mitteldeutschland erscheint. Seit ihrem frühesten derzeit für uns erkennbaren Auftreten
gegen das Ende des XVI. Jahrhunderts scheint sie sich namentlich in Süddeutschland durch das ganze XVII. Jahr-
hundert vorwiegend auf dem Gebiete der Kleinkunst großer Beliebtheit erfreut zu haben; die letzte mir bekannte
Wiederholung, das Linzer Weihwasserbecken, wird »vor 1750« angesetzt. Die frühesten — zugleich die einzigen -
sicher datierbaren Zeugnisse, das Braunschweiger Relief des (in Erfurt ansässigen?) Israel von der Milla und Gröningers
Meschede-Epitaph im Paderborner Dom, fallen merkwürdigerweise in das gleiche Jahr 1589,1 das somit bis auf
weiteres als der terminus ante quem für die Erfindung dieser Komposition, das heißt also für die gesuchte Vorlage zu
gelten hat. Ihr steht schon der Zeit nach das graphische Blatt, das mit dem zugehörigen GEuvre in das Ende des
XVI. Jahrhunderts gehören dürfte, am nächsten; ob und inwieweit dabei die einfache lineare Fassung, die abbreviierte
Form der Darstellung, die auf alles Beiwerk verzichtet, auf Rechnung der Kopistenarbeit zu setzen ist, wage ich
nicht zu entscheiden. Mit dem Wiener Blatte darf wohl nur die Berliner Plakette, die der Katalog vielleicht etwas
zu spät ansetzt, den Vorrang beanspruchen, dem Archetypus möglichst nahe zu kommen. Auf einem der durch die
beiden genannten Werke vertretenen Gebiete dürfte auch dieser selbst zu suchen sein, wobei nach wie vor ein Stich
als Vorlage wohl größere Wahrscheinlichkeit für sich hat.
Daß diese originelle Gestaltung des Pietä-Themas in Italien gefunden worden ist, kann meines Erachtens keinem
Zweifel unterliegen. - Sie setzt die Kenntnis der Spätwerke Michelangelos voraus; speziell die »Grablegung Christi« im
Florentiner Dom, an der der Meister etwa in den Jahren 1550 bis 1 555 gearbeitet hat, scheint für sie richtunggebend
gewesen zu sein.:i Man vergleiche besonders die Haltung des rechten Armes Christi mit der charakteristischen Brechung
im Handgelenk und die Neigung des Kopfes. So möchte man den Erfinder dieser Komposition am liebsten im Kreise
i Da an der Entstehung des Epitaphs im Todesjahr des Verstorbenen zu zweifeln kein Grund vorliegt. — Gerade hier drängt sich freilich der
Gedanke auf, ob nicht einer der oben erwähnten (selteneren) Fälle gegenseitiger Abhängigkeit anzunehmen sei.
~ Schon die Datierung einzelner Stücke schließt die nach dem Vorhergehenden von vornherein unwahrscheinliche .Möglichkeit aus, daß diese
Erfindung auf einen Augsburger Künstler vom Schlage M. Wallbaums zurückgehe, wie E. W. Braun gelegentlich vermutet hat. [»Ein weiteres Werk
von Israel von der Milla«. i. e. ein im Auktionskatalog der Sammlung Wencke, Nr. 205 (bei l.empertz, Köln, 1898) abgebildetes Kreuzigungsrelief. »Der
Cicerone«. IV. Jahrg., 1012, Heft 10, S. 714 mit Abb.]
:l Vielleicht haben schon die Herausgeber des alten »Tresor de numismatique« etc. dieses Werk vor Augen gehabt, als sie zu der oben zitierten
Abb.-Tafel bemerkten: »Une Pieta qui rappelle une compositum de Michel-Ange«.
Abb. 3. Pietä. Plakette, Bronze. Berlin, Kaiser Friedrich-Museum.
Material und heutiger Aufbewahrungsort mir unbekannt.
Nach der Abbildung in Ferdinand von Storffers »Inventarium
der kayserlichen Bildergallerie in der Stallburg etc.«,im Besitz
der k. k. Hofbibliothek zu Wien, Min. 75. »Specification deren
in dem Schwartzen Cabinet sich befindenden Bilder und
anderen Statuen als Curiositäten, welche in denen Kästen
alles nach deren Numerierung angezeigt«. Anno 1730,
Blatt 55 zu äußerst links unten. In den kunsthistorischen
Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses heute nicht
mehr nachweisbar.
Glasiertes, irdenes Weihwasserbecken mit
Pietä-Gruppe in Hochrelief. Linz, Museum Francisco-Caro-
linum. Abgebildet bei A. Walcher von Molthein, »Die Gmun-
dener Bauernfayencen«, in »Kunst und Kunsthandwerk«,
Jahrg. X, 1907, S. 420: »Vor 1750«. —
Diese ermüdende Aufzählung war notwendig, um die
in solchem Umfang kaum geahnte Einflußsphäre unserer
Pietä-Komposition zu erweisen. Gerade in ihrer notwendig
unsystematischen Art läßt die vorhergehende Zusammen-
stellung das überraschend sprunghafte Auftreten dieser
Komposition in den verschiedensten, weit voneinander
entfernten Kunstzentren um so deutlicher sichtbar werden.
Naturgemäß geht nur ein Teil der genannten Werke direkt
auf das hypostasierte Vorbild zurück, die örtlich benach-
barten mögen aufeinander eingewirkt haben; das etwaige
gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis dieser Arbeiten im
einzelnen festzustellen, erscheint ebenso schwierig wie
unwesentlich. Jedenfalls bleibt die merkwürdige Tatsache
bestehen, daß diese Komposition fast gleichzeitig in Italien
wie in Nordwest- und Mitteldeutschland erscheint. Seit ihrem frühesten derzeit für uns erkennbaren Auftreten
gegen das Ende des XVI. Jahrhunderts scheint sie sich namentlich in Süddeutschland durch das ganze XVII. Jahr-
hundert vorwiegend auf dem Gebiete der Kleinkunst großer Beliebtheit erfreut zu haben; die letzte mir bekannte
Wiederholung, das Linzer Weihwasserbecken, wird »vor 1750« angesetzt. Die frühesten — zugleich die einzigen -
sicher datierbaren Zeugnisse, das Braunschweiger Relief des (in Erfurt ansässigen?) Israel von der Milla und Gröningers
Meschede-Epitaph im Paderborner Dom, fallen merkwürdigerweise in das gleiche Jahr 1589,1 das somit bis auf
weiteres als der terminus ante quem für die Erfindung dieser Komposition, das heißt also für die gesuchte Vorlage zu
gelten hat. Ihr steht schon der Zeit nach das graphische Blatt, das mit dem zugehörigen GEuvre in das Ende des
XVI. Jahrhunderts gehören dürfte, am nächsten; ob und inwieweit dabei die einfache lineare Fassung, die abbreviierte
Form der Darstellung, die auf alles Beiwerk verzichtet, auf Rechnung der Kopistenarbeit zu setzen ist, wage ich
nicht zu entscheiden. Mit dem Wiener Blatte darf wohl nur die Berliner Plakette, die der Katalog vielleicht etwas
zu spät ansetzt, den Vorrang beanspruchen, dem Archetypus möglichst nahe zu kommen. Auf einem der durch die
beiden genannten Werke vertretenen Gebiete dürfte auch dieser selbst zu suchen sein, wobei nach wie vor ein Stich
als Vorlage wohl größere Wahrscheinlichkeit für sich hat.
Daß diese originelle Gestaltung des Pietä-Themas in Italien gefunden worden ist, kann meines Erachtens keinem
Zweifel unterliegen. - Sie setzt die Kenntnis der Spätwerke Michelangelos voraus; speziell die »Grablegung Christi« im
Florentiner Dom, an der der Meister etwa in den Jahren 1550 bis 1 555 gearbeitet hat, scheint für sie richtunggebend
gewesen zu sein.:i Man vergleiche besonders die Haltung des rechten Armes Christi mit der charakteristischen Brechung
im Handgelenk und die Neigung des Kopfes. So möchte man den Erfinder dieser Komposition am liebsten im Kreise
i Da an der Entstehung des Epitaphs im Todesjahr des Verstorbenen zu zweifeln kein Grund vorliegt. — Gerade hier drängt sich freilich der
Gedanke auf, ob nicht einer der oben erwähnten (selteneren) Fälle gegenseitiger Abhängigkeit anzunehmen sei.
~ Schon die Datierung einzelner Stücke schließt die nach dem Vorhergehenden von vornherein unwahrscheinliche .Möglichkeit aus, daß diese
Erfindung auf einen Augsburger Künstler vom Schlage M. Wallbaums zurückgehe, wie E. W. Braun gelegentlich vermutet hat. [»Ein weiteres Werk
von Israel von der Milla«. i. e. ein im Auktionskatalog der Sammlung Wencke, Nr. 205 (bei l.empertz, Köln, 1898) abgebildetes Kreuzigungsrelief. »Der
Cicerone«. IV. Jahrg., 1012, Heft 10, S. 714 mit Abb.]
:l Vielleicht haben schon die Herausgeber des alten »Tresor de numismatique« etc. dieses Werk vor Augen gehabt, als sie zu der oben zitierten
Abb.-Tafel bemerkten: »Une Pieta qui rappelle une compositum de Michel-Ange«.
Abb. 3. Pietä. Plakette, Bronze. Berlin, Kaiser Friedrich-Museum.