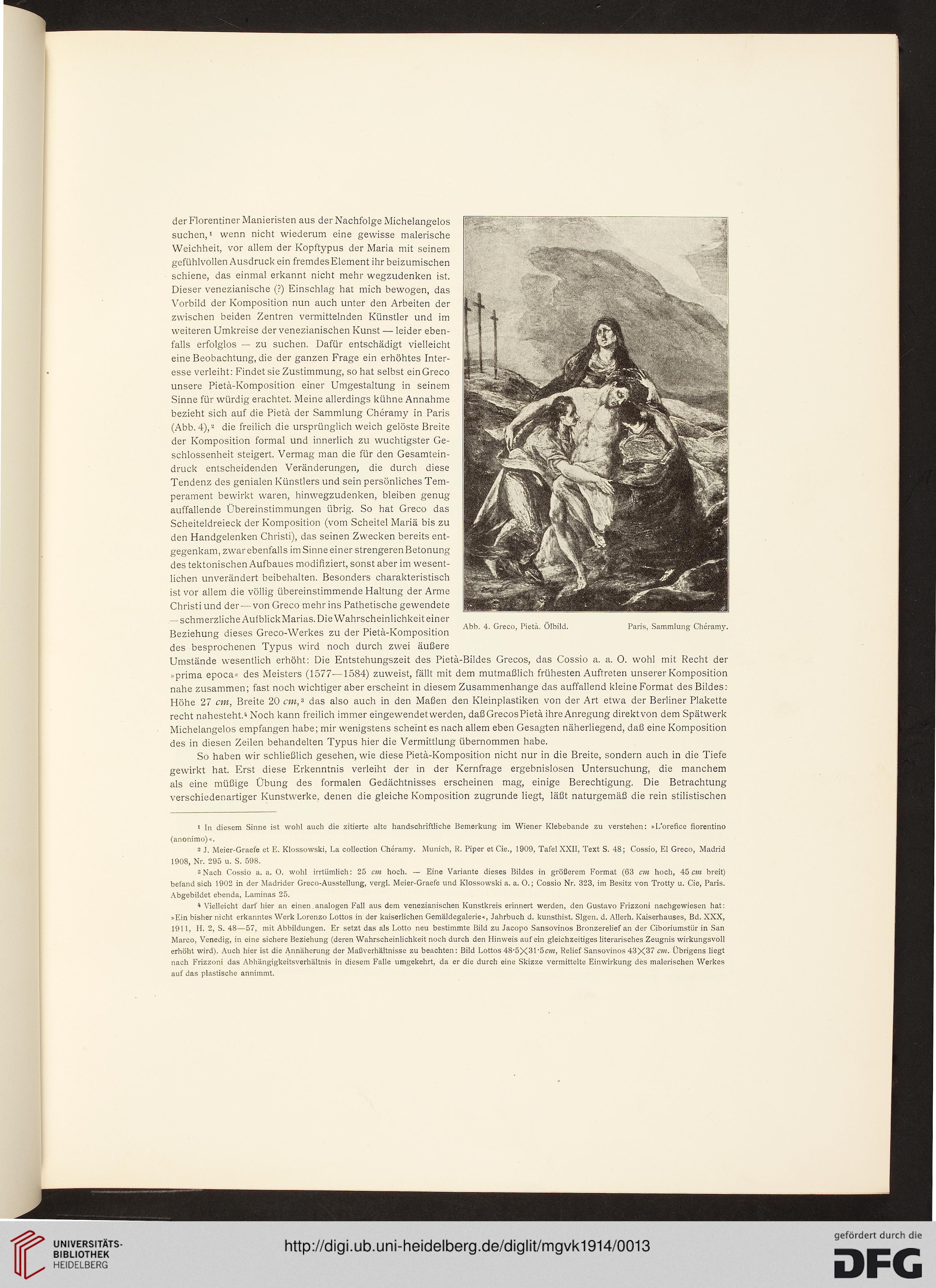der Florentiner Manieristen aus der Nachfolge Michelangelos
suchen,1 wenn nicht wiederum eine gewisse malerische
Weichheit, vor allem der Kopftypus der Maria mit seinem
gefühlvollen Ausdruck ein fremdes Element ihr beizumischen
schiene, das einmal erkannt nicht mehr wegzudenken ist.
Dieser venezianische (?) Einschlag hat mich bewogen, das
Vorbild der Komposition nun auch unter den Arbeiten der
zwischen beiden Zentren vermittelnden Künstler und im
weiteren Umkreise der venezianischen Kunst —■ leider eben-
falls erfolglos — zu suchen. Dafür entschädigt vielleicht
eine Beobachtung, die der ganzen Frage ein erhöhtes Inter-
esse verleiht: Findet sie Zustimmung, so hat selbst einGreco
unsere Pietä-Komposition einer Umgestaltung in seinem
Sinne für würdig erachtet. Meine allerdings kühne Annahme
bezieht sich auf die Pietä der Sammlung Cheramy in Paris
(Abb. 4),2 die freilich die ursprünglich weich gelöste Breite
der Komposition formal und innerlich zu wuchtigster Ge-
schlossenheit steigert. Vermag man die für den Gesamtein-
druck entscheidenden Veränderungen, die durch diese
Tendenz des genialen Künstlers und sein persönliches Tem-
perament bewirkt waren, hinwegzudenken, bleiben genug
auffallende Übereinstimmungen übrig. So hat Greco das
Scheiteldreieck der Komposition (vom Scheitel Maria bis zu
den Handgelenken Christi), das seinen Zwecken bereits ent-
gegenkam, zwar ebenfalls imSinneeinerstrengerenBetonung
des tektonischen Aufbaues modifiziert, sonst aber im wesent-
lichen unverändert beibehalten. Besonders charakteristisch
ist vor allem die völlig übereinstimmende Haltung der Arme
Christi und der — von Greco mehr ins Pathetische gewendete
— schmerzliche Auf blickMarias. DieWahrscheinlichkeit einer
Beziehung dieses Greco-Werkes zu der Pietä-Komposition
des besprochenen Typus wird noch durch zwei äußere
Umstände wesentlich erhöht: Die Entstehungszeit des Pietä-Bildes Grecos, das Cossio a. a. 0. wohl mit Recht der
»prima epoca« des Meisters (1577-—1584) zuweist, fällt mit dem mutmaßlich frühesten Auftreten unserer Komposition
nahe zusammen; fast noch wichtiger aber erscheint in diesem Zusammenhange das auffallend kleine Format des Bildes:-
Höhe 27 cm, Breite 20 cm,3 das also auch in den Maßen den Kleinplastiken von der Art etwa der Berliner Plakette
recht nahesteht.11 Noch kann freilich immer eingewendet werden, daßGrecosPietä ihre Anregung direktvon dem Spätwerk
Michelangelos empfangen habe; mir wenigstens scheint es nach allem eben Gesagten näherliegend, daß eine Komposition
des in diesen Zeilen behandelten Typus hier die Vermittlung übernommen habe.
So haben wir schließlich gesehen, wie diese Pietä-Komposition nicht nur in die Breite, sondern auch in die Tiefe
gewirkt hat. Erst diese Erkenntnis verleiht der in der Kernfrage ergebnislosen Untersuchung, die manchem
als eine müßige Übung des formalen Gedächtnisses erscheinen mag, einige Berechtigung. Die Betrachtung
verschiedenartiger Kunstwerke, denen die gleiche Komposition zugrunde liegt, läßt naturgemäß die rein stilistischen
1 In diesem Sinne ist wohl auch die zitierte alte handschriftliche Bemerkung im Wiener Klebebande zu verstehen: »L'orefice fiorentino
(anonimo)«.
2 J. Meier-Graefe et E. Klossowski, La collection Cheramy. Munich, R. Piper et Cie., 1909, Tafel XXII, Text S. 48; Cossio, El Greco, Madrid
1908, Nr. 295 u. S. 598.
s Nach Cossio a. a. 0. wohl irrtümlich: 25 cm hoch. — Eine Variante dieses Bildes in größerem Format (63 cm hoch, 45 cm breit)
befand sich 1902 in der Madrider Greco-Ausstellung, vergl. Meier-Graefe und Klossowski a. a. O.; Cossio Nr. 323, im Besitz von Trotty u. Cie, Paris.
Abgebildet ebenda, Laminas 25.
* Vielleicht darf hier an einen.analogen Fall aus dem venezianischen Kunstkreis erinnert werden, den Gustavo Frizzoni nachgewiesen hat:
»Ein bisher nicht erkanntes Werk Lorenzo Lottos in der kaiserlichen Gemäldegalerie«, Jahrbuch d. kunsthist. Slgen. d. Allerh. Kaiserhauses, Bd. XXX,
1911, H. 2, S. 48—57, mit Abbildungen. Er setzt das als Lotto neu bestimmte Bild zu Jacopo Sansovinos Bronzerelief an der Ciboriumstür in San
Marco, Venedig, in eine sichere Beziehung (deren Wahrscheinlichkeit noch durch den Hinweis auf ein gleichzeitiges literarisches Zeugnis wirkungsvoll
erhöht wird). Auch hier ist die Annäherung der Maßverhältnisse zu beachten: Bild Lottos 48'5X31 m5cm, Relief Sansovinos 43X37 cm. Übrigens liegt
nach Frizzoni das Abhängigkeitsverhältnis in diesem Falle umgekehrt, da er die durch eine Skizze vermittelte Einwirkung des malerischen Werkes
auf das plastische annimmt.
suchen,1 wenn nicht wiederum eine gewisse malerische
Weichheit, vor allem der Kopftypus der Maria mit seinem
gefühlvollen Ausdruck ein fremdes Element ihr beizumischen
schiene, das einmal erkannt nicht mehr wegzudenken ist.
Dieser venezianische (?) Einschlag hat mich bewogen, das
Vorbild der Komposition nun auch unter den Arbeiten der
zwischen beiden Zentren vermittelnden Künstler und im
weiteren Umkreise der venezianischen Kunst —■ leider eben-
falls erfolglos — zu suchen. Dafür entschädigt vielleicht
eine Beobachtung, die der ganzen Frage ein erhöhtes Inter-
esse verleiht: Findet sie Zustimmung, so hat selbst einGreco
unsere Pietä-Komposition einer Umgestaltung in seinem
Sinne für würdig erachtet. Meine allerdings kühne Annahme
bezieht sich auf die Pietä der Sammlung Cheramy in Paris
(Abb. 4),2 die freilich die ursprünglich weich gelöste Breite
der Komposition formal und innerlich zu wuchtigster Ge-
schlossenheit steigert. Vermag man die für den Gesamtein-
druck entscheidenden Veränderungen, die durch diese
Tendenz des genialen Künstlers und sein persönliches Tem-
perament bewirkt waren, hinwegzudenken, bleiben genug
auffallende Übereinstimmungen übrig. So hat Greco das
Scheiteldreieck der Komposition (vom Scheitel Maria bis zu
den Handgelenken Christi), das seinen Zwecken bereits ent-
gegenkam, zwar ebenfalls imSinneeinerstrengerenBetonung
des tektonischen Aufbaues modifiziert, sonst aber im wesent-
lichen unverändert beibehalten. Besonders charakteristisch
ist vor allem die völlig übereinstimmende Haltung der Arme
Christi und der — von Greco mehr ins Pathetische gewendete
— schmerzliche Auf blickMarias. DieWahrscheinlichkeit einer
Beziehung dieses Greco-Werkes zu der Pietä-Komposition
des besprochenen Typus wird noch durch zwei äußere
Umstände wesentlich erhöht: Die Entstehungszeit des Pietä-Bildes Grecos, das Cossio a. a. 0. wohl mit Recht der
»prima epoca« des Meisters (1577-—1584) zuweist, fällt mit dem mutmaßlich frühesten Auftreten unserer Komposition
nahe zusammen; fast noch wichtiger aber erscheint in diesem Zusammenhange das auffallend kleine Format des Bildes:-
Höhe 27 cm, Breite 20 cm,3 das also auch in den Maßen den Kleinplastiken von der Art etwa der Berliner Plakette
recht nahesteht.11 Noch kann freilich immer eingewendet werden, daßGrecosPietä ihre Anregung direktvon dem Spätwerk
Michelangelos empfangen habe; mir wenigstens scheint es nach allem eben Gesagten näherliegend, daß eine Komposition
des in diesen Zeilen behandelten Typus hier die Vermittlung übernommen habe.
So haben wir schließlich gesehen, wie diese Pietä-Komposition nicht nur in die Breite, sondern auch in die Tiefe
gewirkt hat. Erst diese Erkenntnis verleiht der in der Kernfrage ergebnislosen Untersuchung, die manchem
als eine müßige Übung des formalen Gedächtnisses erscheinen mag, einige Berechtigung. Die Betrachtung
verschiedenartiger Kunstwerke, denen die gleiche Komposition zugrunde liegt, läßt naturgemäß die rein stilistischen
1 In diesem Sinne ist wohl auch die zitierte alte handschriftliche Bemerkung im Wiener Klebebande zu verstehen: »L'orefice fiorentino
(anonimo)«.
2 J. Meier-Graefe et E. Klossowski, La collection Cheramy. Munich, R. Piper et Cie., 1909, Tafel XXII, Text S. 48; Cossio, El Greco, Madrid
1908, Nr. 295 u. S. 598.
s Nach Cossio a. a. 0. wohl irrtümlich: 25 cm hoch. — Eine Variante dieses Bildes in größerem Format (63 cm hoch, 45 cm breit)
befand sich 1902 in der Madrider Greco-Ausstellung, vergl. Meier-Graefe und Klossowski a. a. O.; Cossio Nr. 323, im Besitz von Trotty u. Cie, Paris.
Abgebildet ebenda, Laminas 25.
* Vielleicht darf hier an einen.analogen Fall aus dem venezianischen Kunstkreis erinnert werden, den Gustavo Frizzoni nachgewiesen hat:
»Ein bisher nicht erkanntes Werk Lorenzo Lottos in der kaiserlichen Gemäldegalerie«, Jahrbuch d. kunsthist. Slgen. d. Allerh. Kaiserhauses, Bd. XXX,
1911, H. 2, S. 48—57, mit Abbildungen. Er setzt das als Lotto neu bestimmte Bild zu Jacopo Sansovinos Bronzerelief an der Ciboriumstür in San
Marco, Venedig, in eine sichere Beziehung (deren Wahrscheinlichkeit noch durch den Hinweis auf ein gleichzeitiges literarisches Zeugnis wirkungsvoll
erhöht wird). Auch hier ist die Annäherung der Maßverhältnisse zu beachten: Bild Lottos 48'5X31 m5cm, Relief Sansovinos 43X37 cm. Übrigens liegt
nach Frizzoni das Abhängigkeitsverhältnis in diesem Falle umgekehrt, da er die durch eine Skizze vermittelte Einwirkung des malerischen Werkes
auf das plastische annimmt.