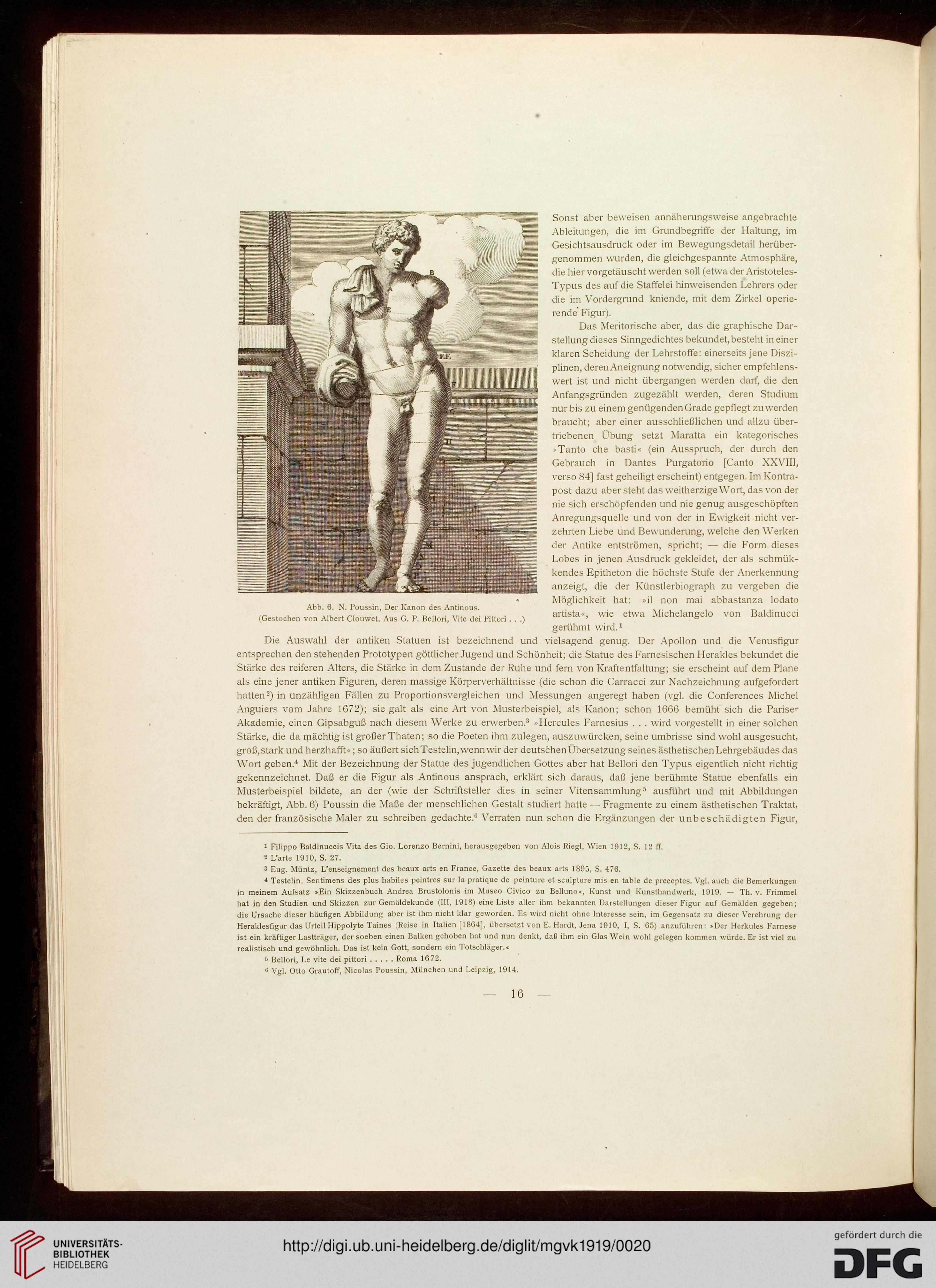Sonst aber beweisen annäherungsweise angebrachte
Ableitungen, die im Grundbegriffe der Haltung, im
Gesichtsausdruck oder im Bewegungsdetail herüber-
genommen wurden, die gleichgespannte Atmosphäre,
die hier vorgetäuscht werden soll (etwa der Aristoteles-
Typus des auf die Staffelei hinweisenden Lehrers oder
die im Vordergrund kniende, mit dem Zirkel operie-
rende Figur).
Das Meritorische aber, das die graphische Dar-
stellung dieses Sinngedichtes bekundet,besteht in einer
klaren Scheidung der Lehrstoffe: einerseits jene Diszi-
plinen, derenAneignung notwendig, sicher empfehlens-
wert ist und nicht übergangen werden darf, die den
Anfangsgründen zugezählt werden, deren Studium
nur bis zu einem genügenden Grade gepflegt zu werden
braucht; aber einer ausschließlichen und allzu über-
triebenen Übung setzt Maratta ein kategorisches
»Tanto che basti« (ein Ausspruch, der durch den
Gebrauch in Dantes Purgatorio [Canto XXVIII,
verso 84] fast geheiligt erscheint) entgegen. Im Kontra-
post dazu aber steht das weitherzige Wort, das von der
nie sich erschöpfenden und nie genug ausgeschöpften
Anregungsquelle und von der in Ewigkeit nicht ver-
zehrten Liebe und Bewunderung, welche den Werken
der Antike entströmen, spricht; — die Form dieses
Lobes in jenen Ausdruck gekleidet, der als schmük-
kendes Epitheton die höchste Stufe der Anerkennung
anzeigt, die der Künstlerbiograph zu vergeben die
Möglichkeit hat: »il non mai abbastanza lodato
artista«, wie etwa Michelangelo von Baldinucci
gerühmt wird.1
Die Auswahl der antiken Statuen ist bezeichnend und vielsagend genug. Der Apollon und die Venusfigur
entsprechen den stehenden Prototypen göttlicher Jugend und Schönheit; die Statue des Farnesischen Herakles bekundet die
Stärke des reiferen Alters, die Stärke in dem Zustande der Ruhe und fern von Kraftentfaltung; sie erscheint auf dem Plane
als eine jener antiken Figuren, deren massige Körperverhältnisse (die schon die Carracci zur Nachzeichnung aufgefordert
hatten2) in unzähligen Fällen zu Proportionsvergleichen und Messungen angeregt haben (vgl. die Conferences Michel
Anguiers vom Jahre 1672); sie galt als eine Art von Musterbeispiel, als Kanon; schon 1666 bemüht sich die Parise>-
Akademie, einen Gipsabguß nach diesem Werke zu erwerben.3 »Hercules Farnesius . . . wird vorgestellt in einer solchen
Stärke, die da mächtig ist großer Thaten; so die Poeten ihm zulegen, auszuwürcken, seine umbrisse sind wohl ausgesucht,
groß,stark und herzhafft«; so äußert sich Testelin, wenn wir der deutschen Übersetzung seines ästhetischen Lehrgebäudes das
Wort geben.4 Mit der Bezeichnung der Statue des jugendlichen Gottes aber hat Bellori den Typus eigentlich nicht richtig
gekennzeichnet. Daß er die Figur als Antinous ansprach, erklärt sich daraus, daß jene berühmte Statue ebenfalls ein
Musterbeispiel bildete, an der (wie der Schriftsteller dies in seiner Vitensammlung5 ausführt und mit Abbildungen
bekräftigt, Abb. 6) Poussin die Maße der menschlichen Gestalt studiert hatte — Fragmente zu einem ästhetischen Traktat,
den der französische Maler zu schreiben gedachte.0 Verraten nun schon die Ergänzungen der unbeschädigten Figur,
Abb. 6. N. Poussin, Der Kanon des Antinous.
(Gestochen von Albert Clouwet. Aus G. P. Bellori, Vite dei Pittori .
•)
1 Filippo Baldinuccis Vita des Gio. Lorenzo Bernini, herausgegeben von Alois Riegl, Wien 1912, S. 12 ff.
2 L'arte 1910, S. 27.
3 Eug. Müntz, L'enseignement des beaux arts en France, Gazette des beaux arts 1895, S. 476.
4 Testelin. Sentimens des plus habiles peintres sur la pratique de peinture et sculpture mis en table de preceptes. Vgl. auch die Bemerkungen
in meinem Aufsatz >Ein Skizzenbuch Andrea Brustolonis im Museo Civico zu Belluno«, Kunst und Kunsthandwerk, 1919. — Th. v. Frimmel
hat in den Studien und Skizzen zur Gemäldekunde (III, 1918) eine Liste aller ihm bekannten Darstellungen dieser Figur auf Gemiilden gegeben;
die Ursache dieser häufigen Abbildung aber ist ihm nicht klar geworden. Es wird nicht ohne Interesse sein, im Gegensatz zu dieser Verehrung der
Heraklesfigur das Urteil Hippolyte Taines (Reise in Italien [1864], übersetzt von E. Hardt, Jena 1910, I, S. 65) anzuführen: »Der Herkules Farnese
ist ein kräftiger Lastträger, der soeben einen Balken gehoben hat und nun denkt, daß ihm ein Glas Wein wohl gelegen kommen würde. Er ist viel zu
realistisch und gewöhnlich. Das ist kein Gott, sondern ein Totschläger.«
» Bellori, Le vite dei pittori.....Roma 1672.
>' Vgl. Otto Grautoff, Nicolas Poussin, München und Leipzig, 1914.
16
Ableitungen, die im Grundbegriffe der Haltung, im
Gesichtsausdruck oder im Bewegungsdetail herüber-
genommen wurden, die gleichgespannte Atmosphäre,
die hier vorgetäuscht werden soll (etwa der Aristoteles-
Typus des auf die Staffelei hinweisenden Lehrers oder
die im Vordergrund kniende, mit dem Zirkel operie-
rende Figur).
Das Meritorische aber, das die graphische Dar-
stellung dieses Sinngedichtes bekundet,besteht in einer
klaren Scheidung der Lehrstoffe: einerseits jene Diszi-
plinen, derenAneignung notwendig, sicher empfehlens-
wert ist und nicht übergangen werden darf, die den
Anfangsgründen zugezählt werden, deren Studium
nur bis zu einem genügenden Grade gepflegt zu werden
braucht; aber einer ausschließlichen und allzu über-
triebenen Übung setzt Maratta ein kategorisches
»Tanto che basti« (ein Ausspruch, der durch den
Gebrauch in Dantes Purgatorio [Canto XXVIII,
verso 84] fast geheiligt erscheint) entgegen. Im Kontra-
post dazu aber steht das weitherzige Wort, das von der
nie sich erschöpfenden und nie genug ausgeschöpften
Anregungsquelle und von der in Ewigkeit nicht ver-
zehrten Liebe und Bewunderung, welche den Werken
der Antike entströmen, spricht; — die Form dieses
Lobes in jenen Ausdruck gekleidet, der als schmük-
kendes Epitheton die höchste Stufe der Anerkennung
anzeigt, die der Künstlerbiograph zu vergeben die
Möglichkeit hat: »il non mai abbastanza lodato
artista«, wie etwa Michelangelo von Baldinucci
gerühmt wird.1
Die Auswahl der antiken Statuen ist bezeichnend und vielsagend genug. Der Apollon und die Venusfigur
entsprechen den stehenden Prototypen göttlicher Jugend und Schönheit; die Statue des Farnesischen Herakles bekundet die
Stärke des reiferen Alters, die Stärke in dem Zustande der Ruhe und fern von Kraftentfaltung; sie erscheint auf dem Plane
als eine jener antiken Figuren, deren massige Körperverhältnisse (die schon die Carracci zur Nachzeichnung aufgefordert
hatten2) in unzähligen Fällen zu Proportionsvergleichen und Messungen angeregt haben (vgl. die Conferences Michel
Anguiers vom Jahre 1672); sie galt als eine Art von Musterbeispiel, als Kanon; schon 1666 bemüht sich die Parise>-
Akademie, einen Gipsabguß nach diesem Werke zu erwerben.3 »Hercules Farnesius . . . wird vorgestellt in einer solchen
Stärke, die da mächtig ist großer Thaten; so die Poeten ihm zulegen, auszuwürcken, seine umbrisse sind wohl ausgesucht,
groß,stark und herzhafft«; so äußert sich Testelin, wenn wir der deutschen Übersetzung seines ästhetischen Lehrgebäudes das
Wort geben.4 Mit der Bezeichnung der Statue des jugendlichen Gottes aber hat Bellori den Typus eigentlich nicht richtig
gekennzeichnet. Daß er die Figur als Antinous ansprach, erklärt sich daraus, daß jene berühmte Statue ebenfalls ein
Musterbeispiel bildete, an der (wie der Schriftsteller dies in seiner Vitensammlung5 ausführt und mit Abbildungen
bekräftigt, Abb. 6) Poussin die Maße der menschlichen Gestalt studiert hatte — Fragmente zu einem ästhetischen Traktat,
den der französische Maler zu schreiben gedachte.0 Verraten nun schon die Ergänzungen der unbeschädigten Figur,
Abb. 6. N. Poussin, Der Kanon des Antinous.
(Gestochen von Albert Clouwet. Aus G. P. Bellori, Vite dei Pittori .
•)
1 Filippo Baldinuccis Vita des Gio. Lorenzo Bernini, herausgegeben von Alois Riegl, Wien 1912, S. 12 ff.
2 L'arte 1910, S. 27.
3 Eug. Müntz, L'enseignement des beaux arts en France, Gazette des beaux arts 1895, S. 476.
4 Testelin. Sentimens des plus habiles peintres sur la pratique de peinture et sculpture mis en table de preceptes. Vgl. auch die Bemerkungen
in meinem Aufsatz >Ein Skizzenbuch Andrea Brustolonis im Museo Civico zu Belluno«, Kunst und Kunsthandwerk, 1919. — Th. v. Frimmel
hat in den Studien und Skizzen zur Gemäldekunde (III, 1918) eine Liste aller ihm bekannten Darstellungen dieser Figur auf Gemiilden gegeben;
die Ursache dieser häufigen Abbildung aber ist ihm nicht klar geworden. Es wird nicht ohne Interesse sein, im Gegensatz zu dieser Verehrung der
Heraklesfigur das Urteil Hippolyte Taines (Reise in Italien [1864], übersetzt von E. Hardt, Jena 1910, I, S. 65) anzuführen: »Der Herkules Farnese
ist ein kräftiger Lastträger, der soeben einen Balken gehoben hat und nun denkt, daß ihm ein Glas Wein wohl gelegen kommen würde. Er ist viel zu
realistisch und gewöhnlich. Das ist kein Gott, sondern ein Totschläger.«
» Bellori, Le vite dei pittori.....Roma 1672.
>' Vgl. Otto Grautoff, Nicolas Poussin, München und Leipzig, 1914.
16