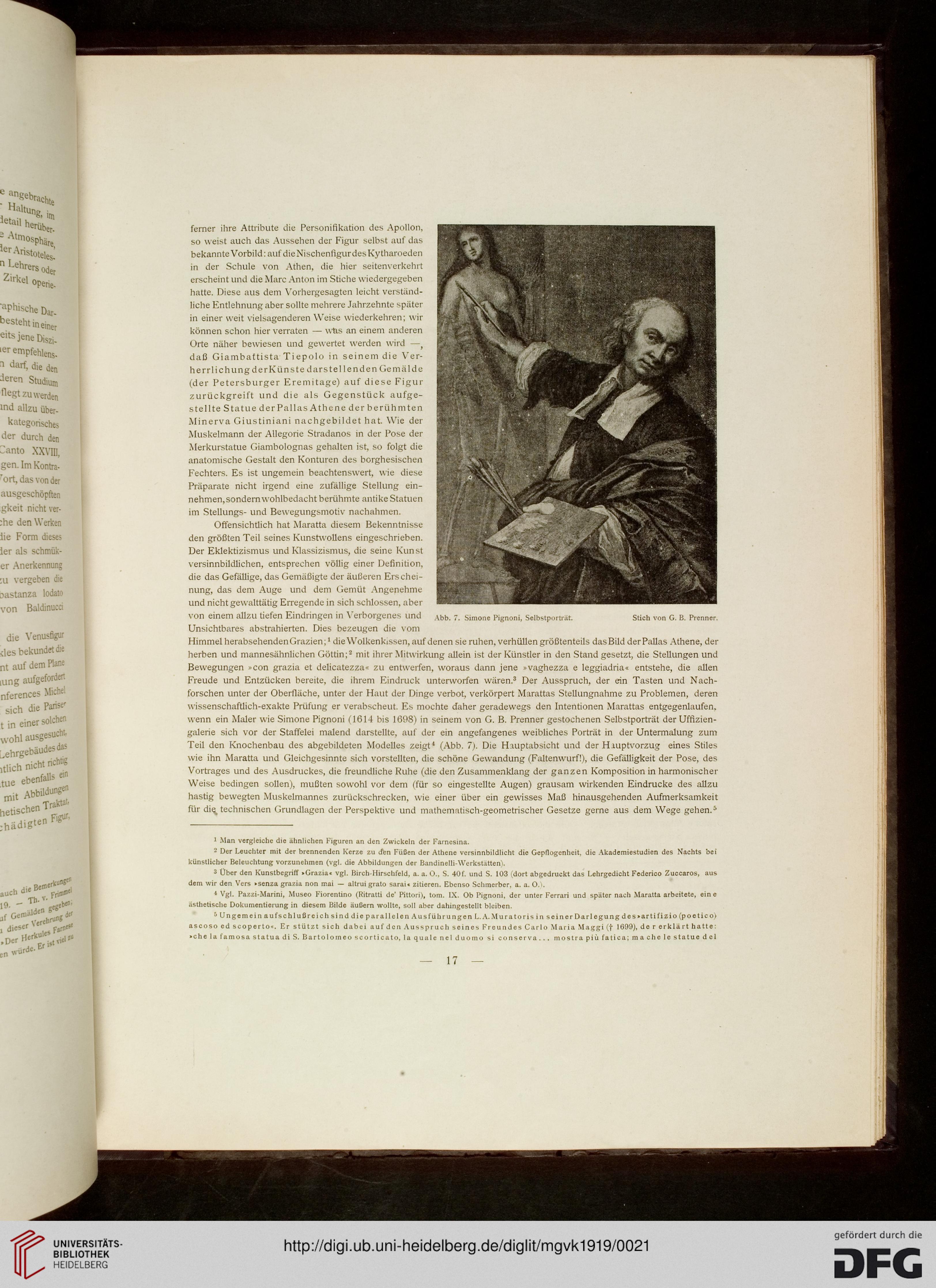H,lltung \n
; Alm°sphäre
ie[Aristoteles;
n L«hrers oder
Z,rkel opene-
■aphische Dar-
bestehtineiner
eitsJeneDjszi.
ierempfehlens.
1 <M die den
ieren Studium
legt zu werden
md allzu über-
kategi
der durch den
-anto XXVm,
gen. Im Kontra-
Tort,dasvonder
ausgeschöpften
gkeit nicht ver-
:he den Werken
lie Form dieses
ler als schmük-
er Anerkennung
:u vergeben die
oastanza lodato
von Baldinucci
die Venusfigur
des bekundet die
nt auf dem Plane
,ung aufgefordert
nferences Michel
sich die Panse'
t in einer solchen
wohl ausgesucht,
^ehrgebäudes das
rtlich nicht nchng
tue ebenfalls e.n
:hädigten Hg"
aUch^»t5
19. - ' „&&<*'
i i'e5er „< Fä""s
ferner ihre Attribute die Personifikation des Apollon,
so weist auch das Aussehen der Figur selbst auf das
bekannte Vorbild: auf die Nischenfigurdes Kytharoeden
in der Schule von Athen, die hier seitenverkehrt
erscheint und die Marc Anton im Stiche wiedergegeben
hatte. Diese aus dem Vorhergesagten leicht verständ-
liche Entlehnung aber sollte mehrere Jahrzehnte später
in einer weit vielsagenderen Weise wiederkehren; wir
können schon hier verraten — was an einem anderen
Orte näher bewiesen und gewertet werden wird —;
daß Giambattista Tiepolo in seinem die Ver-
herrlichung der Künste darstellenden Gemälde
(der Petersburger Eremitage) auf diese Figur
zurückgreift und die als Gegenstück aufge-
stellte Statue derPallasAthene derberühmten
Minerva Giustiniani nachgebildet hat. Wie der
Muskelmann der Allegorie Stradanos in der Pose der
Merkurstatue Giambolognas gehalten ist, so folgt die
anatomische Gestalt den Konturen des borghesischen
Fechters. Es ist ungemein beachtenswert, wie diese
Präparate nicht irgend eine zufällige Stellung ein-
nehmen, sondern wohlbedacht berühmte antike Statuen
im Stellungs- und Bewegungsmotiv nachahmen.
Offensichtlich hat Maratta diesem Bekenntnisse
den größten Teil seines Kunstwollens eingeschrieben.
Der Eklektizismus und Klassizismus, die seine Kunst
versinnbildlichen, entsprechen völlig einer Definition,
die das Gefällige, das Gemäßigte der äußeren Erschei-
nung, das dem Auge und dem Gemüt Angenehme
und nicht gewalttätig Erregende in sich schlössen, aber
von einem allzu tiefen Eindringen in Verborgenes und
Unsichtbares abstrahierten. Dies bezeugen die vom
Himmel herabsehendenGrazien;1 die Wolkenkissen, auf denen sie ruhen, verhüllen größtenteils das Bild der Pallas Athene, der
herben und mannesähnlichen Göttin;2 mit ihrer Mitwirkung allein ist der Künstler in den Stand gesetzt, die Stellungen und
Bewegungen »con grazia et delicatezza« zu entwerfen, woraus dann jene »vaghezza e leggiadria« entstehe, die allen
Freude und Entzücken bereite, die ihrem Eindruck unterworfen wären.3 Der Ausspruch, der ein Tasten und Nach-
forschen unter der Oberfläche, unter der Haut der Dinge verbot, verkörpert Marattas Stellungnahme zu Problemen, deren
wissenschaftlich-exakte Prüfung er verabscheut. Es mochte daher geradewegs den Intentionen Marattas entgegenlaufen.
wenn ein Maler wie Simone Pignoni (1614 bis 1698) in seinem von G. B. Prenner gestochenen Selbstporträt der Uffizien-
galerie sich vor der Staffelei malend darstellte, auf der ein angefangenes weibliches Porträt in der Untermalung zum
Teil den Knochenbau des abgebildeten Modelles zeigt* (Abb. 7). Die Hauptabsicht und der Hauptvorzug eines Stiles
wie ihn Maratta und Gleichgesinnte sich vorstellten, die schöne Gewandung (Faltenwurf!), die Gefälligkeit der Pose, des
Vortrages und des Ausdruckes, die freundliche Ruhe (die den Zusammenklang der ganzen Komposition in harmonischer
Weise bedingen sollen), mußten sowohl vor dem (für so eingestellte Augen) grausam wirkenden Eindrucke des allzu
hastig bewegten Muskelmannes zurückschrecken, wie einer über ein gewisses Maß hinausgehenden Aufmerksamkeit
für die, technischen Grundlagen der Perspektive und mathematisch-geometrischer Gesetze gerne aus dem Wege gehen.5
Abb.
Simone Pignoni, Selbstporträt.
Stich von G. B. Prenner.
1 Man vergleiche die ähnlichen Figuren an den Zwickeln der Farnesina.
- Der Leuchter mit der brennenden Kerze zu den Füßen der Athene versinnbildlicht die Gepflogenheit, die Akademiestudien des Nachts bei
künstlicher Beleuchtung vorzunehmen (vgl. die Abbildungen der Bandinelli-Werkstatteni.
3 Über den Kunstbegriff »Grazia« vgl. Birch-Hirschfeld, a. a. O.. S. 40f. und S. 103 (dort abgedruckt das Lehrgedicht Federico Zuccaros, aus
dem wir den Vers »senza grazia non mal — altrui grato Sarai« zitieren. Ebenso Schmerber, a. a. O.l.
* Vgl. Pazzi-Marini, Museo Fiorentino (Ritratti de' Pittori), tom. IX. Ob Pignoni, der unter Ferrari und später nach Maratta arbeitete, ein e
ästhetische Dokumentierung in diesem Bilde äußern wollte, soll aber dahingestellt bleiben.
5 Ungemein aufschlußreich sind die parallelen Ausführungen L.A.Muratoris in seinerDarlegungdes>artifizio(poetico)
ascosoedscoperto«. Er stützt sich dabei aufden Ausspruch seines Freundes Carlo Maria Maggi(f 1699), de r erklärt hatte:
»che la famosa statua di S. Bartolomeo scorticato, la quäle nel duomo si conserva . . . mostra piü fatica; m a che te statue d el
— 17 —
; Alm°sphäre
ie[Aristoteles;
n L«hrers oder
Z,rkel opene-
■aphische Dar-
bestehtineiner
eitsJeneDjszi.
ierempfehlens.
1 <M die den
ieren Studium
legt zu werden
md allzu über-
kategi
der durch den
-anto XXVm,
gen. Im Kontra-
Tort,dasvonder
ausgeschöpften
gkeit nicht ver-
:he den Werken
lie Form dieses
ler als schmük-
er Anerkennung
:u vergeben die
oastanza lodato
von Baldinucci
die Venusfigur
des bekundet die
nt auf dem Plane
,ung aufgefordert
nferences Michel
sich die Panse'
t in einer solchen
wohl ausgesucht,
^ehrgebäudes das
rtlich nicht nchng
tue ebenfalls e.n
:hädigten Hg"
aUch^»t5
19. - ' „&&<*'
i i'e5er „< Fä""s
ferner ihre Attribute die Personifikation des Apollon,
so weist auch das Aussehen der Figur selbst auf das
bekannte Vorbild: auf die Nischenfigurdes Kytharoeden
in der Schule von Athen, die hier seitenverkehrt
erscheint und die Marc Anton im Stiche wiedergegeben
hatte. Diese aus dem Vorhergesagten leicht verständ-
liche Entlehnung aber sollte mehrere Jahrzehnte später
in einer weit vielsagenderen Weise wiederkehren; wir
können schon hier verraten — was an einem anderen
Orte näher bewiesen und gewertet werden wird —;
daß Giambattista Tiepolo in seinem die Ver-
herrlichung der Künste darstellenden Gemälde
(der Petersburger Eremitage) auf diese Figur
zurückgreift und die als Gegenstück aufge-
stellte Statue derPallasAthene derberühmten
Minerva Giustiniani nachgebildet hat. Wie der
Muskelmann der Allegorie Stradanos in der Pose der
Merkurstatue Giambolognas gehalten ist, so folgt die
anatomische Gestalt den Konturen des borghesischen
Fechters. Es ist ungemein beachtenswert, wie diese
Präparate nicht irgend eine zufällige Stellung ein-
nehmen, sondern wohlbedacht berühmte antike Statuen
im Stellungs- und Bewegungsmotiv nachahmen.
Offensichtlich hat Maratta diesem Bekenntnisse
den größten Teil seines Kunstwollens eingeschrieben.
Der Eklektizismus und Klassizismus, die seine Kunst
versinnbildlichen, entsprechen völlig einer Definition,
die das Gefällige, das Gemäßigte der äußeren Erschei-
nung, das dem Auge und dem Gemüt Angenehme
und nicht gewalttätig Erregende in sich schlössen, aber
von einem allzu tiefen Eindringen in Verborgenes und
Unsichtbares abstrahierten. Dies bezeugen die vom
Himmel herabsehendenGrazien;1 die Wolkenkissen, auf denen sie ruhen, verhüllen größtenteils das Bild der Pallas Athene, der
herben und mannesähnlichen Göttin;2 mit ihrer Mitwirkung allein ist der Künstler in den Stand gesetzt, die Stellungen und
Bewegungen »con grazia et delicatezza« zu entwerfen, woraus dann jene »vaghezza e leggiadria« entstehe, die allen
Freude und Entzücken bereite, die ihrem Eindruck unterworfen wären.3 Der Ausspruch, der ein Tasten und Nach-
forschen unter der Oberfläche, unter der Haut der Dinge verbot, verkörpert Marattas Stellungnahme zu Problemen, deren
wissenschaftlich-exakte Prüfung er verabscheut. Es mochte daher geradewegs den Intentionen Marattas entgegenlaufen.
wenn ein Maler wie Simone Pignoni (1614 bis 1698) in seinem von G. B. Prenner gestochenen Selbstporträt der Uffizien-
galerie sich vor der Staffelei malend darstellte, auf der ein angefangenes weibliches Porträt in der Untermalung zum
Teil den Knochenbau des abgebildeten Modelles zeigt* (Abb. 7). Die Hauptabsicht und der Hauptvorzug eines Stiles
wie ihn Maratta und Gleichgesinnte sich vorstellten, die schöne Gewandung (Faltenwurf!), die Gefälligkeit der Pose, des
Vortrages und des Ausdruckes, die freundliche Ruhe (die den Zusammenklang der ganzen Komposition in harmonischer
Weise bedingen sollen), mußten sowohl vor dem (für so eingestellte Augen) grausam wirkenden Eindrucke des allzu
hastig bewegten Muskelmannes zurückschrecken, wie einer über ein gewisses Maß hinausgehenden Aufmerksamkeit
für die, technischen Grundlagen der Perspektive und mathematisch-geometrischer Gesetze gerne aus dem Wege gehen.5
Abb.
Simone Pignoni, Selbstporträt.
Stich von G. B. Prenner.
1 Man vergleiche die ähnlichen Figuren an den Zwickeln der Farnesina.
- Der Leuchter mit der brennenden Kerze zu den Füßen der Athene versinnbildlicht die Gepflogenheit, die Akademiestudien des Nachts bei
künstlicher Beleuchtung vorzunehmen (vgl. die Abbildungen der Bandinelli-Werkstatteni.
3 Über den Kunstbegriff »Grazia« vgl. Birch-Hirschfeld, a. a. O.. S. 40f. und S. 103 (dort abgedruckt das Lehrgedicht Federico Zuccaros, aus
dem wir den Vers »senza grazia non mal — altrui grato Sarai« zitieren. Ebenso Schmerber, a. a. O.l.
* Vgl. Pazzi-Marini, Museo Fiorentino (Ritratti de' Pittori), tom. IX. Ob Pignoni, der unter Ferrari und später nach Maratta arbeitete, ein e
ästhetische Dokumentierung in diesem Bilde äußern wollte, soll aber dahingestellt bleiben.
5 Ungemein aufschlußreich sind die parallelen Ausführungen L.A.Muratoris in seinerDarlegungdes>artifizio(poetico)
ascosoedscoperto«. Er stützt sich dabei aufden Ausspruch seines Freundes Carlo Maria Maggi(f 1699), de r erklärt hatte:
»che la famosa statua di S. Bartolomeo scorticato, la quäle nel duomo si conserva . . . mostra piü fatica; m a che te statue d el
— 17 —