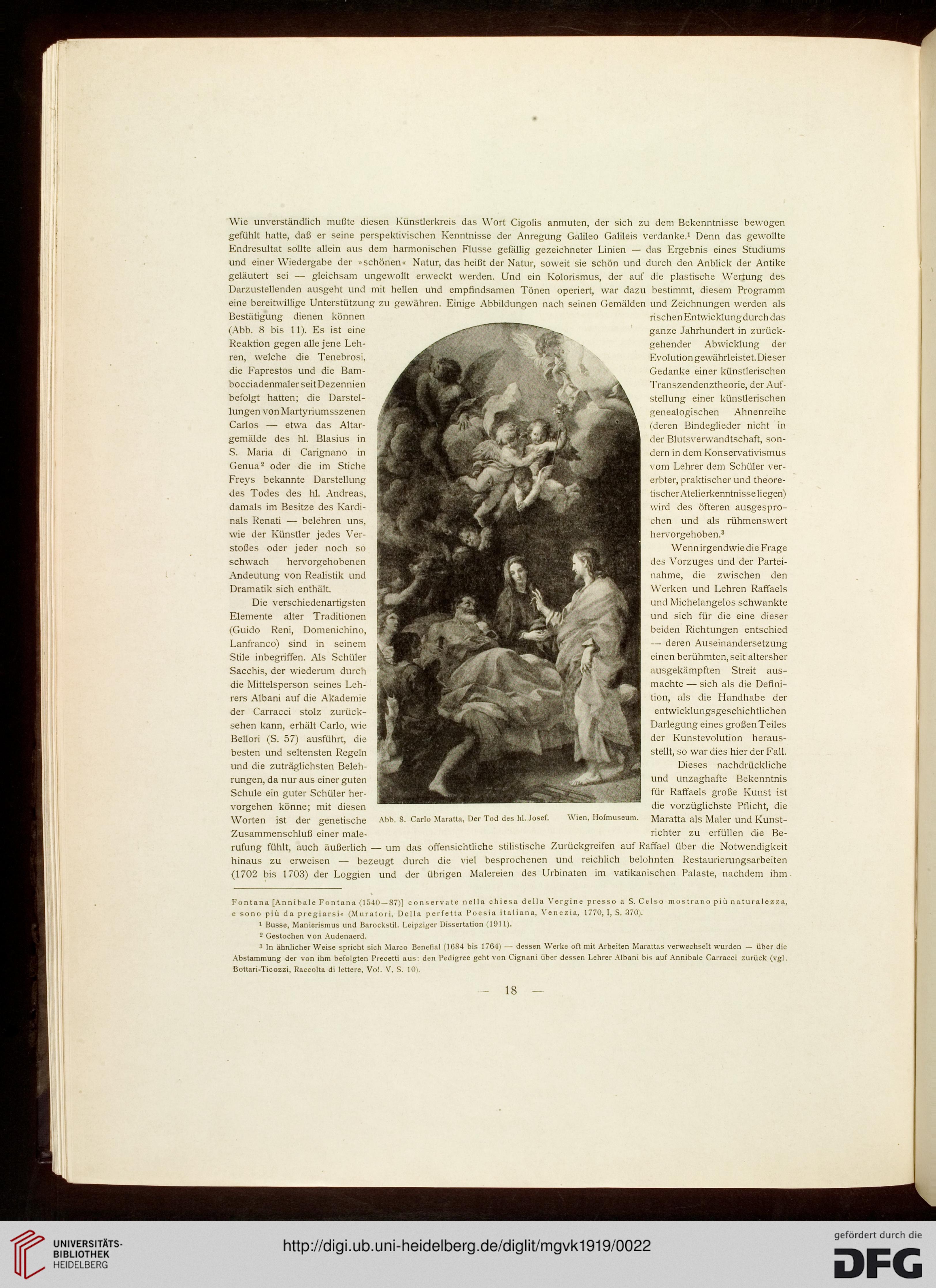Wie unverständlich mußte diesen Künstlerkreis das Wort Cigolis anmuten, der sich zu dem Bekenntnisse bewogen
gefühlt hatte, daß er seine perspektivischen Kenntnisse der Anregung Galileo Galileis verdanke.1 Denn das gewollte
Endresultat sollte allein aus dem harmonischen Flusse gefällig gezeichneter Linien — das Ergebnis eines Studiums
und einer Wiedergabe der »schönen« Natur, das heißt der Natur, soweit sie schön und durch den Anblick der Antike
geläutert sei — gleichsam ungewollt erweckt werden. Und ein Kolorismus, der auf die plastische Wertung des
Darzustellenden ausgeht und mit hellen und empfindsamen Tönen operiert, war dazu bestimmt, diesem Programm
eine bereitwillige Unterstützung zu gewähren. Einige Abbildungen nach seinen Gemälden und Zeichnungen werden als
Bestätigung dienen können
(Abb. 8 bis 11). Es ist eine
Reaktion gegen alle jene Leh-
ren, welche die Tenebrosi,
die Faprestos und die Bam-
bocciadenmaler seit Dezennien
befolgt hatten; die Darstel-
lungen von Martyriumsszenen
Carlos — etwa das Altar-
gemälde des hl. Blasius in
S. Maria di Carignano in
Genua2 oder die im Stiche
Freys bekannte Darstellung
des Todes des hl. Andreas,
damals im Besitze des Kardi-
nals Renati — belehren uns,
wie der Künstler jedes Ver-
stoßes oder jeder noch so
schwach hervorgehobenen
Andeutung von Realistik und
Dramatik sich enthält.
Die verschiedenartigsten
Elemente alter Traditionen
(Guido Reni, Domenichino,
Lanfranco) sind in seinem
Stile inbegriffen. Als Schüler
Sacchis, der wiederum durch
die Mittelsperson seines Leh-
rers Albani auf die Akademie
der Carracci stolz zurück-
sehen kann, erhält Carlo, wie
Bellori (S. 57) ausführt, die
besten und seltensten Regeln
und die zuträglichsten Beleh-
rungen, da nur aus einer guten
Schule ein guter Schüler her-
vorgehen könne; mit diesen
Worten ist der genetische
Zusammenschluß einer male-
rufung fühlt, auch äußerlich
rischen Entwicklung durch das
ganze Jahrhundert in zurück-
gehender Abwicklung der
Evolution gewährleistet. Dieser
Gedanke einer künstlerischen
Transzendenztheorie, der Auf-
stellung einer künstlerischen
genealogischen Ahnenreihe
(deren Bindeglieder nicht in
der Blutsverwandtschaft, son-
dern in dem Konservativismus
vom Lehrer dem Schüler ver-
erbter, praktischer und theore-
tischer Atelierkenntnisse liegen)
wird des öfteren ausgespro-
chen und als rühmenswert
hervorgehoben.3
Wenn irgendwie die Frage
des Vorzuges und der Partei-
nahme, die zwischen den
Werken und Lehren Raffaels
und Michelangelos schwankte
und sich für die eine dieser
beiden Richtungen entschied
— deren Auseinandersetzung
einen berühmten, seit altersher
ausgekämpften Streit aus-
machte — sich als die Defini-
tion, als die Handhabe der
entwicklungsgeschichtlichen
Darlegung eines großen Teiles
der Kunstevolution heraus-
stellt, so war dies hier der Fall.
Dieses nachdrückliche
und unzaghafte Bekenntnis
für Raffaels große Kunst ist
die vorzüglichste Pflicht, die
Maratta als Maler und Kunst-
richter zu erfüllen die Be-
um das offensichtliche stilistische Zurückgreifen auf Raffael über die Notwendigkeit
Abb. 8. Carlo Maratta, Der Tod des hl. Josef.
hinaus zu erweisen — bezeugt durch die viel besprochenen und reichlich belohnten Restaurierungsarbeiten
(1702 bis 1703) der Loggien und der übrigen Malereien des Urbinaten im vatikanischen Palaste, nachdem ihm
Fontana [Annibale Fontana (1540 — 87)] conservate nella chiesa della Vergine presso a S. Celso mostrano piii naturalezza,
e sono piü da pregiarsi« (Muratori, Della perfetta Poesia italiana. Venezia, 1770, I, S. 370).
1 Busse, Manierismus und Barockstil. Leipziger Dissertation (1911).
- Gestochen von Audenaerd.
3 In ähnlicher Weise spricht sich Marco Bcncfial (1684 bis 1764) — dessen Werke oft mit Arbeiten Maiattas verwechselt wurden — über die
Abstammung der von ihm befolgten Precetti aus: den Pcdigree geht von Cignani über dessen Lehrer Albani bis auf Annibale Carracci zurück (vgl.
Bottari-Ticozzi, Raccolta di lettere, Vo!. V. S. 10).
- 18 —
gefühlt hatte, daß er seine perspektivischen Kenntnisse der Anregung Galileo Galileis verdanke.1 Denn das gewollte
Endresultat sollte allein aus dem harmonischen Flusse gefällig gezeichneter Linien — das Ergebnis eines Studiums
und einer Wiedergabe der »schönen« Natur, das heißt der Natur, soweit sie schön und durch den Anblick der Antike
geläutert sei — gleichsam ungewollt erweckt werden. Und ein Kolorismus, der auf die plastische Wertung des
Darzustellenden ausgeht und mit hellen und empfindsamen Tönen operiert, war dazu bestimmt, diesem Programm
eine bereitwillige Unterstützung zu gewähren. Einige Abbildungen nach seinen Gemälden und Zeichnungen werden als
Bestätigung dienen können
(Abb. 8 bis 11). Es ist eine
Reaktion gegen alle jene Leh-
ren, welche die Tenebrosi,
die Faprestos und die Bam-
bocciadenmaler seit Dezennien
befolgt hatten; die Darstel-
lungen von Martyriumsszenen
Carlos — etwa das Altar-
gemälde des hl. Blasius in
S. Maria di Carignano in
Genua2 oder die im Stiche
Freys bekannte Darstellung
des Todes des hl. Andreas,
damals im Besitze des Kardi-
nals Renati — belehren uns,
wie der Künstler jedes Ver-
stoßes oder jeder noch so
schwach hervorgehobenen
Andeutung von Realistik und
Dramatik sich enthält.
Die verschiedenartigsten
Elemente alter Traditionen
(Guido Reni, Domenichino,
Lanfranco) sind in seinem
Stile inbegriffen. Als Schüler
Sacchis, der wiederum durch
die Mittelsperson seines Leh-
rers Albani auf die Akademie
der Carracci stolz zurück-
sehen kann, erhält Carlo, wie
Bellori (S. 57) ausführt, die
besten und seltensten Regeln
und die zuträglichsten Beleh-
rungen, da nur aus einer guten
Schule ein guter Schüler her-
vorgehen könne; mit diesen
Worten ist der genetische
Zusammenschluß einer male-
rufung fühlt, auch äußerlich
rischen Entwicklung durch das
ganze Jahrhundert in zurück-
gehender Abwicklung der
Evolution gewährleistet. Dieser
Gedanke einer künstlerischen
Transzendenztheorie, der Auf-
stellung einer künstlerischen
genealogischen Ahnenreihe
(deren Bindeglieder nicht in
der Blutsverwandtschaft, son-
dern in dem Konservativismus
vom Lehrer dem Schüler ver-
erbter, praktischer und theore-
tischer Atelierkenntnisse liegen)
wird des öfteren ausgespro-
chen und als rühmenswert
hervorgehoben.3
Wenn irgendwie die Frage
des Vorzuges und der Partei-
nahme, die zwischen den
Werken und Lehren Raffaels
und Michelangelos schwankte
und sich für die eine dieser
beiden Richtungen entschied
— deren Auseinandersetzung
einen berühmten, seit altersher
ausgekämpften Streit aus-
machte — sich als die Defini-
tion, als die Handhabe der
entwicklungsgeschichtlichen
Darlegung eines großen Teiles
der Kunstevolution heraus-
stellt, so war dies hier der Fall.
Dieses nachdrückliche
und unzaghafte Bekenntnis
für Raffaels große Kunst ist
die vorzüglichste Pflicht, die
Maratta als Maler und Kunst-
richter zu erfüllen die Be-
um das offensichtliche stilistische Zurückgreifen auf Raffael über die Notwendigkeit
Abb. 8. Carlo Maratta, Der Tod des hl. Josef.
hinaus zu erweisen — bezeugt durch die viel besprochenen und reichlich belohnten Restaurierungsarbeiten
(1702 bis 1703) der Loggien und der übrigen Malereien des Urbinaten im vatikanischen Palaste, nachdem ihm
Fontana [Annibale Fontana (1540 — 87)] conservate nella chiesa della Vergine presso a S. Celso mostrano piii naturalezza,
e sono piü da pregiarsi« (Muratori, Della perfetta Poesia italiana. Venezia, 1770, I, S. 370).
1 Busse, Manierismus und Barockstil. Leipziger Dissertation (1911).
- Gestochen von Audenaerd.
3 In ähnlicher Weise spricht sich Marco Bcncfial (1684 bis 1764) — dessen Werke oft mit Arbeiten Maiattas verwechselt wurden — über die
Abstammung der von ihm befolgten Precetti aus: den Pcdigree geht von Cignani über dessen Lehrer Albani bis auf Annibale Carracci zurück (vgl.
Bottari-Ticozzi, Raccolta di lettere, Vo!. V. S. 10).
- 18 —