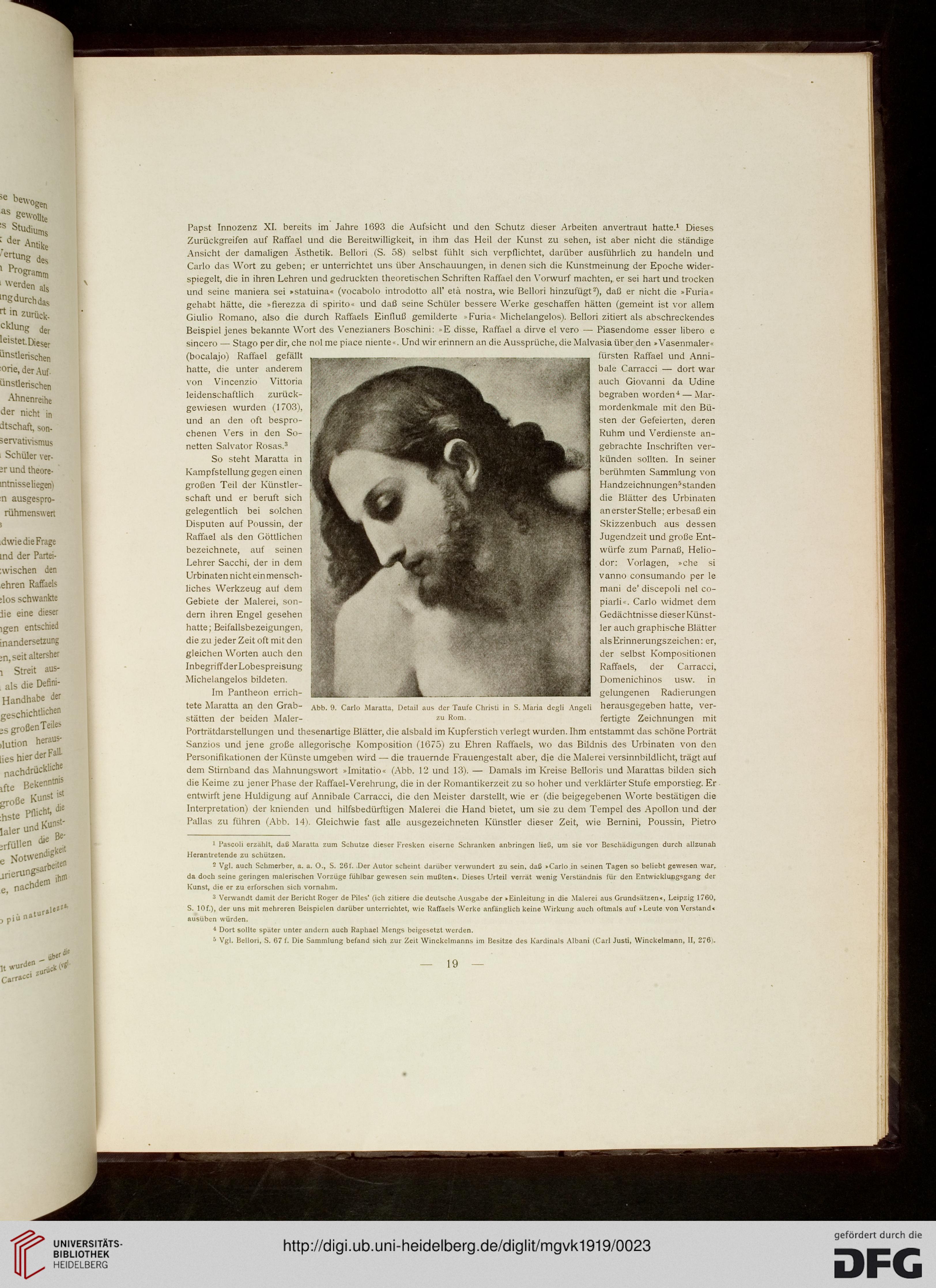* be*°gen
as 8e\voute
:s Odiums
:, der Antike
erU*g des
1 Pr°Pamm
1 Werden ak
lnSdurchdas
rt in zurück-
cklung der
'eistet. Dieser
tastlerischen
:0rie,derAuf
ünstlerischen
Ahnenreihe
der nicht in
dtschaft, son-
äervativismus
Schüler ver-
:r und theore-
intnisse liegen)
n ausgespro-
rühmenswert
i
.dwie die Frage
ind der Partei-
;\vischen den
ehren Raffaels
ilos schwankte
lie eine dieser
igen entschied
inandersetzung
m.seitaltersher
« Streit aus-
als die Deflni-
Handhabe der
geschichtlichen
;SgroßenTeite
jution heraus-
ües hier der Fall
nachdrücklich^
lfte Bekennt
hstePüi*^
laier und Kun^
-füi,en ii
6 N°tWlSten
-.üb*'0
Papst Innozenz XI. bereits im Jahre 1693 die Aufsicht und den Schutz dieser Arbeiten anvertraut hatte.1 Dieses
Zurückgreifen auf Raffael und die Bereitwilligkeit, in ihm das Heil der Kunst zu sehen, ist aber nicht die ständige
Ansicht der damaligen Ästhetik. Bellori (S. 58) selbst fühlt sich verpflichtet, darüber ausführlich zu handeln und
Carlo das Wort zu geben; er unterrichtet uns über Anschauungen, in denen sich die Kunstmeinung der Epoche wider-
spiegelt, die in ihren Lehren und gedruckten theoretischen Schriften Raffael den Vorwurf machten, er sei hart und trocken
und seine maniera sei »statuina« (vocabolo introdotto all' etä nostra, wie Bellori hinzufügt2), daß er nicht die »Furia«
gehabt hätte, die »fierezza di spirito« und daß seine Schüler bessere Werke geschaffen hätten (gemeint ist vor allem
Giulio Romano, also die durch Raffaels Einfluß gemilderte »Furia« Michelangelos). Bellori zitiert als abschreckendes
Beispiel jenes bekannte Wort des Venezianers Boschini: »E disse, Raffael a dirve el vero — Piasendome esser libero e
sincero — Stagoperdir, che nolmepiace niente«. Und wir erinnern an die Aussprüche, die Malvasia über den »Vasenmaler«
(bocalajo) Raffael gefällt
hatte, die unter anderem
von Vincenzio Vittoria
leidenschaftlich zurück-
gewiesen wurden (1703),
und an den oft bespro-
chenen Vers in den So-
netten Salvator Rosas.3
So steht Maratta in
Kampfstellung gegen einen
großen Teil der Künstler-
schaft und er beruft sich
gelegentlich bei solchen
Disputen auf Poussin, der
Raffael als den Göttlichen
bezeichnete, auf seinen
Lehrer Sacchi, der in dem
Urbinaten nicht ein mensch-
liches Werkzeug auf dem
Gebiete der Malerei, son-
dern ihren Engel gesehen
hatte; Beifallsbezeigungen,
die zu jeder Zeit oft mit den
gleichen Worten auch den
InbegriffderLobespreisung
Michelangelos bildeten.
Im Pantheon errich-
tete Maratta an den Grab-
stätten der beiden Maler-
Abb. 9. Carlo Maratta. Detail aus der Taufe Christi in S. Maria degli Angeli
zu Rom.
fürsten Raffael und Anni-
ta ale Carracci — dort war
auch Giovanni da Udine
begraben worden4 — Mar-
mordenkmale mit den Bü-
sten der Gefeierten, deren
Ruhm und Verdienste an-
gebrachte Inschriften ver-
künden sollten. In seiner
berühmten Sammlung von
Handzeichnungen5standen
die Blätter des Urbinaten
anersterStelle; erbesaß ein
Skizzenbuch aus dessen
Jugendzeit und große Ent-
würfe zum Parnaß, Helio-
dor: Vorlagen, »che si
vanno consumando per le
mani de' discepoli nel co-
piarli«. Carlo widmet dem
Gedächtnisse dieserKünst-
ler auch graphische Blätter
alsErinnerungszeichen: er,
der selbst Kompositionen
Raffaels, der Carracci,
Domenichinos usw. in
gelungenen Radierungen
herausgegeben hatte, ver-
fertigte Zeichnungen mit
Porträtdarstellungen und thesenartige Blätter, die alsbald im Kupferstich verlegt wurden. Ihm entstammt das schöne Porträt
Sanzios und jene große allegorische Komposition (1675) zu Ehren Raffaels, wo das Bildnis des Urbinaten von den
Personifikationen der Künste umgeben wird — die trauernde Frauengestalt aber, die die Malerei versinnbildlicht, trägt auf
dem Stirnband das Mahnungswort »Imitatio« (Abb. 12 und 13). — Damals im Kreise Belloris und Marattas bilden sich
die Keime zu jener Phase der Raffael-Verehrung, die in der Romantikerzeit zu so hoher und verklärter Stufe emporstieg. Er
entwirft jene Huldigung auf Annibale Carracci, die den Meister darstellt, wie er (die beigegebenen Worte bestätigen die
Interpretation) der knienden und hilfsbedürftigen Malerei die Hand bietet, um sie zu dem Tempel des Apollon und der
Pallas zu führen (Abb. 14). Gleichwie fast alle ausgezeichneten Künstler dieser Zeit, wie Bernini, Poussin, Pietro
( »fl
racci
1 Pascoh erzahlt, daß Maratta zum Schutze dieser Fresken eiserne Schranken anbringen ließ, um sie vor Beschädigungen durch allzunah
Herantretende zu schützen.
2 Vgl. auch Schmerber, a. a. 0., S. 26 t. .Der Autor scheint darüber verwundert zu sein, daß >Carlo in seinen Tagen so beliebt gewesen war,
da doch seine geringen malerischen Vorzüge fühlbar gewesen sein mußten«. Dieses Urteil verrat wenig Verständnis für den Entwicklungsgang der
Kunst, die er zu erforschen sich vornahm.
3 Verwandt damit der Bericht Roger de Piles' (ich zitiere die deutsche Ausgabe der »Einleitung in die Malerei aus Grundsätzen«, Leipzig 1760,
S. 10f.), der uns mit mehreren Beispielen darüber unterrichtet, wie Raffaels Werke anfänglich keine Wirkung auch oftmals auf >Leute von Verstand«
ausüben würden.
* Dort sollte spater unter andern auch Raphael Mengs beigesetzt werden.
5 Vgl. Bellori, S. 67 f. Die Sammlung befand sich zur Zeit Winckelmanns im Besitze des Kardinals Albani (Carl Justi, Winckelmann, II, 276 .
— 19 —
as 8e\voute
:s Odiums
:, der Antike
erU*g des
1 Pr°Pamm
1 Werden ak
lnSdurchdas
rt in zurück-
cklung der
'eistet. Dieser
tastlerischen
:0rie,derAuf
ünstlerischen
Ahnenreihe
der nicht in
dtschaft, son-
äervativismus
Schüler ver-
:r und theore-
intnisse liegen)
n ausgespro-
rühmenswert
i
.dwie die Frage
ind der Partei-
;\vischen den
ehren Raffaels
ilos schwankte
lie eine dieser
igen entschied
inandersetzung
m.seitaltersher
« Streit aus-
als die Deflni-
Handhabe der
geschichtlichen
;SgroßenTeite
jution heraus-
ües hier der Fall
nachdrücklich^
lfte Bekennt
hstePüi*^
laier und Kun^
-füi,en ii
6 N°tWlSten
-.üb*'0
Papst Innozenz XI. bereits im Jahre 1693 die Aufsicht und den Schutz dieser Arbeiten anvertraut hatte.1 Dieses
Zurückgreifen auf Raffael und die Bereitwilligkeit, in ihm das Heil der Kunst zu sehen, ist aber nicht die ständige
Ansicht der damaligen Ästhetik. Bellori (S. 58) selbst fühlt sich verpflichtet, darüber ausführlich zu handeln und
Carlo das Wort zu geben; er unterrichtet uns über Anschauungen, in denen sich die Kunstmeinung der Epoche wider-
spiegelt, die in ihren Lehren und gedruckten theoretischen Schriften Raffael den Vorwurf machten, er sei hart und trocken
und seine maniera sei »statuina« (vocabolo introdotto all' etä nostra, wie Bellori hinzufügt2), daß er nicht die »Furia«
gehabt hätte, die »fierezza di spirito« und daß seine Schüler bessere Werke geschaffen hätten (gemeint ist vor allem
Giulio Romano, also die durch Raffaels Einfluß gemilderte »Furia« Michelangelos). Bellori zitiert als abschreckendes
Beispiel jenes bekannte Wort des Venezianers Boschini: »E disse, Raffael a dirve el vero — Piasendome esser libero e
sincero — Stagoperdir, che nolmepiace niente«. Und wir erinnern an die Aussprüche, die Malvasia über den »Vasenmaler«
(bocalajo) Raffael gefällt
hatte, die unter anderem
von Vincenzio Vittoria
leidenschaftlich zurück-
gewiesen wurden (1703),
und an den oft bespro-
chenen Vers in den So-
netten Salvator Rosas.3
So steht Maratta in
Kampfstellung gegen einen
großen Teil der Künstler-
schaft und er beruft sich
gelegentlich bei solchen
Disputen auf Poussin, der
Raffael als den Göttlichen
bezeichnete, auf seinen
Lehrer Sacchi, der in dem
Urbinaten nicht ein mensch-
liches Werkzeug auf dem
Gebiete der Malerei, son-
dern ihren Engel gesehen
hatte; Beifallsbezeigungen,
die zu jeder Zeit oft mit den
gleichen Worten auch den
InbegriffderLobespreisung
Michelangelos bildeten.
Im Pantheon errich-
tete Maratta an den Grab-
stätten der beiden Maler-
Abb. 9. Carlo Maratta. Detail aus der Taufe Christi in S. Maria degli Angeli
zu Rom.
fürsten Raffael und Anni-
ta ale Carracci — dort war
auch Giovanni da Udine
begraben worden4 — Mar-
mordenkmale mit den Bü-
sten der Gefeierten, deren
Ruhm und Verdienste an-
gebrachte Inschriften ver-
künden sollten. In seiner
berühmten Sammlung von
Handzeichnungen5standen
die Blätter des Urbinaten
anersterStelle; erbesaß ein
Skizzenbuch aus dessen
Jugendzeit und große Ent-
würfe zum Parnaß, Helio-
dor: Vorlagen, »che si
vanno consumando per le
mani de' discepoli nel co-
piarli«. Carlo widmet dem
Gedächtnisse dieserKünst-
ler auch graphische Blätter
alsErinnerungszeichen: er,
der selbst Kompositionen
Raffaels, der Carracci,
Domenichinos usw. in
gelungenen Radierungen
herausgegeben hatte, ver-
fertigte Zeichnungen mit
Porträtdarstellungen und thesenartige Blätter, die alsbald im Kupferstich verlegt wurden. Ihm entstammt das schöne Porträt
Sanzios und jene große allegorische Komposition (1675) zu Ehren Raffaels, wo das Bildnis des Urbinaten von den
Personifikationen der Künste umgeben wird — die trauernde Frauengestalt aber, die die Malerei versinnbildlicht, trägt auf
dem Stirnband das Mahnungswort »Imitatio« (Abb. 12 und 13). — Damals im Kreise Belloris und Marattas bilden sich
die Keime zu jener Phase der Raffael-Verehrung, die in der Romantikerzeit zu so hoher und verklärter Stufe emporstieg. Er
entwirft jene Huldigung auf Annibale Carracci, die den Meister darstellt, wie er (die beigegebenen Worte bestätigen die
Interpretation) der knienden und hilfsbedürftigen Malerei die Hand bietet, um sie zu dem Tempel des Apollon und der
Pallas zu führen (Abb. 14). Gleichwie fast alle ausgezeichneten Künstler dieser Zeit, wie Bernini, Poussin, Pietro
( »fl
racci
1 Pascoh erzahlt, daß Maratta zum Schutze dieser Fresken eiserne Schranken anbringen ließ, um sie vor Beschädigungen durch allzunah
Herantretende zu schützen.
2 Vgl. auch Schmerber, a. a. 0., S. 26 t. .Der Autor scheint darüber verwundert zu sein, daß >Carlo in seinen Tagen so beliebt gewesen war,
da doch seine geringen malerischen Vorzüge fühlbar gewesen sein mußten«. Dieses Urteil verrat wenig Verständnis für den Entwicklungsgang der
Kunst, die er zu erforschen sich vornahm.
3 Verwandt damit der Bericht Roger de Piles' (ich zitiere die deutsche Ausgabe der »Einleitung in die Malerei aus Grundsätzen«, Leipzig 1760,
S. 10f.), der uns mit mehreren Beispielen darüber unterrichtet, wie Raffaels Werke anfänglich keine Wirkung auch oftmals auf >Leute von Verstand«
ausüben würden.
* Dort sollte spater unter andern auch Raphael Mengs beigesetzt werden.
5 Vgl. Bellori, S. 67 f. Die Sammlung befand sich zur Zeit Winckelmanns im Besitze des Kardinals Albani (Carl Justi, Winckelmann, II, 276 .
— 19 —