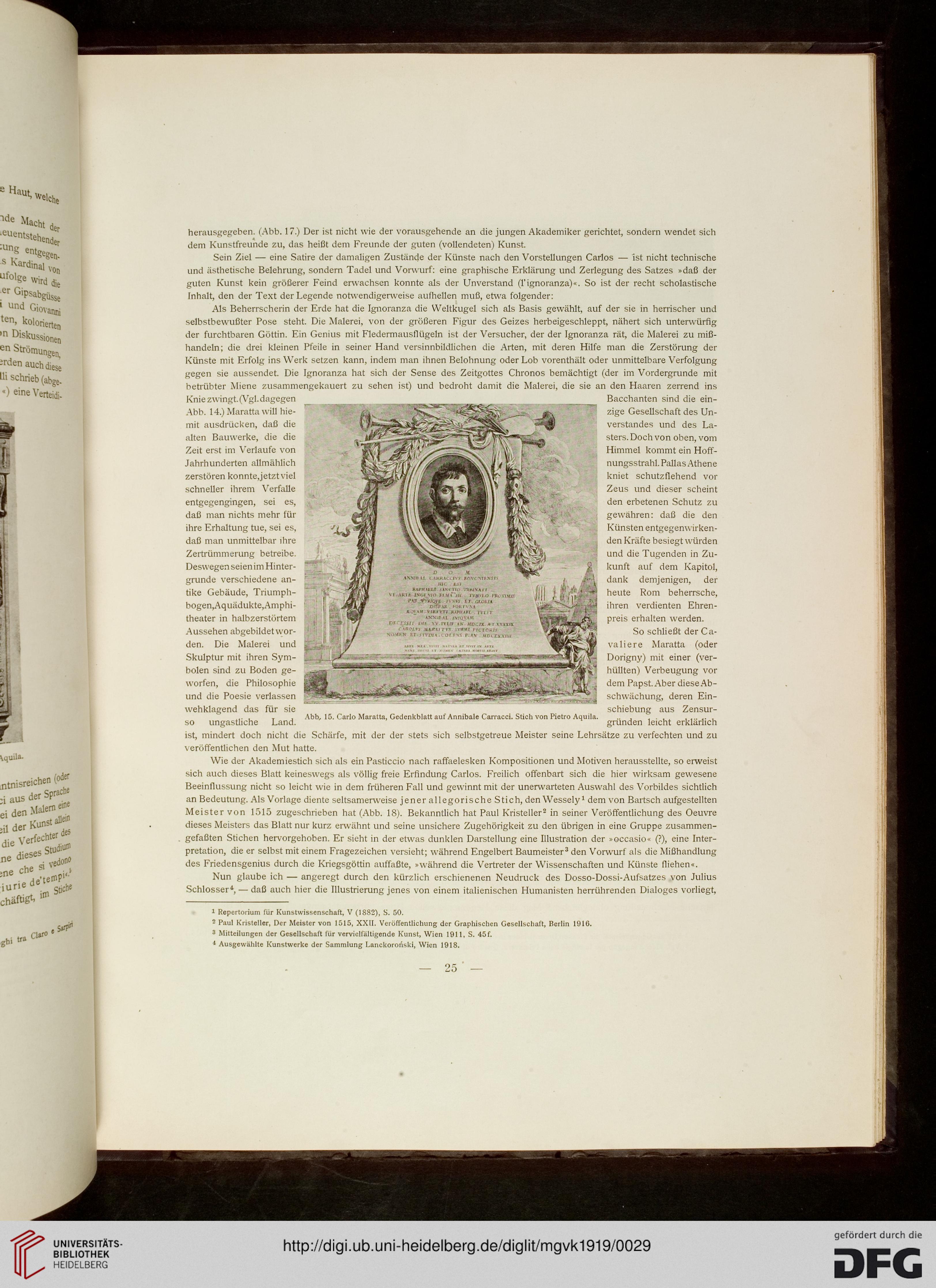■eUents^he„der
?? e<%gen-
s^rd,nalv
uf(%ewirddie
!er GiP^bguSSe
' Und Giovann,
ten, kolorienen
,n Diskussionen
en Strömungen,
-rden auch diese
Hi schrieb (abge.
") «ne Verteidi-
jfc
ausreichen (<*
:iausderSPrac
ei den Malem^
derKunst^
:ne C enemP-1
chäftigt. un
herausgegeben. (Abb. 17.) Der ist nicht wie der vorausgehende an die jungen Akademiker gerichtet, sondern wendet sich
dem Kunstfreunde zu, das heißt dem Freunde der guten (vollendeten) Kunst.
Sein Ziel — eine Satire der damaligen Zustände der Künste nach den Vorstellungen Carlos — ist nicht technische
und ästhetische Belehrung, sondern Tadel und Vorwurf: eine graphische Erklärung und Zerlegung des Satzes »daß der
guten Kunst kein größerer Feind erwachsen konnte als der Unverstand (T ignoranza)«. So ist der recht scholastische
Inhalt, den der Text der Legende notwendigerweise aufhellen muß, etwa folgender:
Als Beherrscherin der Erde hat die Ignoranza die Weltkugel sich als Basis gewählt, auf der sie in herrischer und
selbstbewußter Pose steht. Die Malerei, von der größeren Figur des Geizes herbeigeschleppt, nähert sich unterwürfig
der furchtbaren Göttin. Ein Genius mit Fledermausflügeln ist der Versucher, der der Ignoranza rät, die Malerei zu miß-
handeln; die drei kleinen Pfeile in seiner Hand versinnbildlichen die Arten, mit deren Hilfe man die Zerstörung der
Künste mit Erfolg ins Werk setzen kann, indem man ihnen Belohnung oder Lob vorenthält oder unmittelbare Verfolgung
gegen sie aussendet. Die Ignoranza hat sich der Sense des Zeitgottes Chronos bemächtigt (der im Vordergrunde mit
betrübter Miene zusammengekauert zu sehen ist) und bedroht damit die Malerei, die sie an den Haaren zerrend ins
Knie zwingt. (Vgl. dagegen
Abb. 14.) Maratta will hie-
rmit ausdrücken, daß die
alten Bauwerke, die die
Zeit erst im Verlaufe von
Jahrhunderten allmählich
zerstören konntejetztviel
schneller ihrem Verfalle
entgegengingen, sei es,
daß man nichts mehr für
ihre Erhaltung tue, sei es,
daß man unmittelbar ihre
Zertrümmerung betreibe.
Deswegen seienim Hinter-
grunde verschiedene an-
tike Gebäude, Triumph-
bogen,Aquädukte,Amphi-
theater in halbzerstörtem
Aussehen abgebildet wor-
den. Die Malerei und
Skulptur mit ihren Sym-
bolen sind zu Boden ge-
worfen, die Philosophie
und die Poesie verlassen
wehklagend das für sie
Bacchanten sind die ein-
zige Gesellschaft des Un-
verstandes und des La-
sters. Doch von oben, vom
Himmel kommt ein Hoff-
nungsstrahl. Pallas Athene
kniet schutzflehend vor
Zeus und dieser scheint
den erbetenen Schutz zu
gewähren: daß die den
Künsten entgegenwirken-
den Kräfte besiegt würden
und die Tugenden in Zu-
kunft auf dem Kapital,
dank demjenigen, der
heute Rom beherrsche,
ihren verdienten Ehren-
preis erhalten werden.
So schließt der Ca-
valiere Maratta (oder
Dorigny) mit einer (ver-
hüllten) Verbeugung vor
dem Papst. Aber diese Ab-
schwächung, deren Ein-
schiebung aus Zensur-
gründen leicht erklärlich
ch selbstgetreue Meister seine Lehrsätze zu verfechten und zu
Abb, 15. Carlo Maratta, Gedenkblatt auf Annibale Carracci. Stich von Pietro Aquila.
mit der der stets
so ungastliche Land.
ist, mindert doch nicht die Schärfe
veröffentlichen den Mut hatte.
Wie der Akademiestich sich als ein Pasticcio nach raffaelesken Kompositionen und Motiven herausstellte, so erweist
sich auch dieses Blatt keineswegs als völlig freie Erfindung Carlos. Freilich offenbart sich die hier wirksam gewesene
Beeinflussung nicht so leicht wie in dem früheren Fall und gewinnt mit der unerwarteten Auswahl des Vorbildes sichtlich
an Bedeutung. Als Vorlage diente seltsamerweise jener allegorische Stich, denWessely1 dem von Bartsch aufgestellten
Meister von 1515 zugeschrieben hat (Abb. 18). Bekanntlich hat Paul Kristeller2 in seiner Veröffentlichung des Oeuvre
dieses Meisters das Blatt nur kurz erwähnt und seine unsichere Zugehörigkeit zu den übrigen in eine Gruppe zusammen-
gefaßten Stichen hervorgehoben. Er sieht in der etwas dunklen Darstellung eine Illustration der »occasio« (?), eine Inter-
pretation, die er selbst mit einem Fragezeichen versieht; während Engelbert Baumeister3 den Vorwurf als die Mißhandlung
des Friedensgenius durch die Kriegsgöttin auffaßte, »während die Vertreter der Wissenschaften und Künste fliehen«.
Nun glaube ich — angeregt durch den kürzlich erschienenen Neudruck des Dosso-Dossi-Aufsatzes von Julius
Schlosser4, — daß auch hier die Illustrierung jenes von einem italienischen Humanisten herrührenden Dialoges vorliegt,
ghi
Cl»r0
.Stfr*
1 Repertorium für Kunstwissenschaft, V (1882), S. 50.
2 Paul Kristeller, Der Meister von 1515, XXII. Veröffentlichung der Graphischen Gesellschaft, Berlin 1916.
3 Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst, Wien 1911, S. 45 f.
4 Ausgewählte Kunstwerke der Sammlung Lanckoronski, Wien 1918.
25