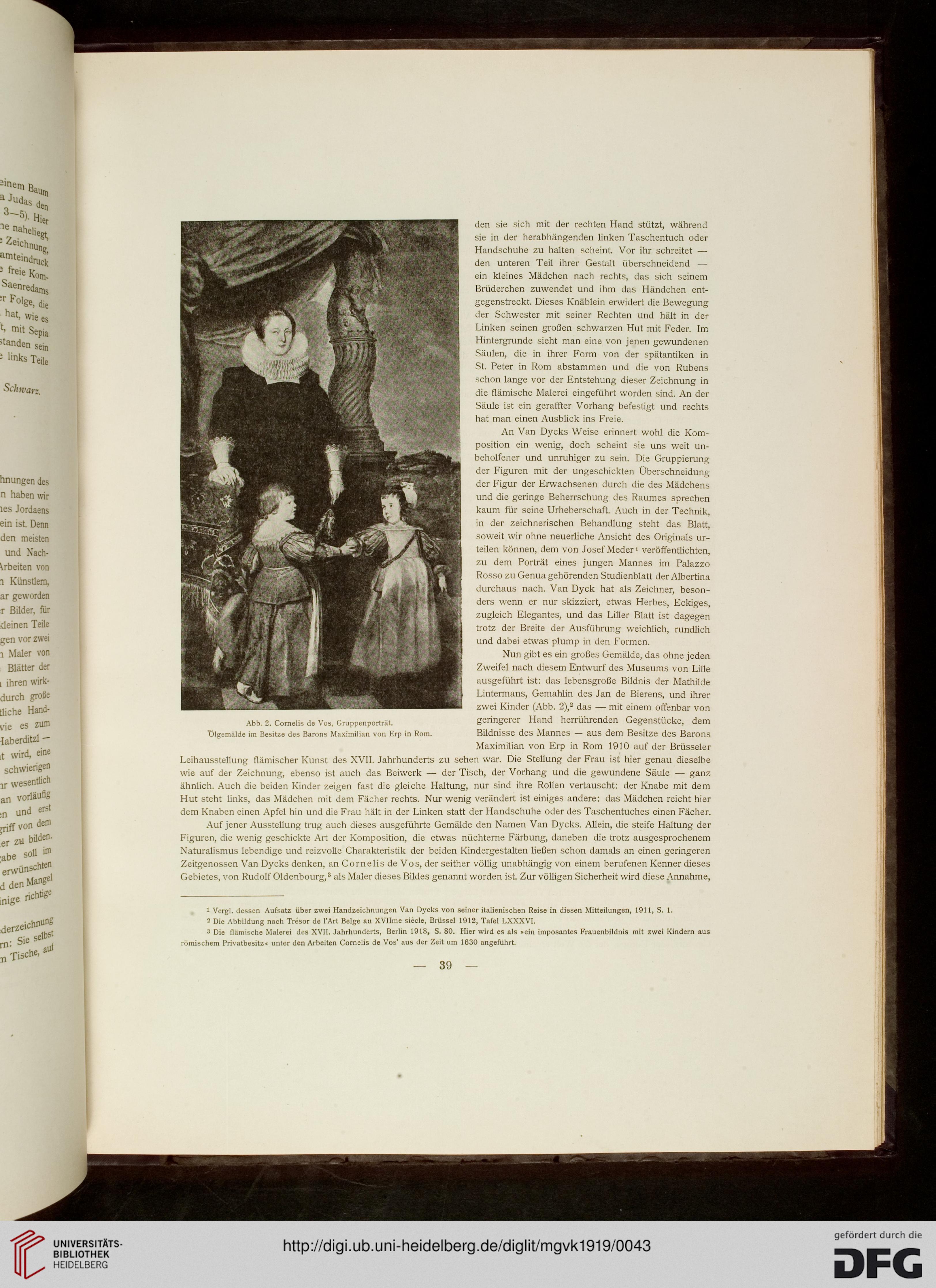wmmam
van.
' richtig0
den sie sich mit der rechten Hand stützt, während
sie in der herabhängenden linken Taschentuch oder
Handschuhe zu halten scheint. Vor ihr schreitet —
den unteren Teil ihrer Gestalt überschneidend —
ein kleines Mädchen nach rechts, das sich seinem
Brüderchen zuwendet und ihm das Händchen ent-
gegenstreckt. Dieses Knäblein erwidert die Bewegung
der Schwester mit seiner Rechten und hält in der
Linken seinen großen schwarzen Hut mit Feder. Im
Hintergrunde sieht man eine von jenen gewundenen
Säulen, die in ihrer Form von der spätantiken in
St. Peter in Rom abstammen und die von Rubens
schon lange vor der Entstehung dieser Zeichnung in
die flämische Malerei eingeführt worden sind. An der
Säule ist ein geraffter Vorhang befestigt und rechts
hat man einen Ausblick ins Freie.
An Van Dycks Weise erinnert wohl die Kom-
position ein wenig, doch scheint sie uns weit un-
beholfener und unruhiger zu sein. Die Gruppierung
der Figuren mit der ungeschickten Überschneidung
der Figur der Erwachsenen durch die des Mädchens
und die geringe Beherrschung des Raumes sprechen
kaum für seine Urheberschaft. Auch in der Technik,
in der zeichnerischen Behandlung steht das Blatt,
soweit wir ohne neuerliche Ansicht des Originals ur-
teilen können, dem von Josef Meder1 veröffentlichten,
zu dem Porträt eines jungen Mannes im Palazzo
Rosso zu Genua gehörenden Studienblatt der Albertina
durchaus nach. Van Dyck hat als Zeichner, beson-
ders wenn er nur skizziert, etwas Herbes, Eckiges,
zugleich Elegantes, und das Liller Blatt ist dagegen
trotz der Breite der Ausführung weichlich, rundlich
und dabei etwas plump in den Formen.
Nun gibt es ein großes Gemälde, das ohne jeden
Zweifel nach diesem Entwurf des Museums von Lille
ausgeführt ist: das lebensgroße Bildnis der Mathilde
Lintermans, Gemahlin des Jan de Bierens, und ihrer
zwei Kinder (Abb. 2),2 das — mit einem offenbar von
geringerer Hand herrührenden Gegenstücke, dem
Bildnisse des Mannes — aus dem Besitze des Barons
Maximilian von Erp in Rom 1910 auf der Brüsseler
Leihausstellung flämischer Kunst des XVII. Jahrhunderts zu sehen war. Die Stellung der Frau ist hier genau dieselbe
wie auf der Zeichnung, ebenso ist auch das Beiwerk — der Tisch, der Vorhang und die gewundene Säule — ganz
ähnlich. Auch die beiden Kinder zeigen fast die gleiche Haltung, nur sind ihre Rollen vertauscht: der Knabe mit dem
Hut steht links, das Mädchen mit dem Fächer rechts. Nur wenig verändert ist einiges andere: das Mädchen reicht hier
dem Knaben einen Apfel hin und die Frau hält in der Linken statt der Handschuhe oder des Taschentuches einen Fächer.
Auf jener Ausstellung trug auch dieses ausgeführte Gemälde den Namen Van Dycks. Allein, die steife Haltung der
Figuren, die wenig geschickte Art der Komposition, die etwas nüchterne Färbung, daneben die trotz ausgesprochenem
Naturalismus lebendige und reizvolle Charakteristik der beiden Kindergestalten ließen schon damals an einen geringeren
Zeitgenossen Van Dycks denken, an Cornelis de Vos, der seither völlig unabhängig von einem berufenen Kenner dieses
Gebietes, von Rudolf Oldenbourg,3 als Maler dieses Bildes genannt worden ist. Zur völligen Sicherheit wird diese Annahme,
Abb. 2. Cornelis de Vos. Gruppenporträt.
'Ölgemälde im Besitze des Barons Maximilian von Erp in Rom.
Sie
chnung
selbst
1 Vergl. dessen Aufsatz über zwei Handzeichnungen Van Dycks von seiner italienischen Reise in diesen Mitteilungen, 1911, S. 1.
2 Die Abbildung nach Tresor de I'Art Beige au XVIIme siede, Brüssel 1912, Tafel LXXXVI.
3 Die flämische Malerei des XVII. Jahrhunderts, Berlin 1918, S. 80. Hier wird es als >ein imposantes Frauenbildnis mit zwei Kindern aus
römischem Privatbesitz« unter den Arbeiten Cornelis de Vos' aus der Zeit um 1630 angeführt.
39 —
van.
' richtig0
den sie sich mit der rechten Hand stützt, während
sie in der herabhängenden linken Taschentuch oder
Handschuhe zu halten scheint. Vor ihr schreitet —
den unteren Teil ihrer Gestalt überschneidend —
ein kleines Mädchen nach rechts, das sich seinem
Brüderchen zuwendet und ihm das Händchen ent-
gegenstreckt. Dieses Knäblein erwidert die Bewegung
der Schwester mit seiner Rechten und hält in der
Linken seinen großen schwarzen Hut mit Feder. Im
Hintergrunde sieht man eine von jenen gewundenen
Säulen, die in ihrer Form von der spätantiken in
St. Peter in Rom abstammen und die von Rubens
schon lange vor der Entstehung dieser Zeichnung in
die flämische Malerei eingeführt worden sind. An der
Säule ist ein geraffter Vorhang befestigt und rechts
hat man einen Ausblick ins Freie.
An Van Dycks Weise erinnert wohl die Kom-
position ein wenig, doch scheint sie uns weit un-
beholfener und unruhiger zu sein. Die Gruppierung
der Figuren mit der ungeschickten Überschneidung
der Figur der Erwachsenen durch die des Mädchens
und die geringe Beherrschung des Raumes sprechen
kaum für seine Urheberschaft. Auch in der Technik,
in der zeichnerischen Behandlung steht das Blatt,
soweit wir ohne neuerliche Ansicht des Originals ur-
teilen können, dem von Josef Meder1 veröffentlichten,
zu dem Porträt eines jungen Mannes im Palazzo
Rosso zu Genua gehörenden Studienblatt der Albertina
durchaus nach. Van Dyck hat als Zeichner, beson-
ders wenn er nur skizziert, etwas Herbes, Eckiges,
zugleich Elegantes, und das Liller Blatt ist dagegen
trotz der Breite der Ausführung weichlich, rundlich
und dabei etwas plump in den Formen.
Nun gibt es ein großes Gemälde, das ohne jeden
Zweifel nach diesem Entwurf des Museums von Lille
ausgeführt ist: das lebensgroße Bildnis der Mathilde
Lintermans, Gemahlin des Jan de Bierens, und ihrer
zwei Kinder (Abb. 2),2 das — mit einem offenbar von
geringerer Hand herrührenden Gegenstücke, dem
Bildnisse des Mannes — aus dem Besitze des Barons
Maximilian von Erp in Rom 1910 auf der Brüsseler
Leihausstellung flämischer Kunst des XVII. Jahrhunderts zu sehen war. Die Stellung der Frau ist hier genau dieselbe
wie auf der Zeichnung, ebenso ist auch das Beiwerk — der Tisch, der Vorhang und die gewundene Säule — ganz
ähnlich. Auch die beiden Kinder zeigen fast die gleiche Haltung, nur sind ihre Rollen vertauscht: der Knabe mit dem
Hut steht links, das Mädchen mit dem Fächer rechts. Nur wenig verändert ist einiges andere: das Mädchen reicht hier
dem Knaben einen Apfel hin und die Frau hält in der Linken statt der Handschuhe oder des Taschentuches einen Fächer.
Auf jener Ausstellung trug auch dieses ausgeführte Gemälde den Namen Van Dycks. Allein, die steife Haltung der
Figuren, die wenig geschickte Art der Komposition, die etwas nüchterne Färbung, daneben die trotz ausgesprochenem
Naturalismus lebendige und reizvolle Charakteristik der beiden Kindergestalten ließen schon damals an einen geringeren
Zeitgenossen Van Dycks denken, an Cornelis de Vos, der seither völlig unabhängig von einem berufenen Kenner dieses
Gebietes, von Rudolf Oldenbourg,3 als Maler dieses Bildes genannt worden ist. Zur völligen Sicherheit wird diese Annahme,
Abb. 2. Cornelis de Vos. Gruppenporträt.
'Ölgemälde im Besitze des Barons Maximilian von Erp in Rom.
Sie
chnung
selbst
1 Vergl. dessen Aufsatz über zwei Handzeichnungen Van Dycks von seiner italienischen Reise in diesen Mitteilungen, 1911, S. 1.
2 Die Abbildung nach Tresor de I'Art Beige au XVIIme siede, Brüssel 1912, Tafel LXXXVI.
3 Die flämische Malerei des XVII. Jahrhunderts, Berlin 1918, S. 80. Hier wird es als >ein imposantes Frauenbildnis mit zwei Kindern aus
römischem Privatbesitz« unter den Arbeiten Cornelis de Vos' aus der Zeit um 1630 angeführt.
39 —