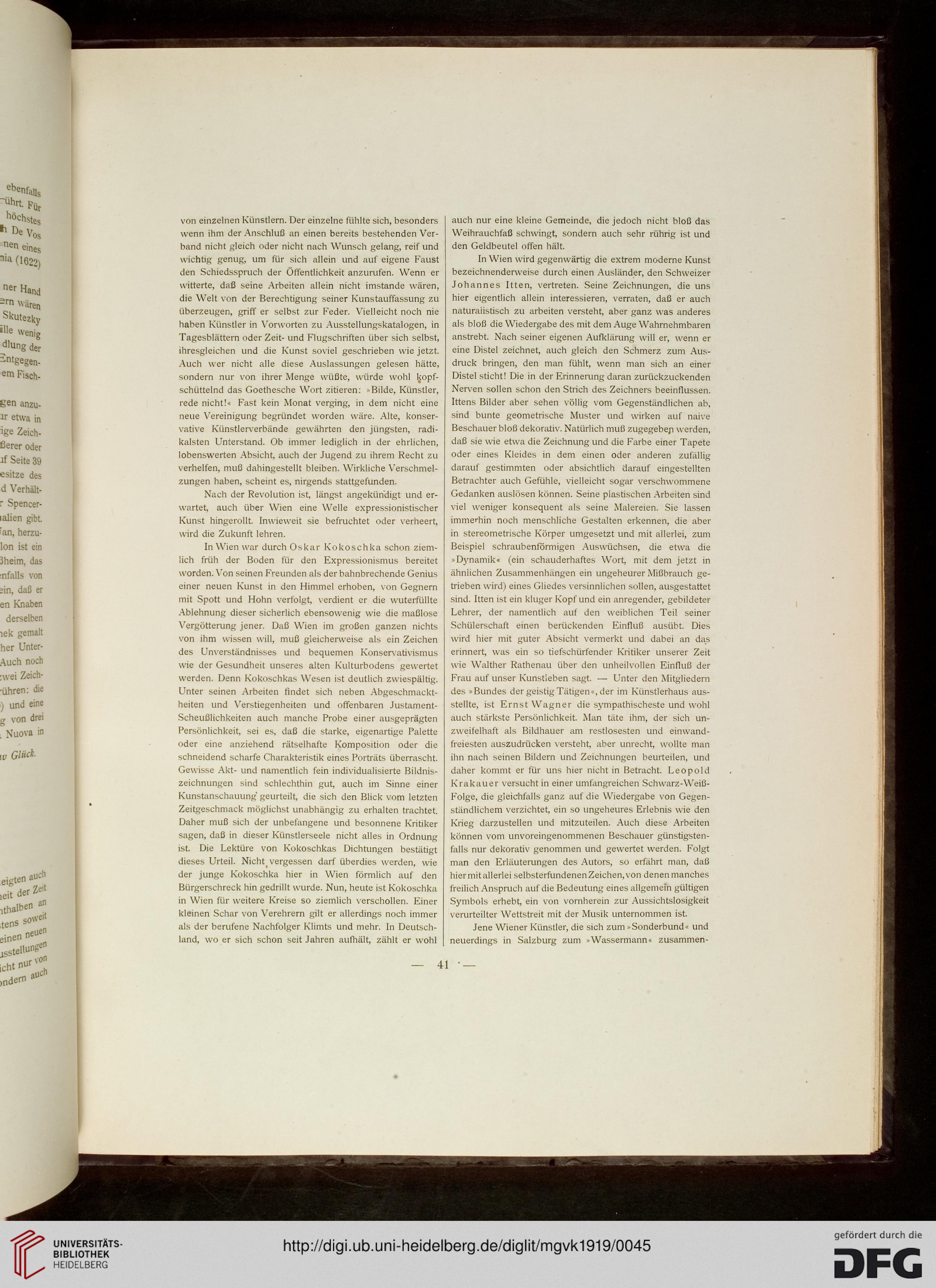■^^■^HHM
VQ$
Glich.
i auch
• Zeit
an
veit
i neuen
llungen
„ auch
von einzelnen Künstlern. Der einzelne fühlte sich, besonders
wenn ihm der Anschluß an einen bereits bestehenden Ver-
band nicht gleich oder nicht nach Wunsch gelang, reif und
wichtig genug, um für sich allein und auf eigene Faust
den Schiedsspruch der Öffentlichkeit anzurufen. Wenn er
witterte, daß seine Arbeiten allein nicht imstande wären,
die Welt von der Berechtigung seiner Kunstauffassung zu
überzeugen, griff er selbst zur Feder. Vielleicht noch nie
haben Künstler in Vorworten zu Ausstellungskatalogen, in
Tagesblättern oder Zeit- und Flugschriften über sich selbst,
ihresgleichen und die Kunst soviel geschrieben wie jetzt.
Auch wer nicht alle diese Auslassungen gelesen hätte,
sondern nur von ihrer Menge wüßte, würde wohl kopf-
schüttelnd das Goethesche Wort zitieren: »Bilde, Künstler,
rede nicht!« Fast kein Monat verging, in dem nicht eine
neue Vereinigung begründet worden wäre. Alte, konser-
vative Künstlerverbände gewährten den jüngsten, radi-
kalsten Unterstand. Ob immer lediglich in der ehrlichen,
lobenswerten Absicht, auch der Jugend zu ihrem Recht zu
verhelfen, muß dahingestellt bleiben. Wirkliche Verschmel-
zungen haben, scheint es, nirgends stattgefunden.
Nach der Revolution ist, längst angekündigt und er-
wartet, auch über Wien eine Welle expressionistischer
Kunst hingerollt. Inwieweit sie befruchtet oder verheert,
wird die Zukunft lehren.
In Wien war durch Oskar Kokoschka schon ziem-
lich früh der Boden für den Expressionismus bereitet
worden. Von seinen Freunden als der bahnbrechende Genius
einer neuen Kunst in den Himmel erhoben, von Gegnern
mit Spott und Hohn verfolgt, verdient er die wuterfüllte
Ablehnung dieser sicherlich ebensowenig wie die maßlose
Vergötterung jener. Daß Wien im großen ganzen nichts
von ihm wissen will, muß gleicherweise als ein Zeichen
des Unverständnisses und bequemen Konservativismus
wie der Gesundheit unseres alten Kulturbodens gewertet
werden. Denn Kokoschkas Wesen ist deutlich zwiespältig.
Unter seinen Arbeiten findet sich neben Abgeschmackt-
heiten und Verstiegenheiten und offenbaren Justament-
Scheußlichkeiten auch manche Probe einer ausgeprägten
Persönlichkeit, sei es, daß die starke, eigenartige Palette
oder eine anziehend rätselhafte Komposition oder die
schneidend scharfe Charakteristik eines Porträts überrascht.
Gewisse Akt- und namentlich fein individualisierte Bildnis-
zeichnungen sind schlechthin gut, auch im Sinne einer
Kunstanschauung' geurteilt, die sich den Blick vom letzten
Zeitgeschmack möglichst unabhängig zu erhalten trachtet.
Daher muß sich der unbefangene und besonnene Kritiker
sagen, daß in dieser Künstlerseele nicht alles in Ordnung
ist. Die Lektüre von Kokoschkas Dichtungen bestätigt
dieses Urteil. Nicht vergessen darf überdies werden, wie
der junge Kokoschka hier in Wien förmlich auf den
Bürgerschreck hin gedrillt wurde. Nun, heute ist Kokoschka
in Wien für weitere Kreise so ziemlich verschollen. Einer
kleinen Schar von Verehrern gilt er allerdings noch immer
als der berufene Nachfolger Klimts und mehr. In Deutsch-
land, wo er sich schon seit Jahren aufhält, zählt er wohl
auch nur eine kleine Gemeinde, die jedoch nicht bloß das
Weihrauchfaß schwingt, sondern auch sehr rührig ist und
den Geldbeutel offen hält.
In Wien wird gegenwärtig die extrem moderne Kunst
bezeichnenderweise durch einen Ausländer, den Schweizer
Johannes Itten, vertreten. Seine Zeichnungen, die uns
hier eigentlich allein interessieren, verraten, daß er auch
naturalistisch zu arbeiten versteht, aber ganz was anderes
als bloß die Wiedergabe des mit dem Auge Wahrnehmbaren
anstrebt. Nach seiner eigenen Aufklärung will er, wenn er
eine Distel zeichnet, auch gleich den Schmerz zum Aus-
druck bringen, den man fühlt, wenn man sich an einer
Distel sticht! Die in der Erinnerung daran zurückzuckenden
Nerven sollen schon den Strich des Zeichners beeinflussen.
Ittens Bilder aber sehen völlig vom Gegenständlichen ab,
sind bunte geometrische Muster und wirken auf naive
Beschauer bloß dekorativ. Natürlich muß zugegeben werden,
daß sie wie etwa die Zeichnung und die Farbe einer Tapete
oder eines Kleides in dem einen oder anderen zufällig
darauf gestimmten oder absichtlich darauf eingestellten
Betrachter auch Gefühle, vielleicht sogar verschwommene
Gedanken auslösen können. Seine plastischen Arbeiten sind
viel weniger konsequent als seine Malereien. Sie lassen
immerhin noch menschliche Gestalten erkennen, die aber
in stereometrische Körper umgesetzt und mit allerlei, zum
Beispiel schraubenförmigen Auswüchsen, die etwa die
»Dynamik« (ein schauderhaftes Wort, mit dem jetzt in
ähnlichen Zusammenhängen ein ungeheurer Mißbrauch ge-
trieben wird) eines Gliedes versinnlichen sollen, ausgestattet
sind. Itten ist ein kluger Kopf und ein anregender, gebildeter
Lehrer, der namentlich auf den weiblichen Teil seiner
Schülerschaft einen berückenden Einfluß ausübt. Dies
wird hier mit guter Absicht vermerkt und dabei an das
erinnert, was ein so tiefschürfender Kritiker unserer Zeit
wie Walther Rathenau über den unheilvollen Einfluß der
Frau auf unser Kunstleben sagt. — Unter den Mitgliedern
des »Bundes der geistig Tätigen«, der im Künstlerhaus aus-
stellte, ist Ernst Wagner die sympathischeste und wohl
auch stärkste Persönlichkeit. Man täte ihm, der sich un-
zweifelhaft als Bildhauer am restlosesten und einwand-
freiesten auszudrücken versteht, aber unrecht, wollte man
ihn nach seinen Bildern und Zeichnungen beurteilen, und
daher kommt er für uns hier nicht in Betracht. Leopold
Krakauer versucht in einer umfangreichen Schwarz-Weiß-
Folge, die gleichfalls ganz auf die Wiedergabe von Gegen-
ständlichem verzichtet, ein so ungeheures Erlebnis wie den
Krieg darzustellen und mitzuteilen. Auch diese Arbeiten
können vom unvoreingenommenen Beschauer günstigsten-
falls nur dekorativ genommen und gewertet werden. Folgt
man den Erläuterungen des Autors, so erfährt man, daß
hier mit allerlei selbsterfundenen Zeichen, von denen manches
freilich Anspruch auf die Bedeutung eines allgemein gültigen
Symbols erhebt, ein von vornherein zur Aussichtslosigkeit
verurteilter Wettstreit mit der Musik unternommen ist.
Jene Wiener Künstler, die sich zum »Sonderbund« und
neuerdings in Salzburg zum »Wassermann« zusammen-
41 • —
wP
VQ$
Glich.
i auch
• Zeit
an
veit
i neuen
llungen
„ auch
von einzelnen Künstlern. Der einzelne fühlte sich, besonders
wenn ihm der Anschluß an einen bereits bestehenden Ver-
band nicht gleich oder nicht nach Wunsch gelang, reif und
wichtig genug, um für sich allein und auf eigene Faust
den Schiedsspruch der Öffentlichkeit anzurufen. Wenn er
witterte, daß seine Arbeiten allein nicht imstande wären,
die Welt von der Berechtigung seiner Kunstauffassung zu
überzeugen, griff er selbst zur Feder. Vielleicht noch nie
haben Künstler in Vorworten zu Ausstellungskatalogen, in
Tagesblättern oder Zeit- und Flugschriften über sich selbst,
ihresgleichen und die Kunst soviel geschrieben wie jetzt.
Auch wer nicht alle diese Auslassungen gelesen hätte,
sondern nur von ihrer Menge wüßte, würde wohl kopf-
schüttelnd das Goethesche Wort zitieren: »Bilde, Künstler,
rede nicht!« Fast kein Monat verging, in dem nicht eine
neue Vereinigung begründet worden wäre. Alte, konser-
vative Künstlerverbände gewährten den jüngsten, radi-
kalsten Unterstand. Ob immer lediglich in der ehrlichen,
lobenswerten Absicht, auch der Jugend zu ihrem Recht zu
verhelfen, muß dahingestellt bleiben. Wirkliche Verschmel-
zungen haben, scheint es, nirgends stattgefunden.
Nach der Revolution ist, längst angekündigt und er-
wartet, auch über Wien eine Welle expressionistischer
Kunst hingerollt. Inwieweit sie befruchtet oder verheert,
wird die Zukunft lehren.
In Wien war durch Oskar Kokoschka schon ziem-
lich früh der Boden für den Expressionismus bereitet
worden. Von seinen Freunden als der bahnbrechende Genius
einer neuen Kunst in den Himmel erhoben, von Gegnern
mit Spott und Hohn verfolgt, verdient er die wuterfüllte
Ablehnung dieser sicherlich ebensowenig wie die maßlose
Vergötterung jener. Daß Wien im großen ganzen nichts
von ihm wissen will, muß gleicherweise als ein Zeichen
des Unverständnisses und bequemen Konservativismus
wie der Gesundheit unseres alten Kulturbodens gewertet
werden. Denn Kokoschkas Wesen ist deutlich zwiespältig.
Unter seinen Arbeiten findet sich neben Abgeschmackt-
heiten und Verstiegenheiten und offenbaren Justament-
Scheußlichkeiten auch manche Probe einer ausgeprägten
Persönlichkeit, sei es, daß die starke, eigenartige Palette
oder eine anziehend rätselhafte Komposition oder die
schneidend scharfe Charakteristik eines Porträts überrascht.
Gewisse Akt- und namentlich fein individualisierte Bildnis-
zeichnungen sind schlechthin gut, auch im Sinne einer
Kunstanschauung' geurteilt, die sich den Blick vom letzten
Zeitgeschmack möglichst unabhängig zu erhalten trachtet.
Daher muß sich der unbefangene und besonnene Kritiker
sagen, daß in dieser Künstlerseele nicht alles in Ordnung
ist. Die Lektüre von Kokoschkas Dichtungen bestätigt
dieses Urteil. Nicht vergessen darf überdies werden, wie
der junge Kokoschka hier in Wien förmlich auf den
Bürgerschreck hin gedrillt wurde. Nun, heute ist Kokoschka
in Wien für weitere Kreise so ziemlich verschollen. Einer
kleinen Schar von Verehrern gilt er allerdings noch immer
als der berufene Nachfolger Klimts und mehr. In Deutsch-
land, wo er sich schon seit Jahren aufhält, zählt er wohl
auch nur eine kleine Gemeinde, die jedoch nicht bloß das
Weihrauchfaß schwingt, sondern auch sehr rührig ist und
den Geldbeutel offen hält.
In Wien wird gegenwärtig die extrem moderne Kunst
bezeichnenderweise durch einen Ausländer, den Schweizer
Johannes Itten, vertreten. Seine Zeichnungen, die uns
hier eigentlich allein interessieren, verraten, daß er auch
naturalistisch zu arbeiten versteht, aber ganz was anderes
als bloß die Wiedergabe des mit dem Auge Wahrnehmbaren
anstrebt. Nach seiner eigenen Aufklärung will er, wenn er
eine Distel zeichnet, auch gleich den Schmerz zum Aus-
druck bringen, den man fühlt, wenn man sich an einer
Distel sticht! Die in der Erinnerung daran zurückzuckenden
Nerven sollen schon den Strich des Zeichners beeinflussen.
Ittens Bilder aber sehen völlig vom Gegenständlichen ab,
sind bunte geometrische Muster und wirken auf naive
Beschauer bloß dekorativ. Natürlich muß zugegeben werden,
daß sie wie etwa die Zeichnung und die Farbe einer Tapete
oder eines Kleides in dem einen oder anderen zufällig
darauf gestimmten oder absichtlich darauf eingestellten
Betrachter auch Gefühle, vielleicht sogar verschwommene
Gedanken auslösen können. Seine plastischen Arbeiten sind
viel weniger konsequent als seine Malereien. Sie lassen
immerhin noch menschliche Gestalten erkennen, die aber
in stereometrische Körper umgesetzt und mit allerlei, zum
Beispiel schraubenförmigen Auswüchsen, die etwa die
»Dynamik« (ein schauderhaftes Wort, mit dem jetzt in
ähnlichen Zusammenhängen ein ungeheurer Mißbrauch ge-
trieben wird) eines Gliedes versinnlichen sollen, ausgestattet
sind. Itten ist ein kluger Kopf und ein anregender, gebildeter
Lehrer, der namentlich auf den weiblichen Teil seiner
Schülerschaft einen berückenden Einfluß ausübt. Dies
wird hier mit guter Absicht vermerkt und dabei an das
erinnert, was ein so tiefschürfender Kritiker unserer Zeit
wie Walther Rathenau über den unheilvollen Einfluß der
Frau auf unser Kunstleben sagt. — Unter den Mitgliedern
des »Bundes der geistig Tätigen«, der im Künstlerhaus aus-
stellte, ist Ernst Wagner die sympathischeste und wohl
auch stärkste Persönlichkeit. Man täte ihm, der sich un-
zweifelhaft als Bildhauer am restlosesten und einwand-
freiesten auszudrücken versteht, aber unrecht, wollte man
ihn nach seinen Bildern und Zeichnungen beurteilen, und
daher kommt er für uns hier nicht in Betracht. Leopold
Krakauer versucht in einer umfangreichen Schwarz-Weiß-
Folge, die gleichfalls ganz auf die Wiedergabe von Gegen-
ständlichem verzichtet, ein so ungeheures Erlebnis wie den
Krieg darzustellen und mitzuteilen. Auch diese Arbeiten
können vom unvoreingenommenen Beschauer günstigsten-
falls nur dekorativ genommen und gewertet werden. Folgt
man den Erläuterungen des Autors, so erfährt man, daß
hier mit allerlei selbsterfundenen Zeichen, von denen manches
freilich Anspruch auf die Bedeutung eines allgemein gültigen
Symbols erhebt, ein von vornherein zur Aussichtslosigkeit
verurteilter Wettstreit mit der Musik unternommen ist.
Jene Wiener Künstler, die sich zum »Sonderbund« und
neuerdings in Salzburg zum »Wassermann« zusammen-
41 • —
wP