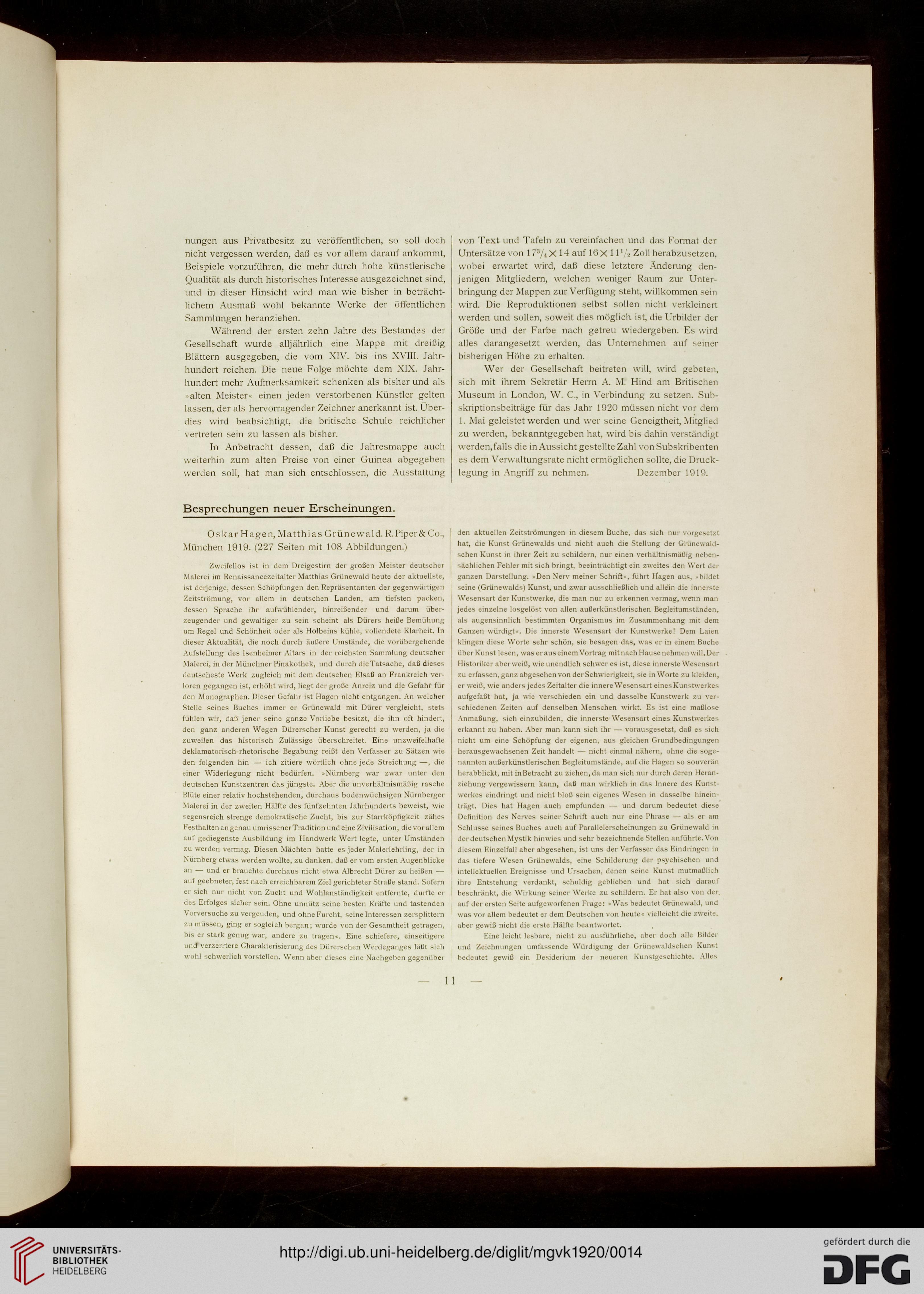nungen aus Privatbesitz zu veröffentlichen, so soll doch
nicht vergessen werden, daß es vor allem darauf ankommt,
Beispiele vorzuführen, die mehr durch hohe künstlerische
Qualität als durch historisches Interesse ausgezeichnet sind,
und in dieser Hinsicht wird man wie bisher in beträcht-
lichem Ausmaß wohl bekannte Werke der öffentlichen
Sammlungen heranziehen.
Während der ersten zehn Jahre des Bestandes der
Gesellschaft wurde alljährlich eine Mappe mit dreißig
Blättern ausgegeben, die vom XIV. bis ins XVIII. Jahr-
hundert reichen. Die neue Folge möchte dem XIX. Jahr-
hundert mehr Aufmerksamkeit schenken als bisher und als
»alten Meister« einen jeden verstorbenen Künstler gelten
lassen, der als hervorragender Zeichner anerkannt ist. Über-
dies wird beabsichtigt, die britische Schule reichlicher
vertreten sein zu lassen als bisher.
In Anbetracht dessen, daß die Jahresmappe auch
weiterhin zum alten Preise von einer Guinea abgegeben
werden soll, hat man sich entschlossen, die Ausstattung
von Text und Tafeln zu vereinfachen und das Format der
Untersätze von 173/i X 14 auf 16 X 111/« Zoll herabzusetzen,
wobei erwartet wird, daß diese letztere Änderung den-
jenigen Mitgliedern, welchen weniger Raum zur Unter-
bringung der Mappen zur Verfügung steht, willkommen sein
wird. Die Reproduktionen selbst sollen nicht verkleinert
werden und sollen, soweit dies möglich ist, die Urbilder der
Größe und der Farbe nach getreu wiedergeben. Es wird
alles darangesetzt werden, das Unternehmen auf seiner
bisherigen Höhe zu erhalten.
Wer der Gesellschaft beitreten will, wird gebeten,
sich mit ihrem Sekretär Herrn A. M. Hind am Britischen
Museum in London, W. C, in Verbindung zu setzen. Sub-
skriptionsbeiträge für das Jahr 1920 müssen nicht vor dem
1. Mai geleistet werden und wer seine Geneigtheit, Mitglied
zu werden, bekanntgegeben hat, wird bis dahin verständigt
werden, falls die in Aussicht gestellte Zahl von Subskribenten
es dem Verwaltungsrate nicht ermöglichen sollte, die Druck-
legung in Angriff zu nehmen. Dezember 1919.
Besprechungen neuer Erscheinungen.
Oskar Hagen, Matthias Grünewald. R.Piper & Co.,
München 1919. (227 Seiten mit 108 Abbildungen.)
Zweitellos ist in dem Dreigestirn der großen Meister deutschei
Malerei im Renaissancezeitalter Matthias Grünewald heute der aktuellste,
ist derjenige, dessen Schöpfungen den Repräsentanten der gegenwärtigen
Zeitsti ümung, vor allem in deutschen Landen, am tiefsten packen,
dessen Sprache ihr aufwühlende], hinreißender und darum über-
zeugender und gewaltiger zu sein scheint als Dürers heiße Bemühung
um Regel und Schönheit oder als Holbeins kühle, vollendete Klarheit. In
dieser Aktualität, die noch durch äußere Umstände, die vorübergehende
Aufstellung des Isenheimer Altars in der reichsten Sammlung deutscher
Malerei, in der Münchner Pinakothek, und durch die Tatsache, daß dieses
deutscheste Werk zugleich mit dem deutschen Elsaß an Frankreich ver-
loren gegangen ist, erhöht wird, liegt der große Anreiz und die Gefahr für
den Monographen. Dieser Gefahr ist Hagen nicht entgangen. An welcher
Stelle seines Buches immer er Grünewald mit Dürer vergleicht, stets
fühlen wir, daß jener seine ganze Vorliebe besitzt, die ihn oft hindert,
den ganz andeien Wegen Dürerscher Kunst gerecht zu werden, ja die
zuweilen das historisch Zulässige überschreitet. Eine unzweifelhafte
deklamatorisch-rhetorische Begabung reißt den Verfasser zu Sätzen wie
den folgenden hin — ich zitiere wörtlich ohne jede Streichung —, die
einer Widerlegung nicht bedürfen. »Nürnberg war zwar unter den
deutschen Kunstzentren das jüngste. Aber die unverhältnismäßig rasche
Blüte einer relativ hochstehenden, durchaus bodenwüehsigen Nürnberger
Malerei in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts beweist, wie
segensreich strenge demokratische Zucht, bis zur Starrköpfigkeit zähes
Festhalten an genau umrissener Tradition und eine Zivilisation, die vor allem
auf gediegenste Ausbildung im Handwerk Wert legte, unter Umständen
zu werden vermag. Diesen Mächten hatte es jeder Malerlehrling, der in
Nürnberg etwas werden wollte, zu danken, daß er vom ersten Augenblicke
.m — und er brauchte durchaus nicht etwa Albrecht Dürer zu heißen —
auf geebneter, fest nach erreichbarem Ziel gerichteter Straße stand. Sofern
er sich nur nicht von Zucht und Wohlanständigkeit entfernte, durfte er
des Erfolges sicher sein. Ohne unnütz seine besten Kräfte und tastenden
Vorversuche zu vergeuden, und ohne Furcht, seine Interessen zersplittern
zu müssen, ging er sogleich bergan; wurde von der Gesamtheit getragen,
bis er stark genug war, andere zu tragen«. Eine schiefere, einseitigere
und verzerrtere Charakterisierung des Dürersehen Werdeganges läßt sich
wohl schwerlich vorstellen. Wenn aber dieses eine Nachgeben gegenübei
den aktuellen Zeitströmungen in diesem Buche, das sich nur vorgesetzt
hat, die Kunst Grünewalds und nicht auch die Stellung der GVünewald-
schen Kunst in ihrer Zeit zu schildern, nur einen verhältnismäßig neben-
sächlichen Fehler mit sich bringt, beeinträchtigt ein zweites den Weit dei
ganzen Darstellung. »Den Nerv meiner Schrift«, fuhrt Hagen aus, -bildet
seine (Grunewalds) Kunst, und zwar ausschließlich und allein die innerste
Wesensart der Kunstwerke, die man nur zu erkennen vermag, wenn man
jedes einzelne losgelöst von allen außerkünstlerischen Begleitumständen,
als augensinnlich bestimmten Organismus im Zusammenhang mit dem
Ganzen würdigt«. Die innerste Wesensart der Kunstwerke! Dem Laien
klingen diese Worte sehr schön, sie besagen das, was er in einem Buche
über Kunst lesen, was er aus einem Vortrag mit nach Hause nehmen will. Der
Historiker aber weiß, wie unendlich schwer es ist, diese innerste Wesensart
zu erfassen, ganz abgesehen von der Schwierigkeit, sie in Worte zu kleiden,
er weiß, wie anders jedes Zeitalter die innere Wesensart eines Kunstwerkes
aufgefaßt hat, ja wie verschieden ein und dasselbe Kunstwerk zu ver-
schiedenen Zeiten auf denselben Menschen wirkt. Es ist eine maßlose
Anmaßung, sich einzubilden, die innerste Wesensart eines Kunstwerkes
erkannt zu haben. Aber man kann sich ihr — vorausgesetzt, daß es sich
nicht um eine Schöpfung der eigenen, aus gleichen Grundbedingungen
herausgewachsenen Zeit handelt — nicht einmal nähern, ohne die soge-
nannten außerkünstlerischen Begleitumstände, auf die Hagen so souverän
herabblickt, mit in Betracht zu ziehen, da man sich nur durch deren Heran-
ziehung vergewissern kann, daß man wirklich in das Innere des Kunst-
werkes eindringt und nicht bloß sein eigenes Wesen in dasselbe hinein-
trägt. Dies hat Hagen auch empfunden — und darum bedeutet diese
Definition des Nerves seiner Schrift auch nur eine Phrase — als er am
Schlüsse seines Buches auch auf Parallelerscheinungen zu Grünewald in
der deutschen Mystik hinwies und sehr bezeichnende Stellen anführte. Von
diesem Einzelfall aber abgesehen, ist uns der Verfasser das Eindringen in
das tiefere Wesen Grünewalds, eine Schilderung der psychischen und
intellektuellen Ereignisse und Ursachen, denen seine Kunst mutmaßlich
ihre Entstehung verdankt, schuldig geblieben und hat sich darauf
beschränkt, die Wirkung seiner Werke zu schildern. Er hat also von der.
auf der ersten Seite aufgeworfenen Frage: »Was bedeutet Grunewald, und
was vor allem bedeutet er dem Deutschen von heute« vielleicht die zweite,
aber gewiß nicht die erste Hälfte beantwortet.
Eine leicht lesbare, nicht zu ausführliche, aber doch alle Bilder
und Zeichnungen umfassende Würdigung der Grünewaldschen Kunst
bedeutet gewiß ein Desiderium der neueren Kunstgeschichte, Alles
1 !
nicht vergessen werden, daß es vor allem darauf ankommt,
Beispiele vorzuführen, die mehr durch hohe künstlerische
Qualität als durch historisches Interesse ausgezeichnet sind,
und in dieser Hinsicht wird man wie bisher in beträcht-
lichem Ausmaß wohl bekannte Werke der öffentlichen
Sammlungen heranziehen.
Während der ersten zehn Jahre des Bestandes der
Gesellschaft wurde alljährlich eine Mappe mit dreißig
Blättern ausgegeben, die vom XIV. bis ins XVIII. Jahr-
hundert reichen. Die neue Folge möchte dem XIX. Jahr-
hundert mehr Aufmerksamkeit schenken als bisher und als
»alten Meister« einen jeden verstorbenen Künstler gelten
lassen, der als hervorragender Zeichner anerkannt ist. Über-
dies wird beabsichtigt, die britische Schule reichlicher
vertreten sein zu lassen als bisher.
In Anbetracht dessen, daß die Jahresmappe auch
weiterhin zum alten Preise von einer Guinea abgegeben
werden soll, hat man sich entschlossen, die Ausstattung
von Text und Tafeln zu vereinfachen und das Format der
Untersätze von 173/i X 14 auf 16 X 111/« Zoll herabzusetzen,
wobei erwartet wird, daß diese letztere Änderung den-
jenigen Mitgliedern, welchen weniger Raum zur Unter-
bringung der Mappen zur Verfügung steht, willkommen sein
wird. Die Reproduktionen selbst sollen nicht verkleinert
werden und sollen, soweit dies möglich ist, die Urbilder der
Größe und der Farbe nach getreu wiedergeben. Es wird
alles darangesetzt werden, das Unternehmen auf seiner
bisherigen Höhe zu erhalten.
Wer der Gesellschaft beitreten will, wird gebeten,
sich mit ihrem Sekretär Herrn A. M. Hind am Britischen
Museum in London, W. C, in Verbindung zu setzen. Sub-
skriptionsbeiträge für das Jahr 1920 müssen nicht vor dem
1. Mai geleistet werden und wer seine Geneigtheit, Mitglied
zu werden, bekanntgegeben hat, wird bis dahin verständigt
werden, falls die in Aussicht gestellte Zahl von Subskribenten
es dem Verwaltungsrate nicht ermöglichen sollte, die Druck-
legung in Angriff zu nehmen. Dezember 1919.
Besprechungen neuer Erscheinungen.
Oskar Hagen, Matthias Grünewald. R.Piper & Co.,
München 1919. (227 Seiten mit 108 Abbildungen.)
Zweitellos ist in dem Dreigestirn der großen Meister deutschei
Malerei im Renaissancezeitalter Matthias Grünewald heute der aktuellste,
ist derjenige, dessen Schöpfungen den Repräsentanten der gegenwärtigen
Zeitsti ümung, vor allem in deutschen Landen, am tiefsten packen,
dessen Sprache ihr aufwühlende], hinreißender und darum über-
zeugender und gewaltiger zu sein scheint als Dürers heiße Bemühung
um Regel und Schönheit oder als Holbeins kühle, vollendete Klarheit. In
dieser Aktualität, die noch durch äußere Umstände, die vorübergehende
Aufstellung des Isenheimer Altars in der reichsten Sammlung deutscher
Malerei, in der Münchner Pinakothek, und durch die Tatsache, daß dieses
deutscheste Werk zugleich mit dem deutschen Elsaß an Frankreich ver-
loren gegangen ist, erhöht wird, liegt der große Anreiz und die Gefahr für
den Monographen. Dieser Gefahr ist Hagen nicht entgangen. An welcher
Stelle seines Buches immer er Grünewald mit Dürer vergleicht, stets
fühlen wir, daß jener seine ganze Vorliebe besitzt, die ihn oft hindert,
den ganz andeien Wegen Dürerscher Kunst gerecht zu werden, ja die
zuweilen das historisch Zulässige überschreitet. Eine unzweifelhafte
deklamatorisch-rhetorische Begabung reißt den Verfasser zu Sätzen wie
den folgenden hin — ich zitiere wörtlich ohne jede Streichung —, die
einer Widerlegung nicht bedürfen. »Nürnberg war zwar unter den
deutschen Kunstzentren das jüngste. Aber die unverhältnismäßig rasche
Blüte einer relativ hochstehenden, durchaus bodenwüehsigen Nürnberger
Malerei in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts beweist, wie
segensreich strenge demokratische Zucht, bis zur Starrköpfigkeit zähes
Festhalten an genau umrissener Tradition und eine Zivilisation, die vor allem
auf gediegenste Ausbildung im Handwerk Wert legte, unter Umständen
zu werden vermag. Diesen Mächten hatte es jeder Malerlehrling, der in
Nürnberg etwas werden wollte, zu danken, daß er vom ersten Augenblicke
.m — und er brauchte durchaus nicht etwa Albrecht Dürer zu heißen —
auf geebneter, fest nach erreichbarem Ziel gerichteter Straße stand. Sofern
er sich nur nicht von Zucht und Wohlanständigkeit entfernte, durfte er
des Erfolges sicher sein. Ohne unnütz seine besten Kräfte und tastenden
Vorversuche zu vergeuden, und ohne Furcht, seine Interessen zersplittern
zu müssen, ging er sogleich bergan; wurde von der Gesamtheit getragen,
bis er stark genug war, andere zu tragen«. Eine schiefere, einseitigere
und verzerrtere Charakterisierung des Dürersehen Werdeganges läßt sich
wohl schwerlich vorstellen. Wenn aber dieses eine Nachgeben gegenübei
den aktuellen Zeitströmungen in diesem Buche, das sich nur vorgesetzt
hat, die Kunst Grünewalds und nicht auch die Stellung der GVünewald-
schen Kunst in ihrer Zeit zu schildern, nur einen verhältnismäßig neben-
sächlichen Fehler mit sich bringt, beeinträchtigt ein zweites den Weit dei
ganzen Darstellung. »Den Nerv meiner Schrift«, fuhrt Hagen aus, -bildet
seine (Grunewalds) Kunst, und zwar ausschließlich und allein die innerste
Wesensart der Kunstwerke, die man nur zu erkennen vermag, wenn man
jedes einzelne losgelöst von allen außerkünstlerischen Begleitumständen,
als augensinnlich bestimmten Organismus im Zusammenhang mit dem
Ganzen würdigt«. Die innerste Wesensart der Kunstwerke! Dem Laien
klingen diese Worte sehr schön, sie besagen das, was er in einem Buche
über Kunst lesen, was er aus einem Vortrag mit nach Hause nehmen will. Der
Historiker aber weiß, wie unendlich schwer es ist, diese innerste Wesensart
zu erfassen, ganz abgesehen von der Schwierigkeit, sie in Worte zu kleiden,
er weiß, wie anders jedes Zeitalter die innere Wesensart eines Kunstwerkes
aufgefaßt hat, ja wie verschieden ein und dasselbe Kunstwerk zu ver-
schiedenen Zeiten auf denselben Menschen wirkt. Es ist eine maßlose
Anmaßung, sich einzubilden, die innerste Wesensart eines Kunstwerkes
erkannt zu haben. Aber man kann sich ihr — vorausgesetzt, daß es sich
nicht um eine Schöpfung der eigenen, aus gleichen Grundbedingungen
herausgewachsenen Zeit handelt — nicht einmal nähern, ohne die soge-
nannten außerkünstlerischen Begleitumstände, auf die Hagen so souverän
herabblickt, mit in Betracht zu ziehen, da man sich nur durch deren Heran-
ziehung vergewissern kann, daß man wirklich in das Innere des Kunst-
werkes eindringt und nicht bloß sein eigenes Wesen in dasselbe hinein-
trägt. Dies hat Hagen auch empfunden — und darum bedeutet diese
Definition des Nerves seiner Schrift auch nur eine Phrase — als er am
Schlüsse seines Buches auch auf Parallelerscheinungen zu Grünewald in
der deutschen Mystik hinwies und sehr bezeichnende Stellen anführte. Von
diesem Einzelfall aber abgesehen, ist uns der Verfasser das Eindringen in
das tiefere Wesen Grünewalds, eine Schilderung der psychischen und
intellektuellen Ereignisse und Ursachen, denen seine Kunst mutmaßlich
ihre Entstehung verdankt, schuldig geblieben und hat sich darauf
beschränkt, die Wirkung seiner Werke zu schildern. Er hat also von der.
auf der ersten Seite aufgeworfenen Frage: »Was bedeutet Grunewald, und
was vor allem bedeutet er dem Deutschen von heute« vielleicht die zweite,
aber gewiß nicht die erste Hälfte beantwortet.
Eine leicht lesbare, nicht zu ausführliche, aber doch alle Bilder
und Zeichnungen umfassende Würdigung der Grünewaldschen Kunst
bedeutet gewiß ein Desiderium der neueren Kunstgeschichte, Alles
1 !