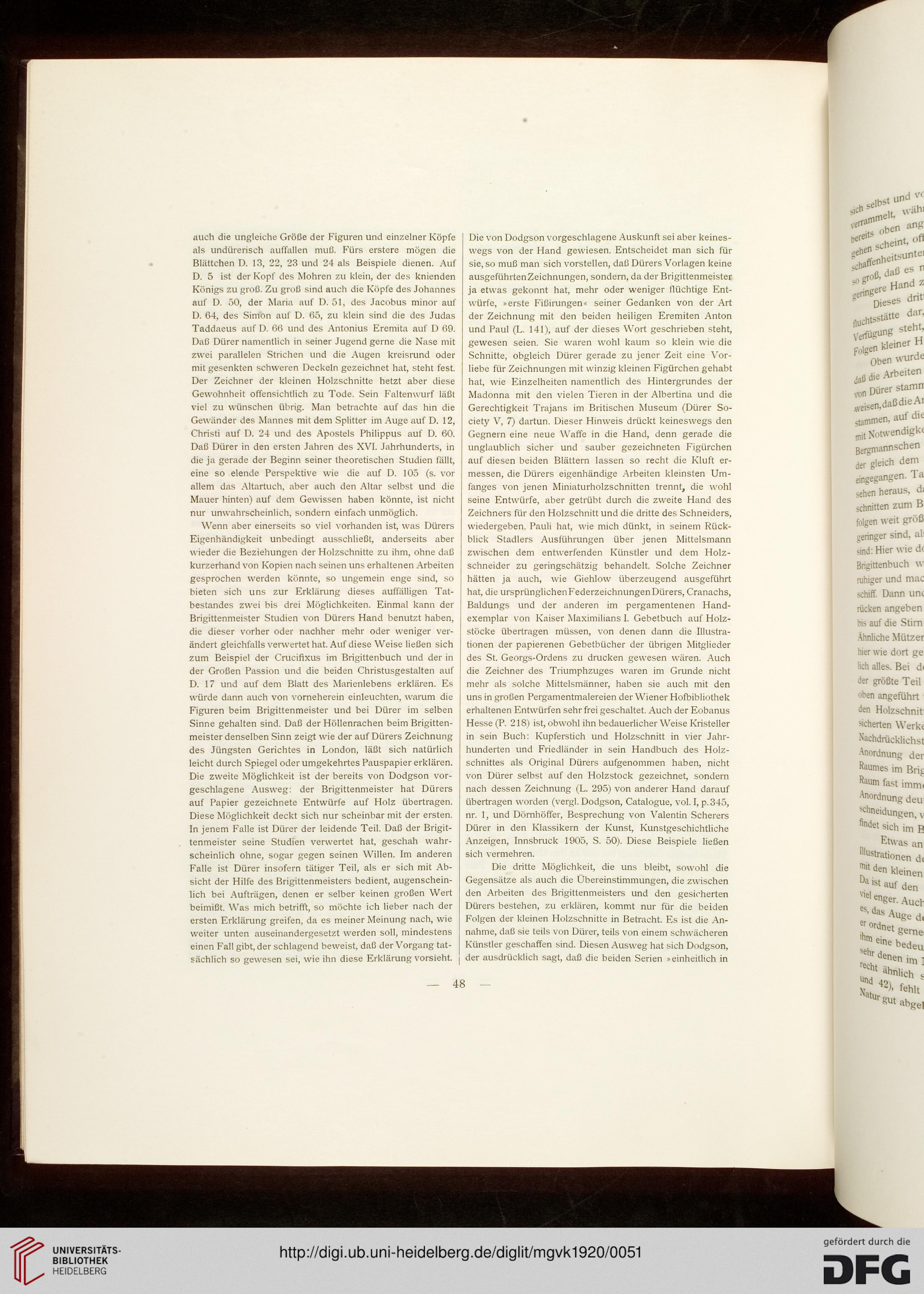ä<*sel
Ibst
un
atnm
elt.
auch die ungleiche Größe der Figuren und einzelner Köpfe
als undürerisch auffallen muß. Fürs erstere mögen die
Blättchen D. 13, 22, 23 und 24 als Beispiele dienen. Auf
D. 5 ist der Kopf des Mohren zu klein, der des knienden
Königs zu groß. Zu groß sind auch die Köpfe des Johannes
auf D. 50, der Maria auf D. 51, des Jacobus minor auf
D. 64, des Simon auf D. 65, zu klein sind die des Judas
Taddaeus auf D. 66 und des Antonius Eremita auf D 69.
Daß Dürer namentlich in seiner Jugend gerne die Nase mit
zwei parallelen Strichen vind die Augen kreisrund oder
mit gesenkten schweren Deckeln gezeichnet hat, steht fest.
Der Zeichner der kleinen Holzschnitte hetzt aber diese
Gewohnheit offensichtlich zu Tode. Sein Faltenwurf läßt
viel zu wünschen übrig. Man betrachte auf das hin die
Gewiinder des Mannes mit dem Splitter im Auge auf D. 12,
Christi auf D. 24 und des Apostels Philippus auf D. 60.
Daß Dürer in den ersten Jahren des XVI. Jahrhunderts, in
die ja gerade der Beginn seiner theoretischen Studien fällt,
eine so elende Perspektive wie die auf D. 105 (s. vor
allem das Altartuch, aber auch den Altar selbst und die
Mauer hinten) auf dem Gewissen haben könnte, ist nicht
nur unwahrscheinlich, sondern einfach unmöglich.
Wenn aber einerseits so viel vorhanden ist, was Dürers
Eigenhändigkeit unbedingt ausschließt, anderseits aber
wieder die Beziehungen der Holzschnitte zu ihm, ohne daß
kurzerhand von Kopien nach seinen uns erhaltenen Arbeiten
gesprochen werden könnte, so ungemein enge sind, so
bieten sich uns zur Erklärung dieses auffälligen Tat-
bestandes zwei bis drei Möglichkeiten. Einmal kann der
Brigittenmeister Studien von Dürers Hand benutzt haben,
die dieser vorher oder nachher mehr oder weniger ver-
ändert gleichfalls verwertet hat. Auf diese Weise ließen sich
zum Beispiel der Crucifixus im Brigittenbuch und der in
der Großen Passion und die beiden Christusgestalten auf
D. 17 und auf dem Blatt des Marienlebens erklären. Es
würde dann auch von vorneherein einleuchten, warum die
Figuren beim Brigittenmeister und bei Dürer im selben
Sinne gehalten sind. Daß der Höllenrachen beim Brigitten-
meister denselben Sinn zeigt wie der auf Dürers Zeichnung
des Jüngsten Gerichtes in London, läßt sich natürlich
leicht durch Spiegel oder umgekehrtes Pauspapier erklären.
Die zweite Möglichkeit ist der bereits von Dodgson vor-
geschlagene Ausweg: der Brigittenmeister hat Dürers
auf Papier gezeichnete Entwürfe auf Holz übertragen.
Diese Möglichkeit deckt sich nur scheinbar mit der ersten.
In jenem Falle ist Dürer der leidende Teil. Daß der Brigit-
tenmeister seine Studien verwertet hat, geschah wahr-
scheinlich ohne, sogar gegen seinen Willen. Im anderen
Falle ist Dürer insofern tätiger Teil, als er sich mit Ab-
sicht der Hilfe des Brigittenmeisters bedient, augenschein-
lich bei Aufträgen, denen er selber keinen großen Wert
beimißt. Was mich betrifft, so möchte ich lieber nach der
ersten Erklärung greifen, da es meiner Meinung nach, wie
weiter unten auseinandergesetzt werden soll, mindestens
einen Fall gibt, der schlagend beweist, daß der Vorgang tat-
sächlich so gewesen sei, wie ihn diese Erklärung vorsieht. |
Die von Dodgson vorgeschlagene Auskunft sei aber keines-
wegs von der Hand gewiesen. Entscheidet man sich für
sie, so muß man sich vorstellen, daß Dürers Vorlagen keine
ausgeführten Zeichnungen, sondern, da der Brigittenmeister
ja etwas gekonnt hat, mehr oder weniger flüchtige Ent-
würfe, »erste Fißirungen« seiner Gedanken von der Art
der Zeichnung mit den beiden heiligen Eremiten Anton
und Paul (L. 141), auf der dieses Wort geschrieben steht,
gewesen seien. Sie waren wohl kaum so klein wie die
Schnitte, obgleich Dürer gerade zu jener Zeit eine Vor-
liebe für Zeichnungen mit winzig kleinen Figürchen gehabt
hat, wie Einzelheiten namentlich des Hintergrundes der
Madonna mit den vielen Tieren in der Albertina und die
Gerechtigkeit Trajans im Britischen Museum (Dürer So-
ciety V, 7) dartun. Dieser Hinweis drückt keineswegs den
Gegnern eine neue Waffe in die Hand, denn gerade die
unglaublich sicher und sauber gezeichneten Figürchen
auf diesen beiden Blättern lassen so recht die Kluft er-
messen, die Dürers eigenhändige Arbeiten kleinsten Um-
fanges von jenen Miniaturholzschnitten trennt, die wohl
seine Entwürfe, aber getrübt durch die zweite Hand des
Zeichners für den Holzschnitt und die dritte des Schneiders,
wiedergeben. Pauli hat, wie mich dünkt, in seinem Rück-
blick Stadlers Ausführungen über jenen Mittelsmann
zwischen dem entwerfenden Künstler und dem Holz-
schneider zu geringschätzig behandelt. Solche Zeichner
hätten ja auch, wie Giehlow überzeugend ausgeführt
hat, die ursprünglichen Federzeichnungen Dürers, Cranachs,
Baidungs und der anderen im pergamentenen Hand-
exemplar von Kaiser Maximilians I. Gebetbuch auf Holz-
stöcke übertragen müssen, von denen dann die Illustra-
tionen der papierenen Gebetbücher der übrigen Mitglieder
des St. Georgs-Ordens zu drucken gewesen wären. Auch
die Zeichner des Triumphzuges waren im Grunde nicht
mehr als solche Mittelsmänner, haben sie auch mit den
uns in großen Pergamentmalereien der Wiener Hofbibliothek
erhaltenen Entwürfen sehr frei geschaltet. Auch der Eobanus
Hesse (P. 218) ist, obwohl ihn bedauerlicher Weise Kristeller
in sein Buch: Kupferstich und Holzschnitt in vier Jahr-
hunderten und Friedländer in sein Handbuch des Holz-
schnittes als Original Dürers aufgenommen haben, nicht
von Dürer selbst auf den Holzstock gezeichnet, sondern
nach dessen Zeichnung (L. 295) von anderer Hand darauf
übertragen worden (vergl. Dodgson, Catalogue, vol. I, p. 345,
nr. 1, und Dörnhöffer, Besprechung von Valentin Scherers
Dürer in den Klassikern der Kunst, Kunstgeschichtliche
Anzeigen, Innsbruck 1905, S. 50). Diese Beispiele ließen
sich vermehren.
Die dritte Möglichkeit, die uns bleibt, sowohl die
Gegensätze als auch die Übereinstimmungen, die zwischen
den Arbeiten des Brigittenmeisters und den gesicherten
Dürers bestehen, zu erklären, kommt nur für die beiden
Folgen der kleinen Holzschnitte in Betracht. Es ist die An-
nahme, daß sie teils von Dürer, teils von einem schwächeren
Künstler geschaffen sind. Diesen Ausweg hat sich Dodgson,
der ausdrücklich sagt, daß die beiden Serien »einheitlich in
bereit
d ^
viihi
aflg
irrt, "ft
CA»-
Diesem
fluchts;
statte
drit
dar,
teht,
Verfügung s
Folgen «einer«
Oben wurde
daß die Arbeiten
m Dürer staffln
u,i5en,daßdieA.
stemmen, auf du
„it Notwendige
Bergmannschen
der gleich dem
eingegangen. Ta
sehen heraus, di
schnitten zum B
folgen weit groß
ijennger sind, al:
sind: Hier wie d(
Brigittenbuch w
ruhiger und mac
schiff. Dann um
rucken angeben
bis auf die Stirn
Ahnliche Mutz er
hier wie dort ge
lieh alles. Bei di
der größte Teil
oben angeführt
Jen Holzschnit
sicherten Werkt
Nachdrücklichst
Anordnung der
Raumes im Brie
Raum fast \mm,
Anordnung deu
Verdungen, \
finde' sich im e
Etwas an
lllustrationen d«
™tden kleinen
Da«»auf den
VlelenSer.Aucl-
"S'dasAuged,
hrord** gerne
^nebedeu
■ehr dene
48
ri*ht
und
Vi,
nen mi ;
ähnlich -
42>> fehlt'
"ft absrpi
Ibst
un
atnm
elt.
auch die ungleiche Größe der Figuren und einzelner Köpfe
als undürerisch auffallen muß. Fürs erstere mögen die
Blättchen D. 13, 22, 23 und 24 als Beispiele dienen. Auf
D. 5 ist der Kopf des Mohren zu klein, der des knienden
Königs zu groß. Zu groß sind auch die Köpfe des Johannes
auf D. 50, der Maria auf D. 51, des Jacobus minor auf
D. 64, des Simon auf D. 65, zu klein sind die des Judas
Taddaeus auf D. 66 und des Antonius Eremita auf D 69.
Daß Dürer namentlich in seiner Jugend gerne die Nase mit
zwei parallelen Strichen vind die Augen kreisrund oder
mit gesenkten schweren Deckeln gezeichnet hat, steht fest.
Der Zeichner der kleinen Holzschnitte hetzt aber diese
Gewohnheit offensichtlich zu Tode. Sein Faltenwurf läßt
viel zu wünschen übrig. Man betrachte auf das hin die
Gewiinder des Mannes mit dem Splitter im Auge auf D. 12,
Christi auf D. 24 und des Apostels Philippus auf D. 60.
Daß Dürer in den ersten Jahren des XVI. Jahrhunderts, in
die ja gerade der Beginn seiner theoretischen Studien fällt,
eine so elende Perspektive wie die auf D. 105 (s. vor
allem das Altartuch, aber auch den Altar selbst und die
Mauer hinten) auf dem Gewissen haben könnte, ist nicht
nur unwahrscheinlich, sondern einfach unmöglich.
Wenn aber einerseits so viel vorhanden ist, was Dürers
Eigenhändigkeit unbedingt ausschließt, anderseits aber
wieder die Beziehungen der Holzschnitte zu ihm, ohne daß
kurzerhand von Kopien nach seinen uns erhaltenen Arbeiten
gesprochen werden könnte, so ungemein enge sind, so
bieten sich uns zur Erklärung dieses auffälligen Tat-
bestandes zwei bis drei Möglichkeiten. Einmal kann der
Brigittenmeister Studien von Dürers Hand benutzt haben,
die dieser vorher oder nachher mehr oder weniger ver-
ändert gleichfalls verwertet hat. Auf diese Weise ließen sich
zum Beispiel der Crucifixus im Brigittenbuch und der in
der Großen Passion und die beiden Christusgestalten auf
D. 17 und auf dem Blatt des Marienlebens erklären. Es
würde dann auch von vorneherein einleuchten, warum die
Figuren beim Brigittenmeister und bei Dürer im selben
Sinne gehalten sind. Daß der Höllenrachen beim Brigitten-
meister denselben Sinn zeigt wie der auf Dürers Zeichnung
des Jüngsten Gerichtes in London, läßt sich natürlich
leicht durch Spiegel oder umgekehrtes Pauspapier erklären.
Die zweite Möglichkeit ist der bereits von Dodgson vor-
geschlagene Ausweg: der Brigittenmeister hat Dürers
auf Papier gezeichnete Entwürfe auf Holz übertragen.
Diese Möglichkeit deckt sich nur scheinbar mit der ersten.
In jenem Falle ist Dürer der leidende Teil. Daß der Brigit-
tenmeister seine Studien verwertet hat, geschah wahr-
scheinlich ohne, sogar gegen seinen Willen. Im anderen
Falle ist Dürer insofern tätiger Teil, als er sich mit Ab-
sicht der Hilfe des Brigittenmeisters bedient, augenschein-
lich bei Aufträgen, denen er selber keinen großen Wert
beimißt. Was mich betrifft, so möchte ich lieber nach der
ersten Erklärung greifen, da es meiner Meinung nach, wie
weiter unten auseinandergesetzt werden soll, mindestens
einen Fall gibt, der schlagend beweist, daß der Vorgang tat-
sächlich so gewesen sei, wie ihn diese Erklärung vorsieht. |
Die von Dodgson vorgeschlagene Auskunft sei aber keines-
wegs von der Hand gewiesen. Entscheidet man sich für
sie, so muß man sich vorstellen, daß Dürers Vorlagen keine
ausgeführten Zeichnungen, sondern, da der Brigittenmeister
ja etwas gekonnt hat, mehr oder weniger flüchtige Ent-
würfe, »erste Fißirungen« seiner Gedanken von der Art
der Zeichnung mit den beiden heiligen Eremiten Anton
und Paul (L. 141), auf der dieses Wort geschrieben steht,
gewesen seien. Sie waren wohl kaum so klein wie die
Schnitte, obgleich Dürer gerade zu jener Zeit eine Vor-
liebe für Zeichnungen mit winzig kleinen Figürchen gehabt
hat, wie Einzelheiten namentlich des Hintergrundes der
Madonna mit den vielen Tieren in der Albertina und die
Gerechtigkeit Trajans im Britischen Museum (Dürer So-
ciety V, 7) dartun. Dieser Hinweis drückt keineswegs den
Gegnern eine neue Waffe in die Hand, denn gerade die
unglaublich sicher und sauber gezeichneten Figürchen
auf diesen beiden Blättern lassen so recht die Kluft er-
messen, die Dürers eigenhändige Arbeiten kleinsten Um-
fanges von jenen Miniaturholzschnitten trennt, die wohl
seine Entwürfe, aber getrübt durch die zweite Hand des
Zeichners für den Holzschnitt und die dritte des Schneiders,
wiedergeben. Pauli hat, wie mich dünkt, in seinem Rück-
blick Stadlers Ausführungen über jenen Mittelsmann
zwischen dem entwerfenden Künstler und dem Holz-
schneider zu geringschätzig behandelt. Solche Zeichner
hätten ja auch, wie Giehlow überzeugend ausgeführt
hat, die ursprünglichen Federzeichnungen Dürers, Cranachs,
Baidungs und der anderen im pergamentenen Hand-
exemplar von Kaiser Maximilians I. Gebetbuch auf Holz-
stöcke übertragen müssen, von denen dann die Illustra-
tionen der papierenen Gebetbücher der übrigen Mitglieder
des St. Georgs-Ordens zu drucken gewesen wären. Auch
die Zeichner des Triumphzuges waren im Grunde nicht
mehr als solche Mittelsmänner, haben sie auch mit den
uns in großen Pergamentmalereien der Wiener Hofbibliothek
erhaltenen Entwürfen sehr frei geschaltet. Auch der Eobanus
Hesse (P. 218) ist, obwohl ihn bedauerlicher Weise Kristeller
in sein Buch: Kupferstich und Holzschnitt in vier Jahr-
hunderten und Friedländer in sein Handbuch des Holz-
schnittes als Original Dürers aufgenommen haben, nicht
von Dürer selbst auf den Holzstock gezeichnet, sondern
nach dessen Zeichnung (L. 295) von anderer Hand darauf
übertragen worden (vergl. Dodgson, Catalogue, vol. I, p. 345,
nr. 1, und Dörnhöffer, Besprechung von Valentin Scherers
Dürer in den Klassikern der Kunst, Kunstgeschichtliche
Anzeigen, Innsbruck 1905, S. 50). Diese Beispiele ließen
sich vermehren.
Die dritte Möglichkeit, die uns bleibt, sowohl die
Gegensätze als auch die Übereinstimmungen, die zwischen
den Arbeiten des Brigittenmeisters und den gesicherten
Dürers bestehen, zu erklären, kommt nur für die beiden
Folgen der kleinen Holzschnitte in Betracht. Es ist die An-
nahme, daß sie teils von Dürer, teils von einem schwächeren
Künstler geschaffen sind. Diesen Ausweg hat sich Dodgson,
der ausdrücklich sagt, daß die beiden Serien »einheitlich in
bereit
d ^
viihi
aflg
irrt, "ft
CA»-
Diesem
fluchts;
statte
drit
dar,
teht,
Verfügung s
Folgen «einer«
Oben wurde
daß die Arbeiten
m Dürer staffln
u,i5en,daßdieA.
stemmen, auf du
„it Notwendige
Bergmannschen
der gleich dem
eingegangen. Ta
sehen heraus, di
schnitten zum B
folgen weit groß
ijennger sind, al:
sind: Hier wie d(
Brigittenbuch w
ruhiger und mac
schiff. Dann um
rucken angeben
bis auf die Stirn
Ahnliche Mutz er
hier wie dort ge
lieh alles. Bei di
der größte Teil
oben angeführt
Jen Holzschnit
sicherten Werkt
Nachdrücklichst
Anordnung der
Raumes im Brie
Raum fast \mm,
Anordnung deu
Verdungen, \
finde' sich im e
Etwas an
lllustrationen d«
™tden kleinen
Da«»auf den
VlelenSer.Aucl-
"S'dasAuged,
hrord** gerne
^nebedeu
■ehr dene
48
ri*ht
und
Vi,
nen mi ;
ähnlich -
42>> fehlt'
"ft absrpi