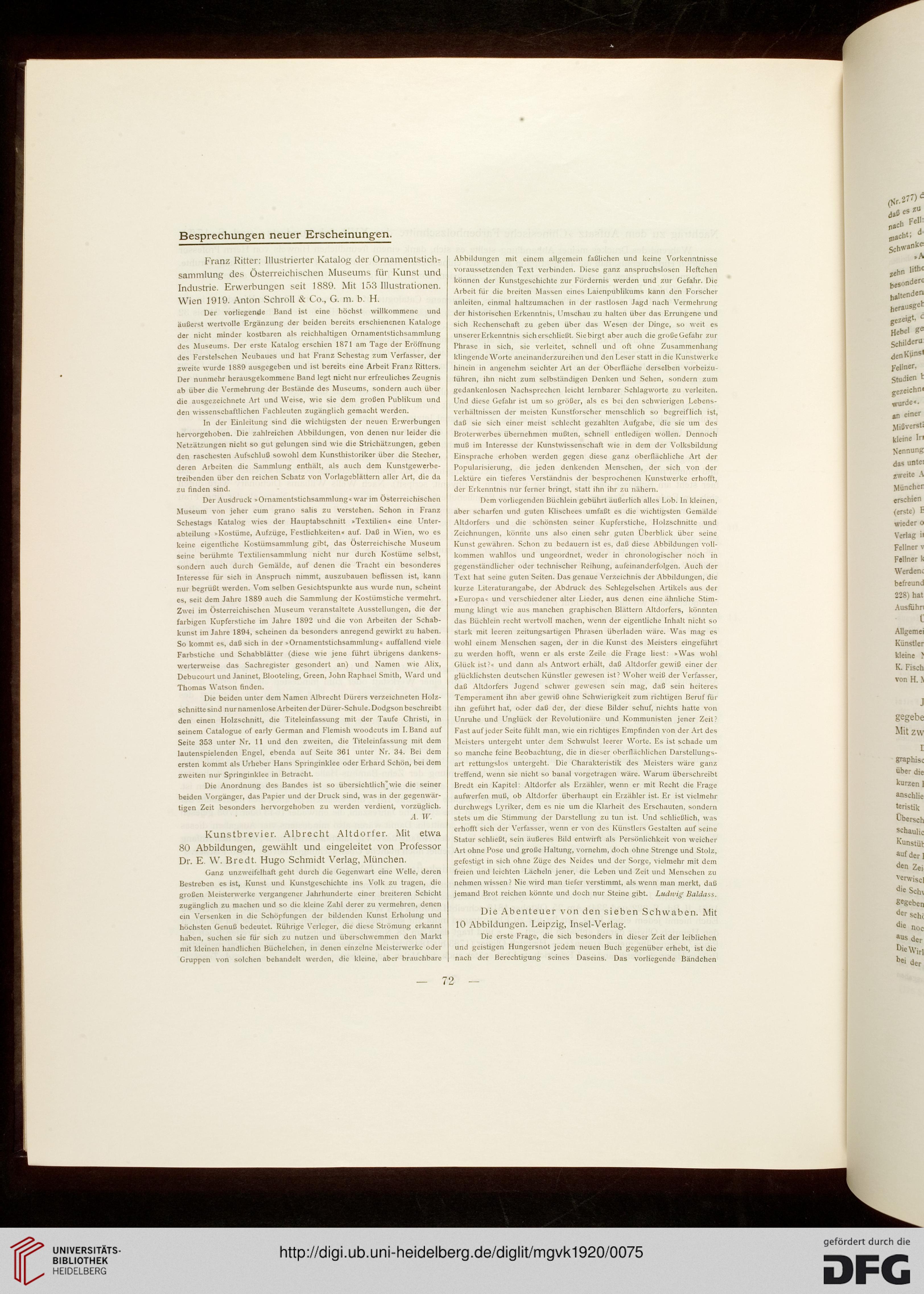Besprechungen neuer Erscheinungen.
Franz Ritter: Illustrierter Katalog der Ornamentstich-
sammlung des Österreichischen Museums für Kunst und
Industrie. Erwerbungen seit 1889. Mit 153 Illustrationen.
Wien 1919. Anton Schroll & Co., G. m. b. H.
Der vorliegende Band ist eine höchst willkommene und
äußerst wertvolle Ergänzung der beiden bereits erschienenen Kataloge
der nicht minder kostbaren als reichhaltigen Ornamentstichsammlung
des Museums. Der erste Katalog erschien 1871 am Tage der Eröffnung
des Ferstelschen Neubaues und hat Franz Schestag zum Verfasser, der
zweite wurde 18S9 ausgegeben und ist bereits eine Arbeit Franz Ritters.
Der nunmehr herausgekommene Band legt nicht nur erfreuliches Zeugnis
ab über die Vermehrung der Bestände des Museums, sondern auch über
die ausgezeichnete Art und Weise, wie sie dem großen Publikum und
den wissenschaftlichen Fachleuten zugänglich gemacht werden.
In der Einleitung sind die wichtigsten der neuen Erwerbungen
hervorgehoben. Die zahlreichen Abbildungen, von denen nur leider die
Netzätzungen nicht so gut gelungen sind wie die Strichätzungen, geben
den raschesten Aufschluß sowohl dem Kunsthistoriker über die Stecher,
deren Arbeiten die Sammlung enthält, als auch dem Kunstgewerbe-
treibenden über den reichen Schatz von Vorlageblättern aller Art, die da
zu finden sind.
Der Ausdruck »Omamentstichsamnilung«war im Österreichischen
Museum von jeher cum grano satis zu verstehen. Schon in Franz
Schestags Katalog wies der Hauptabschnitt »Textilien« eine Unter-
abteilung »Kostüme, Aufzuge, Festlichkeiten« auf. Daß in Wien, wo es
keine eigentliche Kostümsammlung gibt, das Österreichische Museum
seine berühmte Textiliensammlung nicht nur durch Kostüme selbst,
sondern auch durch Gemälde, auf denen die Tracht ein besonderes
Interesse für sich in Anspruch nimmt, auszubauen beflissen ist, kann
nur begrüßt werden. Vom selben Gesichtspunkte aus wurde nun, scheint
es, seit dem Jahre 1889 auch die Sammlung der Kostümstiche vermehrt.
Zwei im Österreichischen Museum veranstaltete Ausstellungen, die der
farbigen Kupferstiche im Jahre 1892 und die von Arbeiten der Schab-
kunst im Jahre 1894, scheinen da besonders anregend gewirkt zu haben.
So kommt es, daß sich in der »Ornamentstichsammlung« auffallend viele
Farbstiche und Schabblätter (diese wie jene führt übrigens dankens-
werterweise das Sachregister gesondert an) und Namen wie AHx,
Debucourt und Janinet, Blooteling, Green, John Raphael Smith, Ward und
Thomas Watson finden.
Die beiden unter dem Namen Albrecht Dürers verzeichneten Holz-
schnitte sind nur namenlose Arbeiten der Dürer-Schule. Dodgsonbeschreibt
den einen Holzschnitt, die Titeleinfassung mit der Taufe Christi, in
seinem Catalogue of early German and Flemish woodeuts im I.Band auf
Seite 353 unter Nr. 11 und den zweiten, die Titeleinfassung mit dem
lautenspielenden Engel, ebenda auf Seite 361 unter Nr. 34. Bei dem
ersten kommt als Urheber Hans Springinklee oder Erhard Schön, bei dem
zweiten nur Springinklee in Betracht.
Die Anordnung des Bandes ist so übersichtlich*wie die seiner
beiden Vorgänger, das Papier und der Druck sind, was in der gegenwär-
tigen Zeit besonders hervorgehoben zu werden verdient, vorzüglich.
A. W.
Kunstbrevier. Alb recht Altdorf er. Mit etwa
80 Abbildungen, gewählt und eingeleitet von Professor
Dr. E. W. Bredt. Hugo Schmidt Verlag, München.
Ganz unzweifelhaft geht durch die Gegenwart eine Welle, deren
Bestreben es ist, Kunst und Kunstgeschichte ins Volk zu tragen, die
großen Meisterwerke vergangener Jahrhunderte einer breiteren Schicht
zugänglich zu machen und so die kleine Zahl derer zu vermehren, denen
ein Versenken in die Schöpfungen der bildenden Kunst Erholung und
höchsten Genuß bedeutet. Rührige Verleger, die diese Strömung erkannt
haben, suchen sie für sich zu nutzen und überschwemmen den Markt
mit kleinen handlichen Büchelchen, in denen einzelne Meisterwerke oder
Gruppen von solchen behandelt werden, die kleine, aber brauchbare
Abbildungen mit einem allgemein faßlichen und keine Vorkenntnisse
voraussetzenden Text vei binden. Diese ganz anspruchslosen Heftchen
können der Kunstgeschichte zur Fordernis werden und zur Gefahr. Die
Arbeit für die breiten Massen eines Laienpublikums kann den Forscher
anleiten, einmal haltzumachen in der rastlosen Jagd nach Vermehrung
der historischen Erkenntnis, Umschau zu halten über das Errungene und
sich Rechenschaft zu geben über das Wese.n der Dinge, so weit es
unserer Erkenntnis sich erschließt. Sie birgt aber auch die große Gefahr zur
Phrase in sich, sie verleitet, schnell und oft ohne Zusammenhang
klingende Worte aneinanderzureihen und den Leser statt in die Kunstwerke
hinein in angenehm seichter Art an der Oberfläche derselben vorbeizu-
führen, ihn nicht zum selbständigen Denken und Sehen, sondern zum
gedankenlosen Nachsprechen leicht lernbarer Schlagworte zu verleiten.
Und diese Gefahr ist um so grußer, als es bei den schwierigen Lebens-
verhältnissen der meisten Kunstforscher menschlich so begreiflich ist,
daß sie sich einer meist schlecht gezahlten Aufgabe, die sie um des
Broterwerbes übernehmen mußten, schnell entledigen wollen. Dennoch
muß im Interesse der Kunstwissenschaft wie in dem der Volksbildung
Einsprache erhoben werden gegen diese ganz oberflächliche Art der
Popularisierung, die jeden denkenden Menschen, der sich von der
Lektüre ein tieferes Verständnis der besprochenen Kunstwerke erhofft,
der Erkenntnis nur ferner bringt, statt ihn ihr zu nähern.
Dem vorliegenden Büchlein gebührt äußerlich alles Lob. In kleinen,
aber scharfen und guten Klischees umfaßt es die wichtigsten Gemälde
Altdorfers und die schönsten seiner Kupferstiche, Holzschnitte und
Zeichnungen, könnte uns also einen sehr guten Überblick über seine
Kunst gewähren. Schon zu bedauern ist es, daß diese Abbildungen voll-
kommen wahllos und ungeordnet, weder in chronologischer noch in
gegenständlicher oder technischer Reihung, aufeinanderfolgen. Auch der
Test hat seine guten Seiten. Das genaue Verzeichnis der Abbildungen, die
kurze Literaturangabc, der Abdruck des Schlegelschen Artikels aus der
»Europa« und verschiedener alter Lieder, aus denen eine ähnliche Stim-
mung klingt wie aus manchen graphischen Blättern Altdorfers, konnten
das Büchlein recht wertvoll machen, wenn der eigentliche Inhalt nicht so
stark mit leeren zeitungsartigen Phrasen überladen wäre. Was mag es
wohl einem Menschen sagen, der in die Kunst des Meisters eingeführt
zu werden hofft, wenn er als erste Zeile die Frage liest: »Was wohl
Glück ist?« und dann als Antwort erhält, daß Altdorfer gewiß einer der
glücklichsten deutschen Künstler gewesen ist? Woher weiß der Verfasser,
daß Altdorfers Jugend schwer gewesen sein mag, daß sein heiteres
Temperament ihn aber gewiß ohne Schwierigkeit zum richtigen Beruf für
ihn geführt hat, oder daß der, der diese Bilder schuf, nichts hatte von
Unruhe und Unglück der Revolutionäre und Kommunisten jener Zeit?
Fast auf jeder Seite fühlt man, wie ein richtiges Empfinden von der Art des
Meisters untergeht unter dem Schwulst leerer Worte. Es ist schade um
so manche feine Beobachtung, die in dieser oberflächlichen Darstellungs-
art rettungslos untergeht. Die Charakteristik des Meisters wäre ganz
treffend, wenn sie nicht so banal vorgetragen wäre. Warum überschreibt
Bredt ein Kapitel: Altdorfer als Erzähler, wenn er mit Recht die Frage
aufwerfen muß, ob Altdorfer überhaupt ein Erzähler ist. Er ist vielmehr
durchwegs Lyriker, dem es nie um die Klarheit des Erschauten, sondern
stets um die Stimmung der Darstellung zu tun ist. Und schließlich, was
erhofft sich der Verfasser, wenn er von des Künstlers Gestalten auf seine
Statur schließt, sein äußeres Bild entwirft als Persönlichkeit von weicher
Art ohne Pose und große Haltung, vornehm, doch ohne Strenge und Stolz,
gefestigt in sich ohne Züge des Neides und der Sorge, vielmehr mit dem
freien und leichten Lächeln jener, die Leben und Zeit und Menschen zu
nehmen wissen? Nie wird man tiefer verstimmt, als wenn man merkt, daß
jemand Brot reichen könnte und doch nur Steine gibt. Ludwig Baldass,
Die Abenteuer von den sieben Schwaben. Mit
10 Abbildungen. Leipzig, Insel-Verlag.
Die erste Frage, die sich besonders in dieser Zeit der leiblichen
und geistigen Hungersnot jedem neuen Buch gegenüber erhebt, ist die
nach der Berechtigung seines Daseins. Das vorliegende Bändchen
— 72
Franz Ritter: Illustrierter Katalog der Ornamentstich-
sammlung des Österreichischen Museums für Kunst und
Industrie. Erwerbungen seit 1889. Mit 153 Illustrationen.
Wien 1919. Anton Schroll & Co., G. m. b. H.
Der vorliegende Band ist eine höchst willkommene und
äußerst wertvolle Ergänzung der beiden bereits erschienenen Kataloge
der nicht minder kostbaren als reichhaltigen Ornamentstichsammlung
des Museums. Der erste Katalog erschien 1871 am Tage der Eröffnung
des Ferstelschen Neubaues und hat Franz Schestag zum Verfasser, der
zweite wurde 18S9 ausgegeben und ist bereits eine Arbeit Franz Ritters.
Der nunmehr herausgekommene Band legt nicht nur erfreuliches Zeugnis
ab über die Vermehrung der Bestände des Museums, sondern auch über
die ausgezeichnete Art und Weise, wie sie dem großen Publikum und
den wissenschaftlichen Fachleuten zugänglich gemacht werden.
In der Einleitung sind die wichtigsten der neuen Erwerbungen
hervorgehoben. Die zahlreichen Abbildungen, von denen nur leider die
Netzätzungen nicht so gut gelungen sind wie die Strichätzungen, geben
den raschesten Aufschluß sowohl dem Kunsthistoriker über die Stecher,
deren Arbeiten die Sammlung enthält, als auch dem Kunstgewerbe-
treibenden über den reichen Schatz von Vorlageblättern aller Art, die da
zu finden sind.
Der Ausdruck »Omamentstichsamnilung«war im Österreichischen
Museum von jeher cum grano satis zu verstehen. Schon in Franz
Schestags Katalog wies der Hauptabschnitt »Textilien« eine Unter-
abteilung »Kostüme, Aufzuge, Festlichkeiten« auf. Daß in Wien, wo es
keine eigentliche Kostümsammlung gibt, das Österreichische Museum
seine berühmte Textiliensammlung nicht nur durch Kostüme selbst,
sondern auch durch Gemälde, auf denen die Tracht ein besonderes
Interesse für sich in Anspruch nimmt, auszubauen beflissen ist, kann
nur begrüßt werden. Vom selben Gesichtspunkte aus wurde nun, scheint
es, seit dem Jahre 1889 auch die Sammlung der Kostümstiche vermehrt.
Zwei im Österreichischen Museum veranstaltete Ausstellungen, die der
farbigen Kupferstiche im Jahre 1892 und die von Arbeiten der Schab-
kunst im Jahre 1894, scheinen da besonders anregend gewirkt zu haben.
So kommt es, daß sich in der »Ornamentstichsammlung« auffallend viele
Farbstiche und Schabblätter (diese wie jene führt übrigens dankens-
werterweise das Sachregister gesondert an) und Namen wie AHx,
Debucourt und Janinet, Blooteling, Green, John Raphael Smith, Ward und
Thomas Watson finden.
Die beiden unter dem Namen Albrecht Dürers verzeichneten Holz-
schnitte sind nur namenlose Arbeiten der Dürer-Schule. Dodgsonbeschreibt
den einen Holzschnitt, die Titeleinfassung mit der Taufe Christi, in
seinem Catalogue of early German and Flemish woodeuts im I.Band auf
Seite 353 unter Nr. 11 und den zweiten, die Titeleinfassung mit dem
lautenspielenden Engel, ebenda auf Seite 361 unter Nr. 34. Bei dem
ersten kommt als Urheber Hans Springinklee oder Erhard Schön, bei dem
zweiten nur Springinklee in Betracht.
Die Anordnung des Bandes ist so übersichtlich*wie die seiner
beiden Vorgänger, das Papier und der Druck sind, was in der gegenwär-
tigen Zeit besonders hervorgehoben zu werden verdient, vorzüglich.
A. W.
Kunstbrevier. Alb recht Altdorf er. Mit etwa
80 Abbildungen, gewählt und eingeleitet von Professor
Dr. E. W. Bredt. Hugo Schmidt Verlag, München.
Ganz unzweifelhaft geht durch die Gegenwart eine Welle, deren
Bestreben es ist, Kunst und Kunstgeschichte ins Volk zu tragen, die
großen Meisterwerke vergangener Jahrhunderte einer breiteren Schicht
zugänglich zu machen und so die kleine Zahl derer zu vermehren, denen
ein Versenken in die Schöpfungen der bildenden Kunst Erholung und
höchsten Genuß bedeutet. Rührige Verleger, die diese Strömung erkannt
haben, suchen sie für sich zu nutzen und überschwemmen den Markt
mit kleinen handlichen Büchelchen, in denen einzelne Meisterwerke oder
Gruppen von solchen behandelt werden, die kleine, aber brauchbare
Abbildungen mit einem allgemein faßlichen und keine Vorkenntnisse
voraussetzenden Text vei binden. Diese ganz anspruchslosen Heftchen
können der Kunstgeschichte zur Fordernis werden und zur Gefahr. Die
Arbeit für die breiten Massen eines Laienpublikums kann den Forscher
anleiten, einmal haltzumachen in der rastlosen Jagd nach Vermehrung
der historischen Erkenntnis, Umschau zu halten über das Errungene und
sich Rechenschaft zu geben über das Wese.n der Dinge, so weit es
unserer Erkenntnis sich erschließt. Sie birgt aber auch die große Gefahr zur
Phrase in sich, sie verleitet, schnell und oft ohne Zusammenhang
klingende Worte aneinanderzureihen und den Leser statt in die Kunstwerke
hinein in angenehm seichter Art an der Oberfläche derselben vorbeizu-
führen, ihn nicht zum selbständigen Denken und Sehen, sondern zum
gedankenlosen Nachsprechen leicht lernbarer Schlagworte zu verleiten.
Und diese Gefahr ist um so grußer, als es bei den schwierigen Lebens-
verhältnissen der meisten Kunstforscher menschlich so begreiflich ist,
daß sie sich einer meist schlecht gezahlten Aufgabe, die sie um des
Broterwerbes übernehmen mußten, schnell entledigen wollen. Dennoch
muß im Interesse der Kunstwissenschaft wie in dem der Volksbildung
Einsprache erhoben werden gegen diese ganz oberflächliche Art der
Popularisierung, die jeden denkenden Menschen, der sich von der
Lektüre ein tieferes Verständnis der besprochenen Kunstwerke erhofft,
der Erkenntnis nur ferner bringt, statt ihn ihr zu nähern.
Dem vorliegenden Büchlein gebührt äußerlich alles Lob. In kleinen,
aber scharfen und guten Klischees umfaßt es die wichtigsten Gemälde
Altdorfers und die schönsten seiner Kupferstiche, Holzschnitte und
Zeichnungen, könnte uns also einen sehr guten Überblick über seine
Kunst gewähren. Schon zu bedauern ist es, daß diese Abbildungen voll-
kommen wahllos und ungeordnet, weder in chronologischer noch in
gegenständlicher oder technischer Reihung, aufeinanderfolgen. Auch der
Test hat seine guten Seiten. Das genaue Verzeichnis der Abbildungen, die
kurze Literaturangabc, der Abdruck des Schlegelschen Artikels aus der
»Europa« und verschiedener alter Lieder, aus denen eine ähnliche Stim-
mung klingt wie aus manchen graphischen Blättern Altdorfers, konnten
das Büchlein recht wertvoll machen, wenn der eigentliche Inhalt nicht so
stark mit leeren zeitungsartigen Phrasen überladen wäre. Was mag es
wohl einem Menschen sagen, der in die Kunst des Meisters eingeführt
zu werden hofft, wenn er als erste Zeile die Frage liest: »Was wohl
Glück ist?« und dann als Antwort erhält, daß Altdorfer gewiß einer der
glücklichsten deutschen Künstler gewesen ist? Woher weiß der Verfasser,
daß Altdorfers Jugend schwer gewesen sein mag, daß sein heiteres
Temperament ihn aber gewiß ohne Schwierigkeit zum richtigen Beruf für
ihn geführt hat, oder daß der, der diese Bilder schuf, nichts hatte von
Unruhe und Unglück der Revolutionäre und Kommunisten jener Zeit?
Fast auf jeder Seite fühlt man, wie ein richtiges Empfinden von der Art des
Meisters untergeht unter dem Schwulst leerer Worte. Es ist schade um
so manche feine Beobachtung, die in dieser oberflächlichen Darstellungs-
art rettungslos untergeht. Die Charakteristik des Meisters wäre ganz
treffend, wenn sie nicht so banal vorgetragen wäre. Warum überschreibt
Bredt ein Kapitel: Altdorfer als Erzähler, wenn er mit Recht die Frage
aufwerfen muß, ob Altdorfer überhaupt ein Erzähler ist. Er ist vielmehr
durchwegs Lyriker, dem es nie um die Klarheit des Erschauten, sondern
stets um die Stimmung der Darstellung zu tun ist. Und schließlich, was
erhofft sich der Verfasser, wenn er von des Künstlers Gestalten auf seine
Statur schließt, sein äußeres Bild entwirft als Persönlichkeit von weicher
Art ohne Pose und große Haltung, vornehm, doch ohne Strenge und Stolz,
gefestigt in sich ohne Züge des Neides und der Sorge, vielmehr mit dem
freien und leichten Lächeln jener, die Leben und Zeit und Menschen zu
nehmen wissen? Nie wird man tiefer verstimmt, als wenn man merkt, daß
jemand Brot reichen könnte und doch nur Steine gibt. Ludwig Baldass,
Die Abenteuer von den sieben Schwaben. Mit
10 Abbildungen. Leipzig, Insel-Verlag.
Die erste Frage, die sich besonders in dieser Zeit der leiblichen
und geistigen Hungersnot jedem neuen Buch gegenüber erhebt, ist die
nach der Berechtigung seines Daseins. Das vorliegende Bändchen
— 72