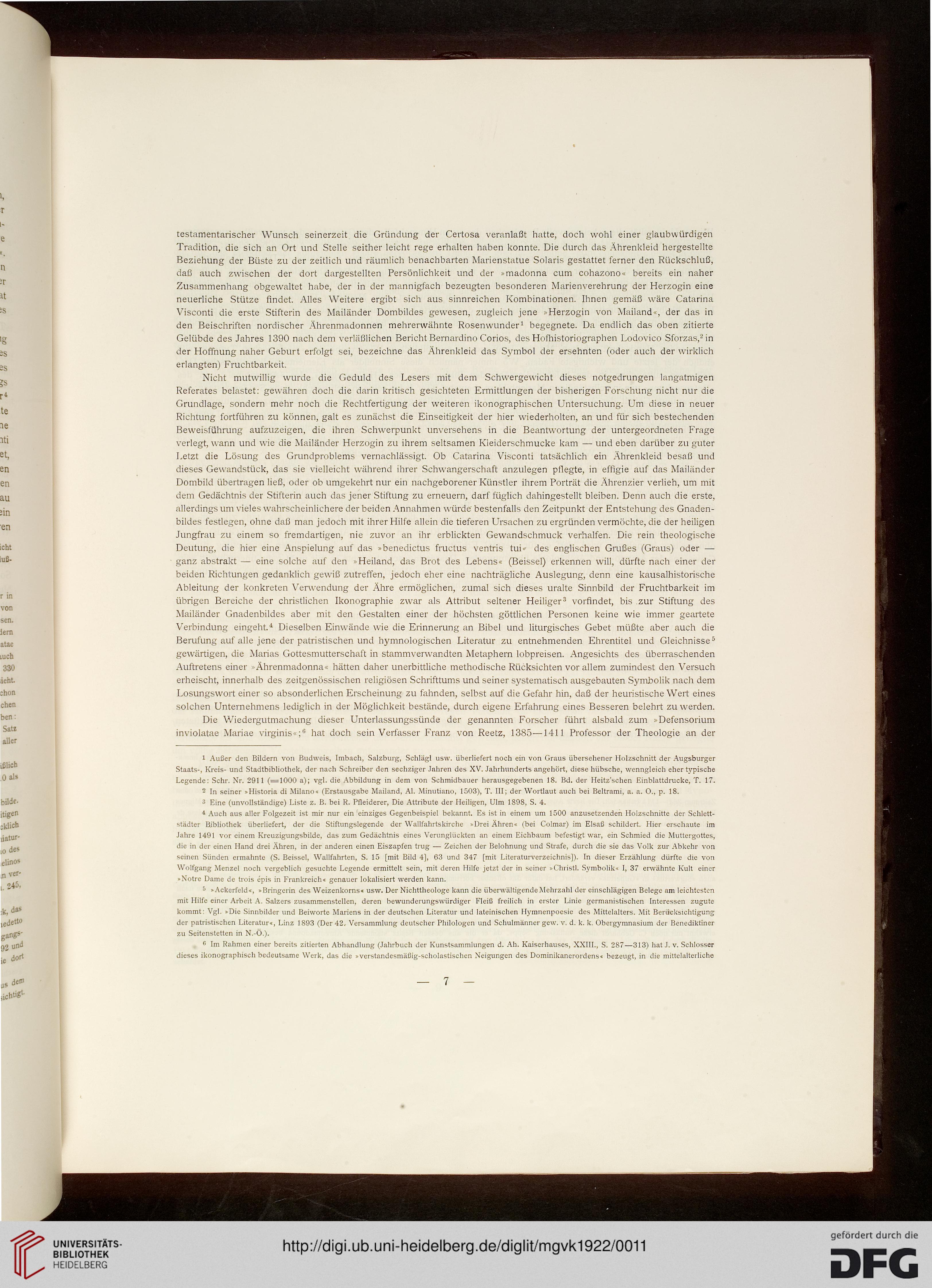testamentarischer Wunsch seinerzeit die Gründung der Certosa veranlaßt hatte, doch wohl einer glaubwürdigen
Tradition, die sich an Ort und Stelle seither leicht rege erhalten haben konnte. Die durch das Ährenkleid hergestellte
Beziehung der Büste zu der zeitlich und räumlich benachbarten Marienstatue Solaris gestattet ferner den Rückschluß,
daß auch zwischen der dort dargestellten Persönlichkeit und der »madonna cum cohazono« bereits ein naher
Zusammenhang obgewaltet habe, der in der mannigfach bezeugten besonderen Marienverehrung der Herzogin eine
neuerliche Stütze findet. Alles Weitere ergibt sich aus sinnreichen Kombinationen. Ihnen gemäß wäre Catarina
Visconti die erste Stifterin des Mailänder Dombildes gewesen, zugleich jene »Herzogin von Mailand«, der das in
den Beischriften nordischer Ährenmadonnen mehrerwähnte Rosenwunder1 begegnete. Da endlich das oben zitierte
Gelübde des Jahres 1390 nach dem verläßlichen Bericht Bernardino Corios, des Hofhistoriographen Lodovico Sforzas,2in
der Hoffnung naher Geburt erfolgt sei, bezeichne das Ährenkleid das Symbol der ersehnten (oder auch der wirklich
erlangten) Fruchtbarkeit.
Nicht mutwillig wurde die Geduld des Lesers mit dem Schwergewicht dieses notgedrungen langatmigen
Referates belastet: gewähren doch die darin kritisch gesichteten Ermittlungen der bisherigen Forschung nicht nur die
Grundlage, sondern mehr noch die Rechtfertigung der weiteren ikonographischen Untersuchung. Um diese in neuer
Richtung fortführen zu können, galt es zunächst die Einseitigkeit der hier wiederholten, an und für sich bestechenden
Beweisführung aufzuzeigen, die ihren Schwerpunkt unversehens in die Beantwortung der untergeordneten Frage
verlegt, wann und wie die Mailänder Herzogin zu ihrem seltsamen Kieiderschmucke kam — und eben darüber zu guter
Letzt die Lösung des Grundproblems vernachlässigt. Ob Catarina Visconti tatsächlich ein Ährenkleid besaß und
dieses Gewandstück, das sie vielleicht während ihrer Schwangerschaft anzulegen pflegte, in effigie auf das Mailänder
Dombild übertragen ließ, oder ob umgekehrt nur ein nachgeborener Künstler ihrem Porträt die Ährenzier verlieh, um mit
dem Gedächtnis der Stifterin auch das jener Stiftung zu erneuern, darf füglich dahingestellt bleiben. Denn auch die erste,
allerdings um vieles wahrscheinlichere der beiden Annahmen würde bestenfalls den Zeitpunkt der Entstehung des Gnaden-
bildes festlegen, ohne daß man jedoch mit ihrer Hilfe allein die tieferen Ursachen zu ergründen vermöchte, die der heiligen
Jungfrau zu einem so fremdartigen, nie zuvor an ihr erblickten Gewandschmuck verhalfen. Die rein theologische
Deutung, die hier eine Anspielung auf das »benedictus fructus ventris tui« des englischen Grußes (Graus) oder —
ganz abstrakt — eine solche auf den »Heiland, das Brot des Lebens« (Beissel) erkennen will, dürfte nach einer der
beiden Richtungen gedanklich gewiß zutreffen, jedoch eher eine nachträgliche Auslegung, denn eine kausalhistorische
Ableitung der konkreten Verwendung der Ähre ermöglichen, zumal sich dieses uralte Sinnbild der Fruchtbarkeit im
übrigen Bereiche der christlichen Ikonographie zwar als Attribut seltener Heiliger3 vorfindet, bis .zur Stiftung des
Mailänder Gnadenbildes aber mit den Gestalten einer der höchsten göttlichen Personen keine wie immer geartete
Verbindung eingeht.4 Dieselben Einwände wie die Erinnerung an Bibel und liturgisches Gebet müßte aber auch die
Berufung auf alle jene der patristischen und hymnologischen Literatur zu entnehmenden Ehrentitel und Gleichnisse5
gewärtigen, die Marias Gottesmutterschaft in stammverwandten Metaphern lobpreisen. Angesichts des überraschenden
Auftretens einer »Ährenmadonna« hätten daher unerbittliche methodische Rücksichten vor allem zumindest den Versuch
erheischt, innerhalb des zeitgenössischen religiösen Schrifttums und seiner systematisch ausgebauten Symbolik nach dem
Losungswort einer so absonderlichen Erscheinung zu fahnden, selbst auf die Gefahr hin, daß der heuristische Wert eines
solchen Unternehmens lediglich in der Möglichkeit bestände, durch eigene Erfahrung eines Besseren belehrt zu werden.
Die Wiedergutmachung dieser Unterlassungssünde der genannten Forscher führt alsbald zum »Defensorium
inviolatae Mariae virginis«;G hat doch sein Verfasser Franz von Reetz, 1385—1411 Professor der Theologie an der
; und
dort
1 Außer den Bildern von Budweis, Imbach, Salzburg, Schlägt usw. überliefert noch ein von Graus übersehener Holzschnitt der Augsburger
Staats-, Kreis- und Stadtbibliothek, der nach Schreiber den sechziger Jahren des XV. Jahrhunderts angehört, diese hübsche, wenngleich eher typische
Legende: Sehr. Nr. 2911 (=1000 a); vgl. die Abbildung in dem von Schmidbauer herausgegebenen 18. Bd. der Heitz'schen Einblattdrucke, T. 17.
2 In seiner »Historia di Milano« (Erstausgabe Mailand, AI. Minutiano, 1503), T. III; der Wortlaut auch bei Beltrami. a. a. O.. p. 18.
3 Eine (unvollständige) Liste z. B. bei R. Pfleiderer, Die Attribute der Heiligen, Ulm 1898, S. 4.
* Auch aus aller Folgezeit ist mir nur ein einziges Gegenbeispiel bekannt. Es ist in einem um 1500 anzusetzenden Holzschnitte der Schlett-
städter Bibliothek überliefert, der die Stiftungslegende der Wallfahrtskirche »Drei Ähren« (bei Colmar) im Elsaß schildert. Hier erschaute im
Jahre 1491 vor einem Kreuzigungsbilde, das zum Gedächtnis eines Verunglückten an einem Eichbaum befestigt war, ein Schmied die Muttergottes,
die in der einen Hand drei Ähren, in der anderen einen Eiszapfen trug — Zeichen der Belohnung und Strafe, durch die sie das Volk zur Abkehr von
seinen Sünden ermahnte (S. Beissel, Wallfahrten, S. 15 [mit Bild 4], 63 und 347 [mit Literaturverzeichnis]). In dieser Erzählung dürfte die von
Wolfgang Menzel noch vergeblich gesuchte Legende ermittelt sein, mit deren Hilfe jetzt der in seiner »Christi. Symbolik« I, 37 erwähnte Kult einer
»Notre Dame de trois epis in Frankreich« genauer lokalisiert werden kann.
5 »Ackerfeld«, »Bringen!» des Weizenkorns« usw. Der Nichttheologe kann die überwältigende Mehrzahl der einschlägigen Belege am leichtesten
mit Hilfe einer Arbeit A. Salzers zusammenstellen, deren bewunderungswürdiger Fleiß freilich in erster Linie germanistischen Interessen zugute
kommt: Vgl. »Die Sinnbilder und Beiworte Mariens in der deutschen Literatur und lateinischen Hymnenpoesie des Mittelalters. Mit Berücksichtigung
der patristischen Literatur«, Linz 1893 (Der 42. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner gew. v. d. k. k. Obergymnasium der Benediktiner
zu Seitenstetten in N.-Ö-).
r' Im Rahmen einer bereits zitierten Abhandlung (Jahrbuch der Kunstsammlungen d. Ah. Kaiserhauses, XXIII., S. 287—313) hat J. v. Schlosser
dieses ikonographisch bedeutsame Werk, das die »verstandesmäßig-scholastischen Neigungen des Dominikanerordens« bezeugt, in die mittelalterliche
i de"1
— 7
Tradition, die sich an Ort und Stelle seither leicht rege erhalten haben konnte. Die durch das Ährenkleid hergestellte
Beziehung der Büste zu der zeitlich und räumlich benachbarten Marienstatue Solaris gestattet ferner den Rückschluß,
daß auch zwischen der dort dargestellten Persönlichkeit und der »madonna cum cohazono« bereits ein naher
Zusammenhang obgewaltet habe, der in der mannigfach bezeugten besonderen Marienverehrung der Herzogin eine
neuerliche Stütze findet. Alles Weitere ergibt sich aus sinnreichen Kombinationen. Ihnen gemäß wäre Catarina
Visconti die erste Stifterin des Mailänder Dombildes gewesen, zugleich jene »Herzogin von Mailand«, der das in
den Beischriften nordischer Ährenmadonnen mehrerwähnte Rosenwunder1 begegnete. Da endlich das oben zitierte
Gelübde des Jahres 1390 nach dem verläßlichen Bericht Bernardino Corios, des Hofhistoriographen Lodovico Sforzas,2in
der Hoffnung naher Geburt erfolgt sei, bezeichne das Ährenkleid das Symbol der ersehnten (oder auch der wirklich
erlangten) Fruchtbarkeit.
Nicht mutwillig wurde die Geduld des Lesers mit dem Schwergewicht dieses notgedrungen langatmigen
Referates belastet: gewähren doch die darin kritisch gesichteten Ermittlungen der bisherigen Forschung nicht nur die
Grundlage, sondern mehr noch die Rechtfertigung der weiteren ikonographischen Untersuchung. Um diese in neuer
Richtung fortführen zu können, galt es zunächst die Einseitigkeit der hier wiederholten, an und für sich bestechenden
Beweisführung aufzuzeigen, die ihren Schwerpunkt unversehens in die Beantwortung der untergeordneten Frage
verlegt, wann und wie die Mailänder Herzogin zu ihrem seltsamen Kieiderschmucke kam — und eben darüber zu guter
Letzt die Lösung des Grundproblems vernachlässigt. Ob Catarina Visconti tatsächlich ein Ährenkleid besaß und
dieses Gewandstück, das sie vielleicht während ihrer Schwangerschaft anzulegen pflegte, in effigie auf das Mailänder
Dombild übertragen ließ, oder ob umgekehrt nur ein nachgeborener Künstler ihrem Porträt die Ährenzier verlieh, um mit
dem Gedächtnis der Stifterin auch das jener Stiftung zu erneuern, darf füglich dahingestellt bleiben. Denn auch die erste,
allerdings um vieles wahrscheinlichere der beiden Annahmen würde bestenfalls den Zeitpunkt der Entstehung des Gnaden-
bildes festlegen, ohne daß man jedoch mit ihrer Hilfe allein die tieferen Ursachen zu ergründen vermöchte, die der heiligen
Jungfrau zu einem so fremdartigen, nie zuvor an ihr erblickten Gewandschmuck verhalfen. Die rein theologische
Deutung, die hier eine Anspielung auf das »benedictus fructus ventris tui« des englischen Grußes (Graus) oder —
ganz abstrakt — eine solche auf den »Heiland, das Brot des Lebens« (Beissel) erkennen will, dürfte nach einer der
beiden Richtungen gedanklich gewiß zutreffen, jedoch eher eine nachträgliche Auslegung, denn eine kausalhistorische
Ableitung der konkreten Verwendung der Ähre ermöglichen, zumal sich dieses uralte Sinnbild der Fruchtbarkeit im
übrigen Bereiche der christlichen Ikonographie zwar als Attribut seltener Heiliger3 vorfindet, bis .zur Stiftung des
Mailänder Gnadenbildes aber mit den Gestalten einer der höchsten göttlichen Personen keine wie immer geartete
Verbindung eingeht.4 Dieselben Einwände wie die Erinnerung an Bibel und liturgisches Gebet müßte aber auch die
Berufung auf alle jene der patristischen und hymnologischen Literatur zu entnehmenden Ehrentitel und Gleichnisse5
gewärtigen, die Marias Gottesmutterschaft in stammverwandten Metaphern lobpreisen. Angesichts des überraschenden
Auftretens einer »Ährenmadonna« hätten daher unerbittliche methodische Rücksichten vor allem zumindest den Versuch
erheischt, innerhalb des zeitgenössischen religiösen Schrifttums und seiner systematisch ausgebauten Symbolik nach dem
Losungswort einer so absonderlichen Erscheinung zu fahnden, selbst auf die Gefahr hin, daß der heuristische Wert eines
solchen Unternehmens lediglich in der Möglichkeit bestände, durch eigene Erfahrung eines Besseren belehrt zu werden.
Die Wiedergutmachung dieser Unterlassungssünde der genannten Forscher führt alsbald zum »Defensorium
inviolatae Mariae virginis«;G hat doch sein Verfasser Franz von Reetz, 1385—1411 Professor der Theologie an der
; und
dort
1 Außer den Bildern von Budweis, Imbach, Salzburg, Schlägt usw. überliefert noch ein von Graus übersehener Holzschnitt der Augsburger
Staats-, Kreis- und Stadtbibliothek, der nach Schreiber den sechziger Jahren des XV. Jahrhunderts angehört, diese hübsche, wenngleich eher typische
Legende: Sehr. Nr. 2911 (=1000 a); vgl. die Abbildung in dem von Schmidbauer herausgegebenen 18. Bd. der Heitz'schen Einblattdrucke, T. 17.
2 In seiner »Historia di Milano« (Erstausgabe Mailand, AI. Minutiano, 1503), T. III; der Wortlaut auch bei Beltrami. a. a. O.. p. 18.
3 Eine (unvollständige) Liste z. B. bei R. Pfleiderer, Die Attribute der Heiligen, Ulm 1898, S. 4.
* Auch aus aller Folgezeit ist mir nur ein einziges Gegenbeispiel bekannt. Es ist in einem um 1500 anzusetzenden Holzschnitte der Schlett-
städter Bibliothek überliefert, der die Stiftungslegende der Wallfahrtskirche »Drei Ähren« (bei Colmar) im Elsaß schildert. Hier erschaute im
Jahre 1491 vor einem Kreuzigungsbilde, das zum Gedächtnis eines Verunglückten an einem Eichbaum befestigt war, ein Schmied die Muttergottes,
die in der einen Hand drei Ähren, in der anderen einen Eiszapfen trug — Zeichen der Belohnung und Strafe, durch die sie das Volk zur Abkehr von
seinen Sünden ermahnte (S. Beissel, Wallfahrten, S. 15 [mit Bild 4], 63 und 347 [mit Literaturverzeichnis]). In dieser Erzählung dürfte die von
Wolfgang Menzel noch vergeblich gesuchte Legende ermittelt sein, mit deren Hilfe jetzt der in seiner »Christi. Symbolik« I, 37 erwähnte Kult einer
»Notre Dame de trois epis in Frankreich« genauer lokalisiert werden kann.
5 »Ackerfeld«, »Bringen!» des Weizenkorns« usw. Der Nichttheologe kann die überwältigende Mehrzahl der einschlägigen Belege am leichtesten
mit Hilfe einer Arbeit A. Salzers zusammenstellen, deren bewunderungswürdiger Fleiß freilich in erster Linie germanistischen Interessen zugute
kommt: Vgl. »Die Sinnbilder und Beiworte Mariens in der deutschen Literatur und lateinischen Hymnenpoesie des Mittelalters. Mit Berücksichtigung
der patristischen Literatur«, Linz 1893 (Der 42. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner gew. v. d. k. k. Obergymnasium der Benediktiner
zu Seitenstetten in N.-Ö-).
r' Im Rahmen einer bereits zitierten Abhandlung (Jahrbuch der Kunstsammlungen d. Ah. Kaiserhauses, XXIII., S. 287—313) hat J. v. Schlosser
dieses ikonographisch bedeutsame Werk, das die »verstandesmäßig-scholastischen Neigungen des Dominikanerordens« bezeugt, in die mittelalterliche
i de"1
— 7