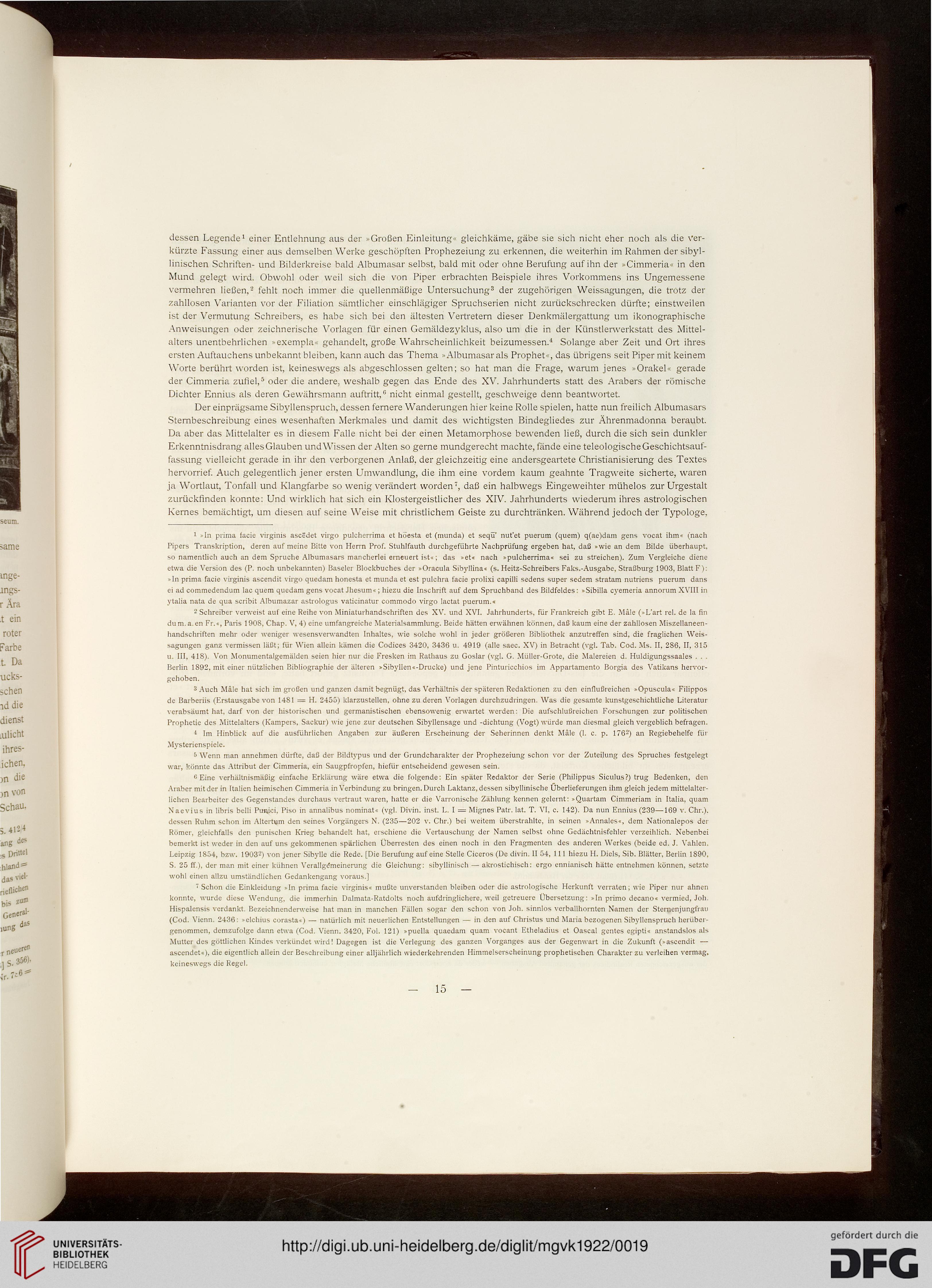i viel"
zum
dessen Legende1 einer Entlehnung aus der »Großen Einleitung« gleichkäme, gäbe sie sich nicht eher noch als die ver-
kürzte Fassung einer aus demselben Werke geschöpften Prophezeiung zu erkennen, die weiterhin im Rahmen der sibyl-
linischen Schriften- und Bilderkreise bald Albumasar selbst, bald mit oder ohne Berufung auf ihn der »Cimmeria« in den
Mund gelegt wird. Obwohl oder weil sich die von Piper erbrachten Beispiele ihres Vorkommens ins Ungemessene
vermehren ließen,2 fehlt noch immer die quellenmäßige Untersuchung3 der zugehörigen Weissagungen, die trotz der
zahllosen Varianten vor der Filiation sämtlicher einschlägiger Spruchserien nicht zurückschrecken dürfte; einstweilen
ist der Vermutung Schreibers, es habe sich bei den ältesten Vertretern dieser Denkmälergattung um ikonographische
Anweisungen oder zeichnerische Vorlagen für einen Gemäldezyklus, also um die in der Künstlerwerkstatt des Mittel-
alters unentbehrlichen »exempla« gehandelt, große Wahrscheinlichkeit beizumessen.4 Solange aber Zeit und Ort ihres
ersten Auftauchens unbekannt bleiben, kann auch das Thema »Albumasar als Prophet«, das übrigens seit Piper mit keinem
Worte berührt worden ist, keineswegs als abgeschlossen gelten; so hat man die Frage, warum jenes »Orakel« gerade
der Cimmeria zufiel,5 oder die andere, weshalb gegen das Ende des XV. Jahrhunderts statt des Arabers der römische
Dichter Ennius als deren Gewährsmann auftritt/ nicht einmal gestellt, geschweige denn beantwortet.
Der einprägsame Sibyllenspruch, dessen fernere Wanderungen hier keine Rolle spielen, hatte nun freilich Albumasars
Sternbeschreibung eines wesenhaften Merkmales und damit des wichtigsten Bindegliedes zur Ährenmadonna beraubt.
Da aber das Mittelalter es in diesem Falle nicht bei der einen Metamorphose bewenden ließ, durch die sich sein dunkler
Erkenntnisdrang alles Glauben und Wissen der Alten so gerne mundgerecht machte, fände eine teleologische Geschichtsauf-
fassung vielleicht gerade in ihr den verborgenen Anlaß, der gleichzeitig eine andersgeartete Christianisierung des Textes
hervorrief. Auch gelegentlich jener ersten Umwandlung, die ihm eine vordem kaum geahnte Tragweite sicherte, waren
ja Wortlaut, Tonfall und Klangfarbe so wenig verändert worden7, daß ein halbwegs Eingeweihter mühelos zur Urgestalt
zurückfinden konnte: Und wirklich hat sich ein Klostergeistlicher des XIV. Jahrhunderts wiederum ihres astrologischen
Kernes bemächtigt, um diesen auf seine Weise mit christlichem Geiste zu durchtränken. Während jedoch der Typologe,
1 »In prima facie virginis ascedet virgo pulcherrima et höesta et (munda) et seqü' nut'et puerum (quem) q(ae)dam gens vocat ihm« (nach
Pipers Transkription, deren auf meine Bitte von Herrn Prof. Stuhlfauth durchgeführte Nachprüfung ergeben hat, daß »wie an dem Bilde überhaupt,
so namentlich auch an dem Spruche Albumasars mancherlei erneuert ist«; das »et« nach »pulcherrima« sei zu streichen). Zum Vergleiche diene
etwa die Version des (P. noch unbekannten) Baseler Blockbuches der »Oracula Sibyllina« (s. Heitz-Schreibers Faks.-Ausgabe, Straßburg 1903, Blatt F):
»In prima facie virginis ascendit virgo quedam honesta et munda et est pulchra facie prolixi capilli sedens super sedem stratam nutriens puerum dans
ei ad commedendum lac quem quedam gens vocat Jhesum« ; hiezu die Inschrift auf dem Spruchband des Bildfeldes : »Sibiila eyemeria annorum XVIII in
ytalia nata de qua scribit Albumazar astrologus vaticinatur commodo virgo lactat puerum.«
2 Schreiber verweist auf eine Reihe von Miniaturhandschriften des XV. und XVI. Jahrhunderts, für Frankreich gibt E. Male (»L'art rel. de la fin
dum.a.en Fr.«, Paris 1908, Chap. V, 4) eine umfangreiche Materialsammlung. Beide hätten erwähnen können, daß kaum eine der zahllosen Miszellaneen-
handschriften mehr oder weniger wesensverwandten Inhaltes, wie solche wohl in jeder größeren Bibliothek anzutreffen sind, die fraglichen Weis-
sagungen ganz vermissen läßt; für Wien allein kämen die Codices 3420, 3436 u. 4919 (alle saec. XV) in Betracht (vgl. Tab. Cod. Ms. II. 286. II, 315
u. III. 418). Von Monumentalgemälden seien hier nur die Fresken im Rathaus zu Goslar (vgl. G. Müller-Grote, die Malereien d. Huldigungssaales . . .
Berlin 1892, mit einer nützlichen Bibliographie der älteren >Sibyllen«-Drucke) und jene Pinturicchios im Appartamento Borgia des Vatikans hervor-
gehoben.
3 Auch Male hat sich im großen und ganzen damit begnügt, das Verhältnis der späteren Redaktionen zu den einflußreichen »Opuscula* Filippos
de Barberüs (Erstausgabe von 1481 = H. 2455) klarzustellen, ohne zu deren Vorlagen durchzudringen. Was die gesamte kunstgeschichtliche Literatur
verabsäumt hat, darf von der historischen und germanistischen ebensowenig erwartet werden: Die aufschlußreichen Forschungen zur politischen
Prophetie des Mittelalters (Kampers, Sackur) wie jene zur deutschen Sibyllensage und -dichtung (Vogt) würde man diesmal gleich vergeblich befragen.
■i Im Hinblick auf die ausführlichen Angaben zur äußeren Erscheinung der Seherinnen denkt Male (1. c. p. 1762) an Regiebehelfe für
Mysterienspiele.
5 Wenn man annehmen dürfte, daß der Bildtypus und der Grundcharakter der Prophezeiung schon vor der Zuteilung des Spruches festgelegt
war, könnte das Attribut der Cimmeria, ein Saugpfropfen, hiefür entscheidend gewesen sein.
6 Eine verhältnismäßig einfache Erklärung wäre etwa die folgende: Ein später Redaktor der Serie (Philippus Siculus?) trug Bedenken, den
Araber mit der in Italien heimischen Cimmeria in Verbindung zu bringen. Durch Laktanz, dessen sibyllmische Überlieferungen ihm gleich jedem mittelalter-
lichen Bearbeiter des Gegenstandes durchaus vertraut waren, hatte er die Varronische Zählung kennen gelernt: »Quartam Cimmeriam in Italia, quam
Naevius in libris belli Puiüci, Piso in annalibus nominat« (vgl. Divin. inst. L. I = Mignes Patr. lat. T. VI, c. 142). Da nun Ennius (239—169 v. Chr.).
dessen Ruhm schon im Altertvm den seines Vorgängers N. (235—202 v. Chr.) bei weitem überstrahlte, in seinen »Annales«, dem Nationalepos der
Römer, gleichfalls den punischen Krieg behandelt hat, erschiene die Vertauschung der Namen selbst ohne Gedächtnisfehler verzeihlich. Nebenbei
bemerkt ist weder in den auf uns gekommenen spärlichen Überresten des einen noch in den Fragmenten des anderen Werkes (beide ed. J. Vahlen.
Leipzig 1854, bzw. 19032) von jener Sibylle die Rede. [Die Berufung auf eine Stelle Ciceros (De divin. II 54, 111 hiezu H. Diels, Sib. Blätter, Berlin 1890.
S. 25 ff.), der man mit einer kühnen Verallgemeinerung die Gleichung: sibyllinisch — akrostichisch: ergo ennianisch hätte entnehmen können, setzte
wohl einen allzu umständlichen Gedankengang voraus.]
" Schon die Einkleidung -In prima facie virginis« mußte unverstanden bleiben oder die astrologische Herkunft verraten; wie Piper nur ahnen
konnte, wurde diese Wendung, die immerhin Dalmata-Ratdolts noch aufdringlichere, weil getreuere Übersetzung: »In primo decano« vermied, Joh.
Hispalensis verdankt. Bezeichnenderweise hat man in manchen Fällen sogar den schon von Joh. sinnlos verballhornten Namen der Sternenjungfrau
(Cod. Vienn. 2436: »elchius corasta«) — natürlich mit neuerlichen Entstellungen — in den auf Christus und Maria bezogenen Sibyllenspruch herüber-
genommen, demzufolge dann etwa (Cod. Vienn. 3420, Fol. 121) »puella quaedam quam vocant Etheladius et Oascal gentes egipti« anstandslos als
Mutter des göttlichen Kindes verkündet wird! Dagegen ist die Verlegung des ganzen Vorganges aus der Gegenwart in die Zukunft (»ascendit —
ascendet«), die eigentlich allein der Beschreibung einer alljährlich wiederkehrenden Himmelserscheinung prophetischen Charakter zu verleihen vermag,
keineswegs die Regel.
15 —
zum
dessen Legende1 einer Entlehnung aus der »Großen Einleitung« gleichkäme, gäbe sie sich nicht eher noch als die ver-
kürzte Fassung einer aus demselben Werke geschöpften Prophezeiung zu erkennen, die weiterhin im Rahmen der sibyl-
linischen Schriften- und Bilderkreise bald Albumasar selbst, bald mit oder ohne Berufung auf ihn der »Cimmeria« in den
Mund gelegt wird. Obwohl oder weil sich die von Piper erbrachten Beispiele ihres Vorkommens ins Ungemessene
vermehren ließen,2 fehlt noch immer die quellenmäßige Untersuchung3 der zugehörigen Weissagungen, die trotz der
zahllosen Varianten vor der Filiation sämtlicher einschlägiger Spruchserien nicht zurückschrecken dürfte; einstweilen
ist der Vermutung Schreibers, es habe sich bei den ältesten Vertretern dieser Denkmälergattung um ikonographische
Anweisungen oder zeichnerische Vorlagen für einen Gemäldezyklus, also um die in der Künstlerwerkstatt des Mittel-
alters unentbehrlichen »exempla« gehandelt, große Wahrscheinlichkeit beizumessen.4 Solange aber Zeit und Ort ihres
ersten Auftauchens unbekannt bleiben, kann auch das Thema »Albumasar als Prophet«, das übrigens seit Piper mit keinem
Worte berührt worden ist, keineswegs als abgeschlossen gelten; so hat man die Frage, warum jenes »Orakel« gerade
der Cimmeria zufiel,5 oder die andere, weshalb gegen das Ende des XV. Jahrhunderts statt des Arabers der römische
Dichter Ennius als deren Gewährsmann auftritt/ nicht einmal gestellt, geschweige denn beantwortet.
Der einprägsame Sibyllenspruch, dessen fernere Wanderungen hier keine Rolle spielen, hatte nun freilich Albumasars
Sternbeschreibung eines wesenhaften Merkmales und damit des wichtigsten Bindegliedes zur Ährenmadonna beraubt.
Da aber das Mittelalter es in diesem Falle nicht bei der einen Metamorphose bewenden ließ, durch die sich sein dunkler
Erkenntnisdrang alles Glauben und Wissen der Alten so gerne mundgerecht machte, fände eine teleologische Geschichtsauf-
fassung vielleicht gerade in ihr den verborgenen Anlaß, der gleichzeitig eine andersgeartete Christianisierung des Textes
hervorrief. Auch gelegentlich jener ersten Umwandlung, die ihm eine vordem kaum geahnte Tragweite sicherte, waren
ja Wortlaut, Tonfall und Klangfarbe so wenig verändert worden7, daß ein halbwegs Eingeweihter mühelos zur Urgestalt
zurückfinden konnte: Und wirklich hat sich ein Klostergeistlicher des XIV. Jahrhunderts wiederum ihres astrologischen
Kernes bemächtigt, um diesen auf seine Weise mit christlichem Geiste zu durchtränken. Während jedoch der Typologe,
1 »In prima facie virginis ascedet virgo pulcherrima et höesta et (munda) et seqü' nut'et puerum (quem) q(ae)dam gens vocat ihm« (nach
Pipers Transkription, deren auf meine Bitte von Herrn Prof. Stuhlfauth durchgeführte Nachprüfung ergeben hat, daß »wie an dem Bilde überhaupt,
so namentlich auch an dem Spruche Albumasars mancherlei erneuert ist«; das »et« nach »pulcherrima« sei zu streichen). Zum Vergleiche diene
etwa die Version des (P. noch unbekannten) Baseler Blockbuches der »Oracula Sibyllina« (s. Heitz-Schreibers Faks.-Ausgabe, Straßburg 1903, Blatt F):
»In prima facie virginis ascendit virgo quedam honesta et munda et est pulchra facie prolixi capilli sedens super sedem stratam nutriens puerum dans
ei ad commedendum lac quem quedam gens vocat Jhesum« ; hiezu die Inschrift auf dem Spruchband des Bildfeldes : »Sibiila eyemeria annorum XVIII in
ytalia nata de qua scribit Albumazar astrologus vaticinatur commodo virgo lactat puerum.«
2 Schreiber verweist auf eine Reihe von Miniaturhandschriften des XV. und XVI. Jahrhunderts, für Frankreich gibt E. Male (»L'art rel. de la fin
dum.a.en Fr.«, Paris 1908, Chap. V, 4) eine umfangreiche Materialsammlung. Beide hätten erwähnen können, daß kaum eine der zahllosen Miszellaneen-
handschriften mehr oder weniger wesensverwandten Inhaltes, wie solche wohl in jeder größeren Bibliothek anzutreffen sind, die fraglichen Weis-
sagungen ganz vermissen läßt; für Wien allein kämen die Codices 3420, 3436 u. 4919 (alle saec. XV) in Betracht (vgl. Tab. Cod. Ms. II. 286. II, 315
u. III. 418). Von Monumentalgemälden seien hier nur die Fresken im Rathaus zu Goslar (vgl. G. Müller-Grote, die Malereien d. Huldigungssaales . . .
Berlin 1892, mit einer nützlichen Bibliographie der älteren >Sibyllen«-Drucke) und jene Pinturicchios im Appartamento Borgia des Vatikans hervor-
gehoben.
3 Auch Male hat sich im großen und ganzen damit begnügt, das Verhältnis der späteren Redaktionen zu den einflußreichen »Opuscula* Filippos
de Barberüs (Erstausgabe von 1481 = H. 2455) klarzustellen, ohne zu deren Vorlagen durchzudringen. Was die gesamte kunstgeschichtliche Literatur
verabsäumt hat, darf von der historischen und germanistischen ebensowenig erwartet werden: Die aufschlußreichen Forschungen zur politischen
Prophetie des Mittelalters (Kampers, Sackur) wie jene zur deutschen Sibyllensage und -dichtung (Vogt) würde man diesmal gleich vergeblich befragen.
■i Im Hinblick auf die ausführlichen Angaben zur äußeren Erscheinung der Seherinnen denkt Male (1. c. p. 1762) an Regiebehelfe für
Mysterienspiele.
5 Wenn man annehmen dürfte, daß der Bildtypus und der Grundcharakter der Prophezeiung schon vor der Zuteilung des Spruches festgelegt
war, könnte das Attribut der Cimmeria, ein Saugpfropfen, hiefür entscheidend gewesen sein.
6 Eine verhältnismäßig einfache Erklärung wäre etwa die folgende: Ein später Redaktor der Serie (Philippus Siculus?) trug Bedenken, den
Araber mit der in Italien heimischen Cimmeria in Verbindung zu bringen. Durch Laktanz, dessen sibyllmische Überlieferungen ihm gleich jedem mittelalter-
lichen Bearbeiter des Gegenstandes durchaus vertraut waren, hatte er die Varronische Zählung kennen gelernt: »Quartam Cimmeriam in Italia, quam
Naevius in libris belli Puiüci, Piso in annalibus nominat« (vgl. Divin. inst. L. I = Mignes Patr. lat. T. VI, c. 142). Da nun Ennius (239—169 v. Chr.).
dessen Ruhm schon im Altertvm den seines Vorgängers N. (235—202 v. Chr.) bei weitem überstrahlte, in seinen »Annales«, dem Nationalepos der
Römer, gleichfalls den punischen Krieg behandelt hat, erschiene die Vertauschung der Namen selbst ohne Gedächtnisfehler verzeihlich. Nebenbei
bemerkt ist weder in den auf uns gekommenen spärlichen Überresten des einen noch in den Fragmenten des anderen Werkes (beide ed. J. Vahlen.
Leipzig 1854, bzw. 19032) von jener Sibylle die Rede. [Die Berufung auf eine Stelle Ciceros (De divin. II 54, 111 hiezu H. Diels, Sib. Blätter, Berlin 1890.
S. 25 ff.), der man mit einer kühnen Verallgemeinerung die Gleichung: sibyllinisch — akrostichisch: ergo ennianisch hätte entnehmen können, setzte
wohl einen allzu umständlichen Gedankengang voraus.]
" Schon die Einkleidung -In prima facie virginis« mußte unverstanden bleiben oder die astrologische Herkunft verraten; wie Piper nur ahnen
konnte, wurde diese Wendung, die immerhin Dalmata-Ratdolts noch aufdringlichere, weil getreuere Übersetzung: »In primo decano« vermied, Joh.
Hispalensis verdankt. Bezeichnenderweise hat man in manchen Fällen sogar den schon von Joh. sinnlos verballhornten Namen der Sternenjungfrau
(Cod. Vienn. 2436: »elchius corasta«) — natürlich mit neuerlichen Entstellungen — in den auf Christus und Maria bezogenen Sibyllenspruch herüber-
genommen, demzufolge dann etwa (Cod. Vienn. 3420, Fol. 121) »puella quaedam quam vocant Etheladius et Oascal gentes egipti« anstandslos als
Mutter des göttlichen Kindes verkündet wird! Dagegen ist die Verlegung des ganzen Vorganges aus der Gegenwart in die Zukunft (»ascendit —
ascendet«), die eigentlich allein der Beschreibung einer alljährlich wiederkehrenden Himmelserscheinung prophetischen Charakter zu verleihen vermag,
keineswegs die Regel.
15 —