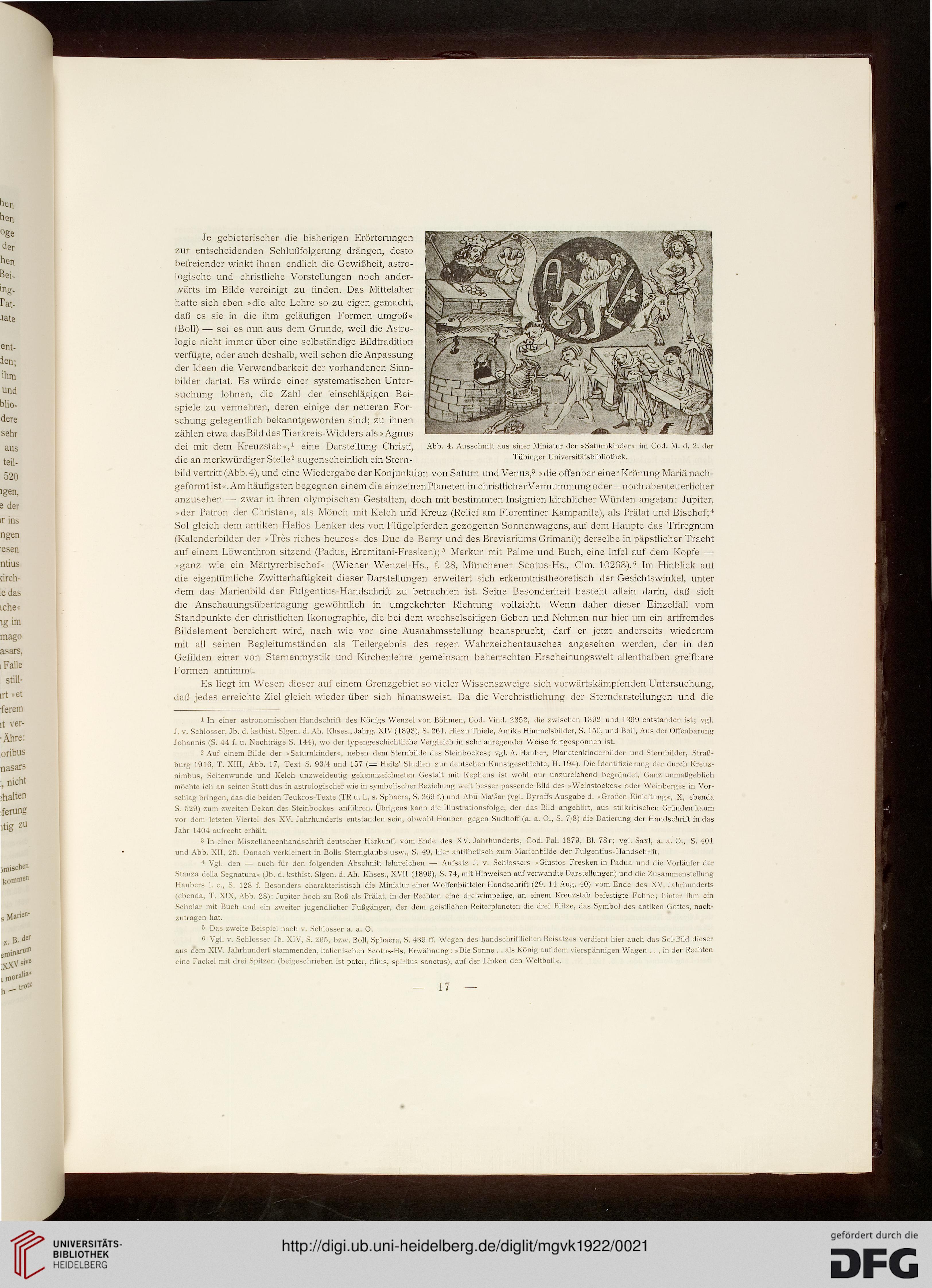4. Ausschnitt aus einer Miniatur der »Saturnkinder« im Cod. M. d. 2. der
Tübinger Universitätsbibliothek.
Je gebieterischer die bisherigen Erörterungen
zur entscheidenden Schlußfolgerung drängen, desto
befreiender winkt ihnen endlich die Gewißheit, astro-
logische und christliche Vorstellungen noch ander-
wärts im Bilde vereinigt zu finden. Das Mittelalter
hatte sich eben »die alte Lehre so zu eigen gemacht,
daß es sie in die ihm geläufigen Formen umgoß«
(Boll) — sei es nun aus dem Grunde, weil die Astro-
logie nicht immer über eine selbständige Bildtradition
verfügte, oder auch deshalb, weil schon die Anpassung
der Ideen die Verwendbarkeit der vorhandenen Sinn-
bilder dartat. Es würde einer systematischen Unter-
suchung lohnen, die Zahl der einschlägigen Bei-
spiele zu vermehren, deren einige der neueren For-
schung gelegentlich bekanntgeworden sind; zu ihnen
zählen etwa das Bild des Tierkreis-Widders als »Agnus
dei mit dem Kreuzstab«,1 eine Darstellung Christi,
die an merkwürdiger Stelle'2 augenscheinlich ein Stern-
bild vertritt (Abb.4), und eine Wiedergabe der Konjunktion von Saturn und Venus,3 »die offenbar einer Krönung Maria nach-
geformt ist«. Am häufigsten begegnen einem die einzelnenPlaneten in christlicher Vermummungoder —noch abenteuerlicher
anzusehen — zwar in ihren olympischen Gestalten, doch mit bestimmten Insignien kirchlicher Würden angetan: Jupiter,
»der Patron der Christen«, als Mönch mit Kelch und Kreuz (Relief am Florentiner Kampanile), als Prälat und Bischof;4
Sol gleich dem antiken Helios Lenker des von Flügelpferden gezogenen Sonnenwagens, auf dem Haupte das Triregnum
(Kalenderbilder der »Tres riches heures« des Duc de Berry und des Breviariums Grimani); derselbe in päpstlicher Tracht
auf einem Löwenthron sitzend (Padua, Eremitani-Fresken);5 Merkur mit Palme und Buch, eine Infel auf dem Kopfe —
»ganz wie ein Märtyrerbischof« (Wiener Wenzel-Hs., f. 28, Münchener Scotus-Hs., Clm. 10268).° Im Hinblick aut
die eigentümliche Zwitterhaftigkeit dieser Darstellungen erweitert sich erkenntnistheoretisch der Gesichtswinkel, unter
dem das Marienbild der Fulgentius-Handschrift zu betrachten ist. Seine Besonderheit besteht allein darin, daß sich
die Anschauungsübertragung gewöhnlich in umgekehrter Richtung vollzieht. Wenn daher dieser Einzelfall vom
Standpunkte der christlichen Ikonographie, die bei dem wechselseitigen Geben und Nehmen nur hier um ein artfremdes
Bildelement bereichert wird, nach wie vor eine Ausnahmsstellung beansprucht, darf er jetzt anderseits wiederum
mit all seinen Begleitumständen als Teilergebnis des regen Wahrzeichentausches angesehen werden, der in den
Gefilden einer von Sternenmystik und Kirchenlehre gemeinsam beherrschten Erscheinungswelt allenthalben greifbare
Formen annimmt.
Es liegt im Wesen dieser auf einem Grenzgebiet so vieler Wissenszweige sich vorwärtskämpfenden Untersuchung,
daß jedes erreichte Ziel gleich wieder über sich hinausweist. Da die Verchristlichung der Sterndarstellungen und die
ß. der
l In einer astronomischen Handschrift des Königs Wenzel von Böhmen, Cod. Vind. 2352, die zwischen 1392 und 1399 entstanden ist; vgl.
J. v. Schlosser, Jb. d. ksthist. Slgen. d. Ah. Khses., Jahrg. XIV (1893), S. 261. Hiezu Thiele, Antike Himmelsbilder, S. 150. und Boll, Aus der Offenbarung
Johannis (S. 44 f. u. Nachträge S. 144), wo der typengescbichtliche Vergleich in sehr anregender Weise fortgesponnen ist.
'-Auf einem Bilde der »Saturnkinder«, neben dem Sternbilde des Steinbockes; vgl. A. Hauber, Planetenkinderbilder und Sternbilder, Straß-
burg 1916, T. XIII, Abb. 17, Text S. 93/4 und 157 (= Heitz' Studien zur deutschen Kunstgeschichte, H. 194). Die Identifizierung der durch Kreuz-
nimbus, Seitemvunde und Kelch unzweideutig gekennzeichneten Gestalt mit Kepheus ist wohl nur unzureichend begründet. Ganz unmaßgeblich
mochte ich an seiner Statt das in astrologischer wie in symbolischer Beziehung weit besser passende Bild des »Weinstockes« oder Weinberges in Vor-
schlag bringen, das die beiden Teukros-Texte (TR u. L, s. Sphaera, S. 269 f.) und Abu Ma'sar (vgl. Dyroffs Ausgabe d. »Großen Einleitung«, X, ebenda
S. 529) zum zweiten Dekan des Steinbockes anführen. Übrigens kann die Illustrationsfolge, der das Bild angehört, aus stilkritischen Gründen kaum
vor dem letzten Viertel des XV. Jahrhunderts entstanden sein, obwohl Hauber gegen Sudhoff (a. a. O., S. 7,8) die Datierung der Handschrift in das
Jahr 1404 aufrecht erhält.
3 In einer Miszellaneenhandschrift deutscher Herkunft vom Ende des XV. Jahrhunderts, Cod. Pal. 1S79, Bl. 78r; vgl. Saxl, a. a. O., S. 401
und Abb. XII. 25. Danach verkleinert in BoIIs Sternglaube usw., S. 49, hier antithetisch zum Manenbilde der Fulgentius-Handschrift.
i Vgl, den — auch für den folgenden Abschnitt lehrreichen — Aufsatz J. v. Schlossers »Giustos Fresken in Padua und die Vorläufer der
Stanza della Segnatura« (Jb. d. ksthist. Slgen. d. Ah. Khses., XVII (1896), S. 74, mit Hinweisen auf verwandte Darstellungen) und die Zusammenstellung
Haubers 1. c, S. 128 f. Besonders charakteristisch die Miniatur einer Wolfenbütteler Handschrift (29. 14 Aug. 40) vom Ende des XV. Jahrhunderts
(ebenda, T. XIX, Abb. 28): Jupiter hoch zu Roß als Prälat, in der Rechten eine dreiwimpelige, an einem Kreuzstab befestigte Fahne; hinter ihm ein
Scholar mit Buch und ein zweiter jugendlicher Fußgänger, der dem geistlichen Reiterplaneten die drei Blitze, das Symbol des antiken Gottes, nach-
zutragen hat.
5 Das zweite Beispiel nach v. Schlosser a. a. O.
15 Vgl. v. Schlosser Jb. XIV, S. 265, bzw. Boll, Sphaera, S. 439 ff. Wegen des handschriftlichen Beisatzes verdient hier auch das Sol-Bild dieser
aus dem XIV. Jahrhundert stammenden, italienischen Scotus-Hs. Erwähnung; »Die Sonne . . als König auf dem vierspännigen Wagen . , , in der Rechten
eine Fackel mit drei Spitzen (beigeschrieben ist pater, filius, Spiritus sanetus), auf der Linken den Weltball«.
. trotz
— 17
Tübinger Universitätsbibliothek.
Je gebieterischer die bisherigen Erörterungen
zur entscheidenden Schlußfolgerung drängen, desto
befreiender winkt ihnen endlich die Gewißheit, astro-
logische und christliche Vorstellungen noch ander-
wärts im Bilde vereinigt zu finden. Das Mittelalter
hatte sich eben »die alte Lehre so zu eigen gemacht,
daß es sie in die ihm geläufigen Formen umgoß«
(Boll) — sei es nun aus dem Grunde, weil die Astro-
logie nicht immer über eine selbständige Bildtradition
verfügte, oder auch deshalb, weil schon die Anpassung
der Ideen die Verwendbarkeit der vorhandenen Sinn-
bilder dartat. Es würde einer systematischen Unter-
suchung lohnen, die Zahl der einschlägigen Bei-
spiele zu vermehren, deren einige der neueren For-
schung gelegentlich bekanntgeworden sind; zu ihnen
zählen etwa das Bild des Tierkreis-Widders als »Agnus
dei mit dem Kreuzstab«,1 eine Darstellung Christi,
die an merkwürdiger Stelle'2 augenscheinlich ein Stern-
bild vertritt (Abb.4), und eine Wiedergabe der Konjunktion von Saturn und Venus,3 »die offenbar einer Krönung Maria nach-
geformt ist«. Am häufigsten begegnen einem die einzelnenPlaneten in christlicher Vermummungoder —noch abenteuerlicher
anzusehen — zwar in ihren olympischen Gestalten, doch mit bestimmten Insignien kirchlicher Würden angetan: Jupiter,
»der Patron der Christen«, als Mönch mit Kelch und Kreuz (Relief am Florentiner Kampanile), als Prälat und Bischof;4
Sol gleich dem antiken Helios Lenker des von Flügelpferden gezogenen Sonnenwagens, auf dem Haupte das Triregnum
(Kalenderbilder der »Tres riches heures« des Duc de Berry und des Breviariums Grimani); derselbe in päpstlicher Tracht
auf einem Löwenthron sitzend (Padua, Eremitani-Fresken);5 Merkur mit Palme und Buch, eine Infel auf dem Kopfe —
»ganz wie ein Märtyrerbischof« (Wiener Wenzel-Hs., f. 28, Münchener Scotus-Hs., Clm. 10268).° Im Hinblick aut
die eigentümliche Zwitterhaftigkeit dieser Darstellungen erweitert sich erkenntnistheoretisch der Gesichtswinkel, unter
dem das Marienbild der Fulgentius-Handschrift zu betrachten ist. Seine Besonderheit besteht allein darin, daß sich
die Anschauungsübertragung gewöhnlich in umgekehrter Richtung vollzieht. Wenn daher dieser Einzelfall vom
Standpunkte der christlichen Ikonographie, die bei dem wechselseitigen Geben und Nehmen nur hier um ein artfremdes
Bildelement bereichert wird, nach wie vor eine Ausnahmsstellung beansprucht, darf er jetzt anderseits wiederum
mit all seinen Begleitumständen als Teilergebnis des regen Wahrzeichentausches angesehen werden, der in den
Gefilden einer von Sternenmystik und Kirchenlehre gemeinsam beherrschten Erscheinungswelt allenthalben greifbare
Formen annimmt.
Es liegt im Wesen dieser auf einem Grenzgebiet so vieler Wissenszweige sich vorwärtskämpfenden Untersuchung,
daß jedes erreichte Ziel gleich wieder über sich hinausweist. Da die Verchristlichung der Sterndarstellungen und die
ß. der
l In einer astronomischen Handschrift des Königs Wenzel von Böhmen, Cod. Vind. 2352, die zwischen 1392 und 1399 entstanden ist; vgl.
J. v. Schlosser, Jb. d. ksthist. Slgen. d. Ah. Khses., Jahrg. XIV (1893), S. 261. Hiezu Thiele, Antike Himmelsbilder, S. 150. und Boll, Aus der Offenbarung
Johannis (S. 44 f. u. Nachträge S. 144), wo der typengescbichtliche Vergleich in sehr anregender Weise fortgesponnen ist.
'-Auf einem Bilde der »Saturnkinder«, neben dem Sternbilde des Steinbockes; vgl. A. Hauber, Planetenkinderbilder und Sternbilder, Straß-
burg 1916, T. XIII, Abb. 17, Text S. 93/4 und 157 (= Heitz' Studien zur deutschen Kunstgeschichte, H. 194). Die Identifizierung der durch Kreuz-
nimbus, Seitemvunde und Kelch unzweideutig gekennzeichneten Gestalt mit Kepheus ist wohl nur unzureichend begründet. Ganz unmaßgeblich
mochte ich an seiner Statt das in astrologischer wie in symbolischer Beziehung weit besser passende Bild des »Weinstockes« oder Weinberges in Vor-
schlag bringen, das die beiden Teukros-Texte (TR u. L, s. Sphaera, S. 269 f.) und Abu Ma'sar (vgl. Dyroffs Ausgabe d. »Großen Einleitung«, X, ebenda
S. 529) zum zweiten Dekan des Steinbockes anführen. Übrigens kann die Illustrationsfolge, der das Bild angehört, aus stilkritischen Gründen kaum
vor dem letzten Viertel des XV. Jahrhunderts entstanden sein, obwohl Hauber gegen Sudhoff (a. a. O., S. 7,8) die Datierung der Handschrift in das
Jahr 1404 aufrecht erhält.
3 In einer Miszellaneenhandschrift deutscher Herkunft vom Ende des XV. Jahrhunderts, Cod. Pal. 1S79, Bl. 78r; vgl. Saxl, a. a. O., S. 401
und Abb. XII. 25. Danach verkleinert in BoIIs Sternglaube usw., S. 49, hier antithetisch zum Manenbilde der Fulgentius-Handschrift.
i Vgl, den — auch für den folgenden Abschnitt lehrreichen — Aufsatz J. v. Schlossers »Giustos Fresken in Padua und die Vorläufer der
Stanza della Segnatura« (Jb. d. ksthist. Slgen. d. Ah. Khses., XVII (1896), S. 74, mit Hinweisen auf verwandte Darstellungen) und die Zusammenstellung
Haubers 1. c, S. 128 f. Besonders charakteristisch die Miniatur einer Wolfenbütteler Handschrift (29. 14 Aug. 40) vom Ende des XV. Jahrhunderts
(ebenda, T. XIX, Abb. 28): Jupiter hoch zu Roß als Prälat, in der Rechten eine dreiwimpelige, an einem Kreuzstab befestigte Fahne; hinter ihm ein
Scholar mit Buch und ein zweiter jugendlicher Fußgänger, der dem geistlichen Reiterplaneten die drei Blitze, das Symbol des antiken Gottes, nach-
zutragen hat.
5 Das zweite Beispiel nach v. Schlosser a. a. O.
15 Vgl. v. Schlosser Jb. XIV, S. 265, bzw. Boll, Sphaera, S. 439 ff. Wegen des handschriftlichen Beisatzes verdient hier auch das Sol-Bild dieser
aus dem XIV. Jahrhundert stammenden, italienischen Scotus-Hs. Erwähnung; »Die Sonne . . als König auf dem vierspännigen Wagen . , , in der Rechten
eine Fackel mit drei Spitzen (beigeschrieben ist pater, filius, Spiritus sanetus), auf der Linken den Weltball«.
. trotz
— 17