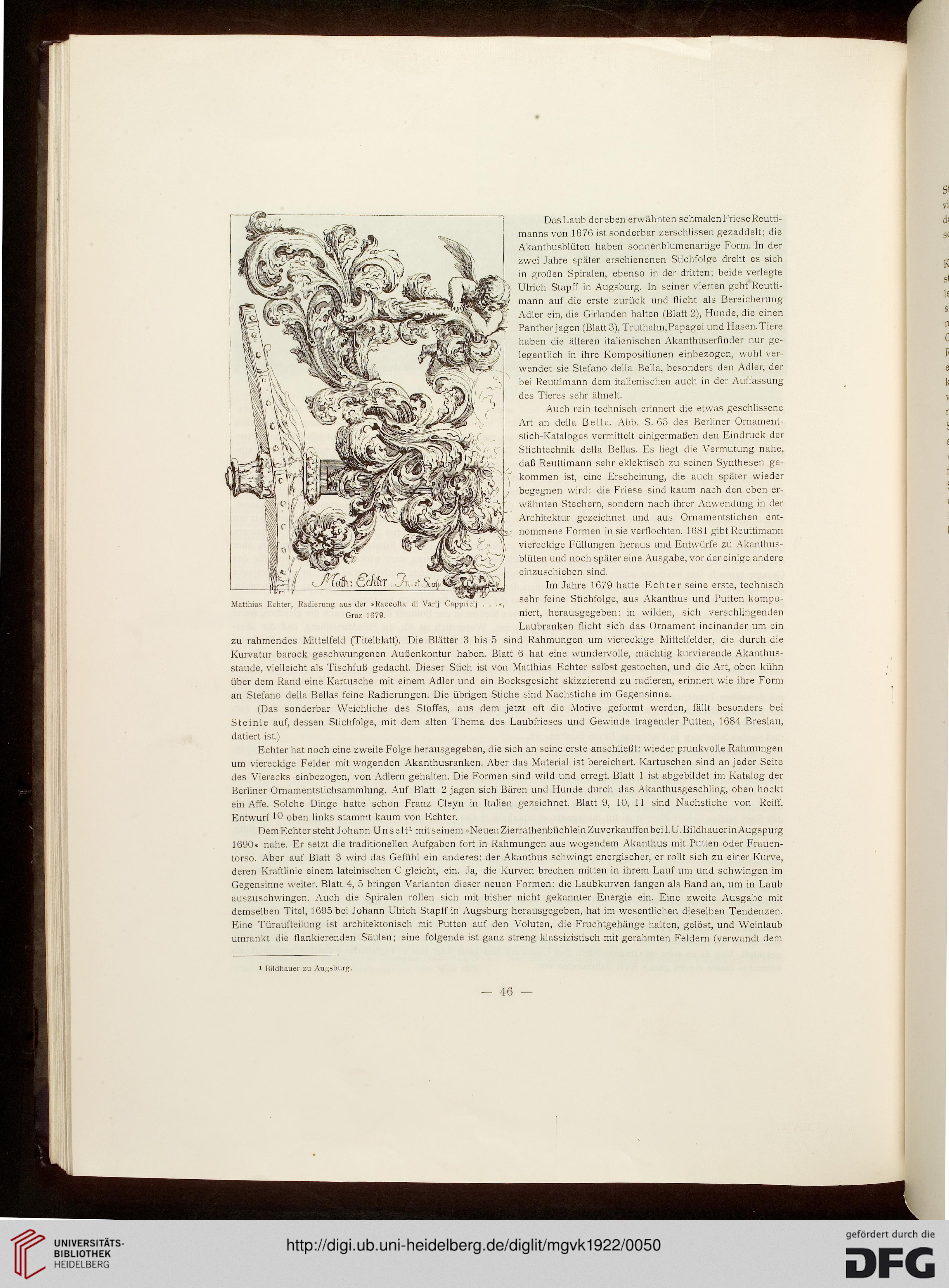Das Laub dereben erwähnten schmalenFrieseReutti-
manns von 1676 ist sonderbar zerschlissen gezaddelt; die
Akanthusblüten haben sonnenblumenartige Form. In der
zwei Jahre später erschienenen Stichfolge dreht es sich
in großen Spiralen, ebenso in der dritten: beide verlegte
Ulrich Stapff in Augsburg. In seiner vierten geht Reutti-
mann auf die erste zurück und flicht als Bereicherung
Adler ein, die Girlanden halten (Blatt 2), Hunde, die einen
Panther jagen (Blatt 3), Truthahn, Papagei und Hasen. Tiere
haben die älteren italienischen Akanthuserfinder nur ge-
legentlich in ihre Kompositionen einbezogen, wohl ver-
wendet sie Stefano della Bella, besonders den Adler, der
bei Reuttimann dem italienischen auch in der Auffassung
des Tieres sehr ähnelt.
Auch rein technisch erinnert die etwas geschlissene
Art an della Bella. Abb. S. 65 des Berliner Ornament-
stich-Kataloges vermittelt einigermaßen den Eindruck der
Stichtechnik della Bellas. Es liegt die Vermutung nahe,
daß Reuttimann sehr eklektisch zu seinen Synthesen ge-
kommen ist, eine Erscheinung, die auch später wieder
begegnen wird: die Friese sind kaum nach den eben er-
wähnten Stechern, sondern nach ihrer Anwendung in der
Architektur gezeichnet und aus Ornamentstichen ent-
nommene Formen in sie verflochten. 1681 gibt Reuttimann
viereckige Füllungen heraus und Entwürfe zu Akanthus-
blüten und noch später eine Ausgabe, vor der einige andere
einzuschieben sind.
Im Jahre 1679 hatte Echter seine erste, technisch
sehr feine Stichfolge, aus Akanthus und Putten kompo-
niert, herausgegeben: in wilden, sich verschlingenden
Laubranken flicht sich das Ornament ineinander um ein
zu rahmendes Mittelfeld (Titelblatt). Die Blätter 3 bis 5 sind Rahmungen um viereckige Mittelfelder, die durch die
Kurvatur barock geschwungenen Außenkontur haben. Blatt 6 hat eine wundervolle, mächtig kurvierende Akanthus-
staude, vielleicht als Tischfuß gedacht. Dieser Stich ist von Matthias Echter selbst gestochen, und die Art, oben kühn
über dem Rand eine Kartusche mit einem Adler und ein Bocksgesicht skizzierend zu radieren, erinnert wie ihre Form
an Stefano della Bellas feine Radierungen. Die übrigen Stiche sind Nachstiche im Gegensinne.
(Das sonderbar Weichliche des Stoffes, aus dem jetzt oft die Motive geformt werden, fällt besonders bei
Steinle auf, dessen Stichfolge, mit dem alten Thema des Laubfrieses und Gewinde tragender Putten, 1684 Breslau,
datiert ist.)
Echter hat noch eine zweite Folge herausgegeben, die sich an seine erste anschließt: wieder prunkvolle Rahmungen
um viereckige Felder mit wogenden Akanthusranken. Aber das Material ist bereichert. Kartuschen sind an jeder Seite
des Vierecks einbezogen, von Adlern gehalten. Die Formen sind wild und erregt. Blatt 1 ist abgebildet im Katalog der
Berliner Ornamentstichsammlung. Auf Blatt 2 jagen sich Bären und Hunde durch das Akanthusgeschling, oben hockt
ein Affe. Solche Dinge hatte schon Franz Cleyn in Italien gezeichnet. Blatt 9, 10, 11 sind Nachstiche von Reiff.
Entwurf 10 oben links stammt kaum von Echter.
DemEchter steht Johann Unselt1 mitseinem»NeuenZierrathenbüchleinZuverkauffenbeil.U.BildhauerinAugspurg
1690« nahe. Er setzt die traditionellen Aufgaben fort in Rahmungen aus wogendem Akanthus mit Putten oder Frauen-
torso. Aber auf Blatt 3 wird das Gefühl ein anderes: der Akanthus schwingt energischer, er rollt sich zu einer Kurve,
deren Kraftlinie einem lateinischen C gleicht, ein. Ja, die Kurven brechen mitten in ihrem Lauf um und schwingen im
Gegensinne weiter. Blatt 4, 5 bringen Varianten dieser neuen Formen: die Laubkurven fangen als Band an, um in Laub
auszuschwingen. Auch die Spiralen rollen sich mit bisher nicht gekannter Energie ein. Eine zweite Ausgabe mit
demselben Titel, 1695 bei Johann Ulrich Stapff in Augsburg herausgegeben, hat im wesentlichen dieselben Tendenzen.
Eine Türaufteilung ist architektonisch mit Putten auf den Voluten, die Fruchtgehänge halten, gelöst, und Weinlaub
umrankt die flankierenden Säulen; eine folgende ist ganz streng klassizistisch mit gerahmten Feldern (verwandt dem
Matthias Echter, Radierung aus der »Raccolta di Varij Cappricij
Graz 1679.
1 Bildhauer zu Augsburg.
46 —
Hü
manns von 1676 ist sonderbar zerschlissen gezaddelt; die
Akanthusblüten haben sonnenblumenartige Form. In der
zwei Jahre später erschienenen Stichfolge dreht es sich
in großen Spiralen, ebenso in der dritten: beide verlegte
Ulrich Stapff in Augsburg. In seiner vierten geht Reutti-
mann auf die erste zurück und flicht als Bereicherung
Adler ein, die Girlanden halten (Blatt 2), Hunde, die einen
Panther jagen (Blatt 3), Truthahn, Papagei und Hasen. Tiere
haben die älteren italienischen Akanthuserfinder nur ge-
legentlich in ihre Kompositionen einbezogen, wohl ver-
wendet sie Stefano della Bella, besonders den Adler, der
bei Reuttimann dem italienischen auch in der Auffassung
des Tieres sehr ähnelt.
Auch rein technisch erinnert die etwas geschlissene
Art an della Bella. Abb. S. 65 des Berliner Ornament-
stich-Kataloges vermittelt einigermaßen den Eindruck der
Stichtechnik della Bellas. Es liegt die Vermutung nahe,
daß Reuttimann sehr eklektisch zu seinen Synthesen ge-
kommen ist, eine Erscheinung, die auch später wieder
begegnen wird: die Friese sind kaum nach den eben er-
wähnten Stechern, sondern nach ihrer Anwendung in der
Architektur gezeichnet und aus Ornamentstichen ent-
nommene Formen in sie verflochten. 1681 gibt Reuttimann
viereckige Füllungen heraus und Entwürfe zu Akanthus-
blüten und noch später eine Ausgabe, vor der einige andere
einzuschieben sind.
Im Jahre 1679 hatte Echter seine erste, technisch
sehr feine Stichfolge, aus Akanthus und Putten kompo-
niert, herausgegeben: in wilden, sich verschlingenden
Laubranken flicht sich das Ornament ineinander um ein
zu rahmendes Mittelfeld (Titelblatt). Die Blätter 3 bis 5 sind Rahmungen um viereckige Mittelfelder, die durch die
Kurvatur barock geschwungenen Außenkontur haben. Blatt 6 hat eine wundervolle, mächtig kurvierende Akanthus-
staude, vielleicht als Tischfuß gedacht. Dieser Stich ist von Matthias Echter selbst gestochen, und die Art, oben kühn
über dem Rand eine Kartusche mit einem Adler und ein Bocksgesicht skizzierend zu radieren, erinnert wie ihre Form
an Stefano della Bellas feine Radierungen. Die übrigen Stiche sind Nachstiche im Gegensinne.
(Das sonderbar Weichliche des Stoffes, aus dem jetzt oft die Motive geformt werden, fällt besonders bei
Steinle auf, dessen Stichfolge, mit dem alten Thema des Laubfrieses und Gewinde tragender Putten, 1684 Breslau,
datiert ist.)
Echter hat noch eine zweite Folge herausgegeben, die sich an seine erste anschließt: wieder prunkvolle Rahmungen
um viereckige Felder mit wogenden Akanthusranken. Aber das Material ist bereichert. Kartuschen sind an jeder Seite
des Vierecks einbezogen, von Adlern gehalten. Die Formen sind wild und erregt. Blatt 1 ist abgebildet im Katalog der
Berliner Ornamentstichsammlung. Auf Blatt 2 jagen sich Bären und Hunde durch das Akanthusgeschling, oben hockt
ein Affe. Solche Dinge hatte schon Franz Cleyn in Italien gezeichnet. Blatt 9, 10, 11 sind Nachstiche von Reiff.
Entwurf 10 oben links stammt kaum von Echter.
DemEchter steht Johann Unselt1 mitseinem»NeuenZierrathenbüchleinZuverkauffenbeil.U.BildhauerinAugspurg
1690« nahe. Er setzt die traditionellen Aufgaben fort in Rahmungen aus wogendem Akanthus mit Putten oder Frauen-
torso. Aber auf Blatt 3 wird das Gefühl ein anderes: der Akanthus schwingt energischer, er rollt sich zu einer Kurve,
deren Kraftlinie einem lateinischen C gleicht, ein. Ja, die Kurven brechen mitten in ihrem Lauf um und schwingen im
Gegensinne weiter. Blatt 4, 5 bringen Varianten dieser neuen Formen: die Laubkurven fangen als Band an, um in Laub
auszuschwingen. Auch die Spiralen rollen sich mit bisher nicht gekannter Energie ein. Eine zweite Ausgabe mit
demselben Titel, 1695 bei Johann Ulrich Stapff in Augsburg herausgegeben, hat im wesentlichen dieselben Tendenzen.
Eine Türaufteilung ist architektonisch mit Putten auf den Voluten, die Fruchtgehänge halten, gelöst, und Weinlaub
umrankt die flankierenden Säulen; eine folgende ist ganz streng klassizistisch mit gerahmten Feldern (verwandt dem
Matthias Echter, Radierung aus der »Raccolta di Varij Cappricij
Graz 1679.
1 Bildhauer zu Augsburg.
46 —
Hü