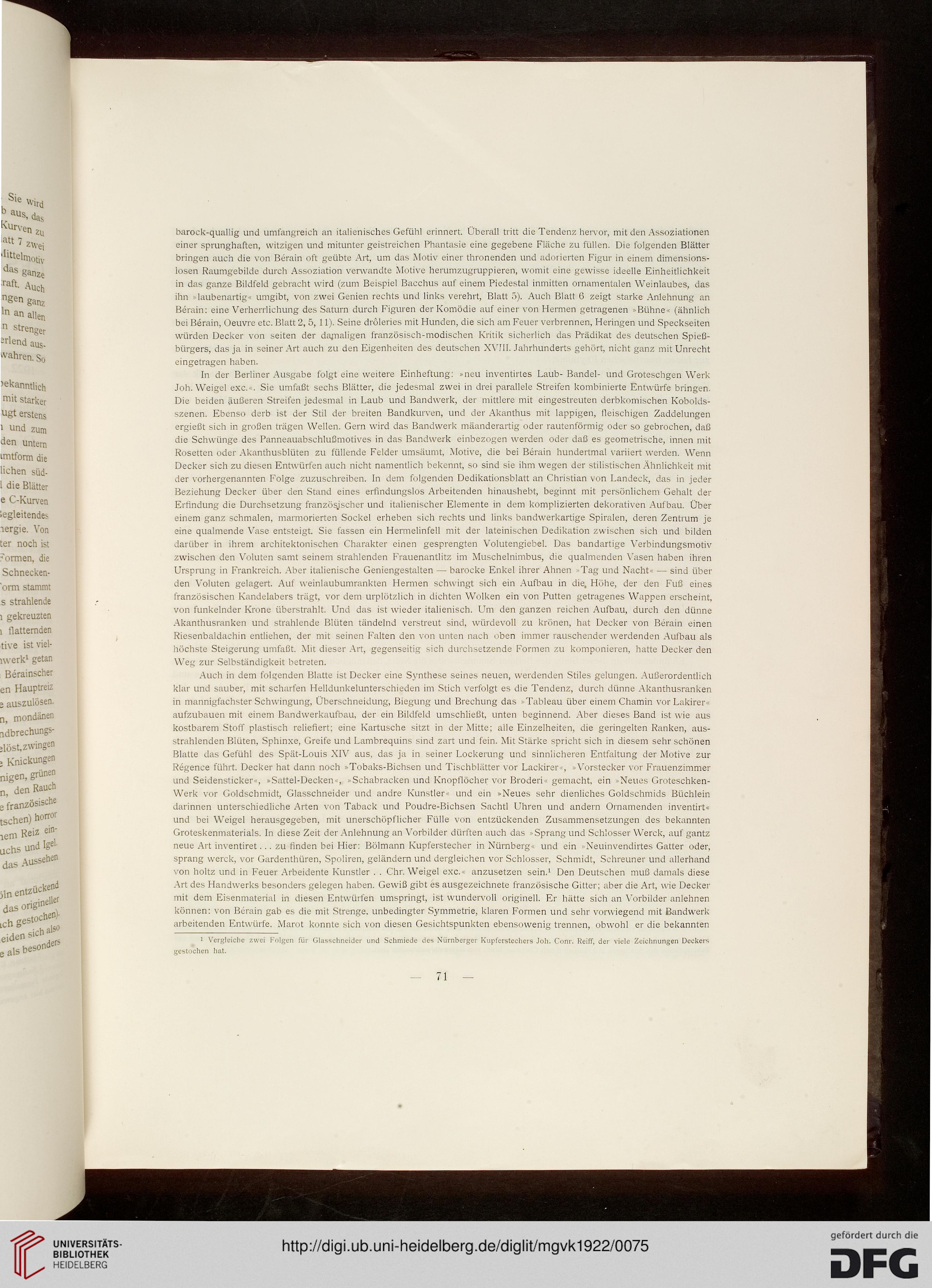barock-quallig und umfangreich an italienisches Gefühl erinnert. Überall tritt die Tendenz hervor, mit den Assoziationen
einer sprunghaften, witzigen und mitunter geistreichen Phantasie eine gegebene Fläche zu füllen. Die folgenden Blätter
bringen auch die von Berain oft geübte Art, um das Motiv einer thronenden und adorierten Figur in einem dimensions-
losen Raumgebilde durch Assoziation verwandte Motive herumzugruppieren, womit eine gewisse ideelle Einheitlichkeit
in das ganze Bildfeld gebracht wird (zum Beispiel Bacchus auf einem Piedestal inmitten ornamentalen Weinlaubes, das
ihn »laubenartig« umgibt, von zwei Genien rechts und links verehrt, Blatt 5). Auch Blatt 6 zeigt starke Anlehnung an
Berain: eine Verherrlichung des Saturn durch Figuren der Komödie auf einer von Hermen getragenen »Bühne« (ähnlich
bei Berain, Oeuvre etc. Blatt 2, 5, 11). Seine dröleries mit Hunden, die sich am Feuer verbrennen, Heringen und Speckseiten
würden Decker von Seiten der damaligen französisch-modischen Kritik sicherlich das Prädikat des deutschen Spieß-
bürgers, das ja in seiner Art auch zu den Eigenheiten des deutschen XVIII. Jahrhunderts gehört, nicht ganz mit Unrecht
eingetragen haben.
In der Berliner Ausgabe folgt eine weitere Einheftung: »neu inventirtes Laub- Bändel- und Groteschgen Werk
Joh. Weigel exe«. Sie umfaßt sechs Blätter, die jedesmal zwei in drei parallele Streifen kombinierte Entwürfe bringen.
Die beiden äußeren Streifen jedesmal in Laub und Bandwerk, der mittlere mit eingestreuten derbkomischen Kobolds-
szenen. Ebenso derb ist der Stil der breiten Bandkurven, und der Akanthus mit lappigen, fleischigen Zaddelungen
ergießt sich in großen trägen Wellen. Gern wird das Bandwerk mäanderartig oder rautenförmig oder so gebrochen, daß
die Schwünge des Panneauabschlußmotives in das Bandwerk einbezogen werden oder daß es geometrische, innen mit
Rosetten oder Akanthusblüten zu füllende Felder umsäumt, Motive, die bei Berain hundertmal variiert werden. Wenn
Decker sich zu diesen Entwürfen auch nicht namentlich bekennt, so sind sie ihm wegen der stilistischen Ähnlichkeit mit
der vorhergenannten Folge zuzuschreiben. In dem folgenden Dedikationsblatt an Christian von Landeck, das in jeder
Beziehung Decker über den Stand eines erfindungslos Arbeitenden hinaushebt, beginnt mit persönlichem Gehalt der
Erfindung die Durchsetzung französischer und italienischer Elemente in dem komplizierten dekorativen Aufbau. Über
einem ganz schmalen, marmorierten Sockel erheben sich rechts und links bandwerkartige Spiralen, deren Zentrum je
eine qualmende Vase entsteigt. Sie fassen ein Hermelinfell mit der lateinischen Dedikation zwischen sich und bilden
darüber in ihrem architektonischen Charakter einen gesprengten Volutengiebel. Das bandartige Verbindungsmotiv
zwischen den Voluten samt seinem strahlenden Frauenantlitz im Muschelnimbus, die qualmenden Vasen haben ihren
Ursprung in Frankreich. Aber italienische Geniengestalten — barocke Enkel ihrer Ahnen 'Tag und Nacht« — sind über
den Voluten gelagert. Auf weinlaubumrankten Hermen schwingt sich ein Aufbau in die, Höhe, der den Fuß eines
französischen Kandelabers trägt, vor dem urplötzlich in dichten Wolken ein von Putten getragenes Wappen erscheint,
von funkelnder Krone überstrahlt. Und das ist wieder italienisch. Um den ganzen reichen Aufbau, durch den dünne
Akanthusranken und strahlende Blüten tändelnd verstreut sind, würdevoll zu krönen, hat Decker von Berain einen
Riesenbaldachin entliehen, der mit seinen Falten den von unten nach oben immer rauschender werdenden Aufbau als
höchste Steigerung umfaßt. Mit dieser Art, gegenseitig sich durchsetzende Formen zu komponieren, hatte Decker den
Weg zur Selbständigkeit betreten.
Auch in dem folgenden Blatte ist Decker eine Synthese seines neuen, werdenden Stiles gelungen. Außerordentlich
klar und sauber, mit scharfen Helldunkelunterschieden im Stich verfolgt es die Tendenz, durch dünne Akanthusranken
in mannigfachster Schwingung, Überschneidung, Biegung und Brechung das »Tableau über einem Chamin vor Lakirer«
aufzubauen mit einem Bandwerkaufbau, der ein Bildfeld umschließt, unten beginnend. Aber dieses Band ist wie aus
kostbarem Stoff plastisch reliefiert; eine Kartusche sitzt in der Mitte; alle Einzelheiten, die geringelten Ranken, aus-
strahlenden Blüten, Sphinxe, Greife und Lambrequins sind zart und fein. Mit Stärke spricht sich in diesem sehr schönen
Blatte das Gefühl des Spät-Louis XIV aus, das ja in seiner Lockerung und sinnlicheren Entfaltung der Motive zur
Regence führt. Decker hat dann noch »Tobaks-Bichsen und Tischblätter vor Lackirer <, »Vorstecker vor Frauenzimmer
und Seidensticker«, »Sattel-Decken«, »Schabracken und Knopflöcher vor Broderi« gemacht, ein »Neues Groteschken-
Werk vor Goldschmidt, Glasschneider und andre Kunstler« und ein »Neues sehr dienliches Goldschmids Büchlein
darinnen unterschiedliche Arten von Taback und Poudre-Bichsen Sachtl Uhren und andern Ornamenden inventirt«
und bei Weigel herausgegeben, mit unerschöpflicher Fülle von entzückenden Zusammensetzungen des bekannten
Groteskenmaterials. In diese Zeit der Anlehnung an Vorbilder dürften auch das »Sprang und Schlosser Werck, auf gantz
neue Art inventiret... zu finden bei Hier: Bölmann Kupferstecher in Nürnberg« und ein ■ Neuinvendirtes Gatter oder,
sprang werck, vor Gardenthüren, Spoliren, geländern und dergleichen vor Schlosser, Schmidt, Schreuner und allerhand
von holtz und in Feuer Arbeidente Kunstler . . Chr. Weigel exe.« anzusetzen sein.1 Den Deutschen muß damals diese
Art des Handwerks besonders gelegen haben. Gewiß gibt es ausgezeichnete französische Gitter; aber die Art, wie Decker
mit dem Eisenmaterial in diesen Entwürfen umspringt, ist wundervoll originell. Er hätte sich an Vorbilder anlehnen
können: von Berain gab es die mit Strenge, unbedingter Symmetrie, klaren Formen und sehr vorwiegend mit Bandwerk
arbeitenden Entwürfe. Marot konnte sich von diesen Gesichtspunkten ebensowenig trennen, obwohl er die bekannten
1 Vergleiche zwei Kolgen für Glasschneider und Schmiede des Nürnberger Kupferstechers Joh. Conr. Reiff, der viele Zeichnungen Deckers
gestochen hat.
71
einer sprunghaften, witzigen und mitunter geistreichen Phantasie eine gegebene Fläche zu füllen. Die folgenden Blätter
bringen auch die von Berain oft geübte Art, um das Motiv einer thronenden und adorierten Figur in einem dimensions-
losen Raumgebilde durch Assoziation verwandte Motive herumzugruppieren, womit eine gewisse ideelle Einheitlichkeit
in das ganze Bildfeld gebracht wird (zum Beispiel Bacchus auf einem Piedestal inmitten ornamentalen Weinlaubes, das
ihn »laubenartig« umgibt, von zwei Genien rechts und links verehrt, Blatt 5). Auch Blatt 6 zeigt starke Anlehnung an
Berain: eine Verherrlichung des Saturn durch Figuren der Komödie auf einer von Hermen getragenen »Bühne« (ähnlich
bei Berain, Oeuvre etc. Blatt 2, 5, 11). Seine dröleries mit Hunden, die sich am Feuer verbrennen, Heringen und Speckseiten
würden Decker von Seiten der damaligen französisch-modischen Kritik sicherlich das Prädikat des deutschen Spieß-
bürgers, das ja in seiner Art auch zu den Eigenheiten des deutschen XVIII. Jahrhunderts gehört, nicht ganz mit Unrecht
eingetragen haben.
In der Berliner Ausgabe folgt eine weitere Einheftung: »neu inventirtes Laub- Bändel- und Groteschgen Werk
Joh. Weigel exe«. Sie umfaßt sechs Blätter, die jedesmal zwei in drei parallele Streifen kombinierte Entwürfe bringen.
Die beiden äußeren Streifen jedesmal in Laub und Bandwerk, der mittlere mit eingestreuten derbkomischen Kobolds-
szenen. Ebenso derb ist der Stil der breiten Bandkurven, und der Akanthus mit lappigen, fleischigen Zaddelungen
ergießt sich in großen trägen Wellen. Gern wird das Bandwerk mäanderartig oder rautenförmig oder so gebrochen, daß
die Schwünge des Panneauabschlußmotives in das Bandwerk einbezogen werden oder daß es geometrische, innen mit
Rosetten oder Akanthusblüten zu füllende Felder umsäumt, Motive, die bei Berain hundertmal variiert werden. Wenn
Decker sich zu diesen Entwürfen auch nicht namentlich bekennt, so sind sie ihm wegen der stilistischen Ähnlichkeit mit
der vorhergenannten Folge zuzuschreiben. In dem folgenden Dedikationsblatt an Christian von Landeck, das in jeder
Beziehung Decker über den Stand eines erfindungslos Arbeitenden hinaushebt, beginnt mit persönlichem Gehalt der
Erfindung die Durchsetzung französischer und italienischer Elemente in dem komplizierten dekorativen Aufbau. Über
einem ganz schmalen, marmorierten Sockel erheben sich rechts und links bandwerkartige Spiralen, deren Zentrum je
eine qualmende Vase entsteigt. Sie fassen ein Hermelinfell mit der lateinischen Dedikation zwischen sich und bilden
darüber in ihrem architektonischen Charakter einen gesprengten Volutengiebel. Das bandartige Verbindungsmotiv
zwischen den Voluten samt seinem strahlenden Frauenantlitz im Muschelnimbus, die qualmenden Vasen haben ihren
Ursprung in Frankreich. Aber italienische Geniengestalten — barocke Enkel ihrer Ahnen 'Tag und Nacht« — sind über
den Voluten gelagert. Auf weinlaubumrankten Hermen schwingt sich ein Aufbau in die, Höhe, der den Fuß eines
französischen Kandelabers trägt, vor dem urplötzlich in dichten Wolken ein von Putten getragenes Wappen erscheint,
von funkelnder Krone überstrahlt. Und das ist wieder italienisch. Um den ganzen reichen Aufbau, durch den dünne
Akanthusranken und strahlende Blüten tändelnd verstreut sind, würdevoll zu krönen, hat Decker von Berain einen
Riesenbaldachin entliehen, der mit seinen Falten den von unten nach oben immer rauschender werdenden Aufbau als
höchste Steigerung umfaßt. Mit dieser Art, gegenseitig sich durchsetzende Formen zu komponieren, hatte Decker den
Weg zur Selbständigkeit betreten.
Auch in dem folgenden Blatte ist Decker eine Synthese seines neuen, werdenden Stiles gelungen. Außerordentlich
klar und sauber, mit scharfen Helldunkelunterschieden im Stich verfolgt es die Tendenz, durch dünne Akanthusranken
in mannigfachster Schwingung, Überschneidung, Biegung und Brechung das »Tableau über einem Chamin vor Lakirer«
aufzubauen mit einem Bandwerkaufbau, der ein Bildfeld umschließt, unten beginnend. Aber dieses Band ist wie aus
kostbarem Stoff plastisch reliefiert; eine Kartusche sitzt in der Mitte; alle Einzelheiten, die geringelten Ranken, aus-
strahlenden Blüten, Sphinxe, Greife und Lambrequins sind zart und fein. Mit Stärke spricht sich in diesem sehr schönen
Blatte das Gefühl des Spät-Louis XIV aus, das ja in seiner Lockerung und sinnlicheren Entfaltung der Motive zur
Regence führt. Decker hat dann noch »Tobaks-Bichsen und Tischblätter vor Lackirer <, »Vorstecker vor Frauenzimmer
und Seidensticker«, »Sattel-Decken«, »Schabracken und Knopflöcher vor Broderi« gemacht, ein »Neues Groteschken-
Werk vor Goldschmidt, Glasschneider und andre Kunstler« und ein »Neues sehr dienliches Goldschmids Büchlein
darinnen unterschiedliche Arten von Taback und Poudre-Bichsen Sachtl Uhren und andern Ornamenden inventirt«
und bei Weigel herausgegeben, mit unerschöpflicher Fülle von entzückenden Zusammensetzungen des bekannten
Groteskenmaterials. In diese Zeit der Anlehnung an Vorbilder dürften auch das »Sprang und Schlosser Werck, auf gantz
neue Art inventiret... zu finden bei Hier: Bölmann Kupferstecher in Nürnberg« und ein ■ Neuinvendirtes Gatter oder,
sprang werck, vor Gardenthüren, Spoliren, geländern und dergleichen vor Schlosser, Schmidt, Schreuner und allerhand
von holtz und in Feuer Arbeidente Kunstler . . Chr. Weigel exe.« anzusetzen sein.1 Den Deutschen muß damals diese
Art des Handwerks besonders gelegen haben. Gewiß gibt es ausgezeichnete französische Gitter; aber die Art, wie Decker
mit dem Eisenmaterial in diesen Entwürfen umspringt, ist wundervoll originell. Er hätte sich an Vorbilder anlehnen
können: von Berain gab es die mit Strenge, unbedingter Symmetrie, klaren Formen und sehr vorwiegend mit Bandwerk
arbeitenden Entwürfe. Marot konnte sich von diesen Gesichtspunkten ebensowenig trennen, obwohl er die bekannten
1 Vergleiche zwei Kolgen für Glasschneider und Schmiede des Nürnberger Kupferstechers Joh. Conr. Reiff, der viele Zeichnungen Deckers
gestochen hat.
71