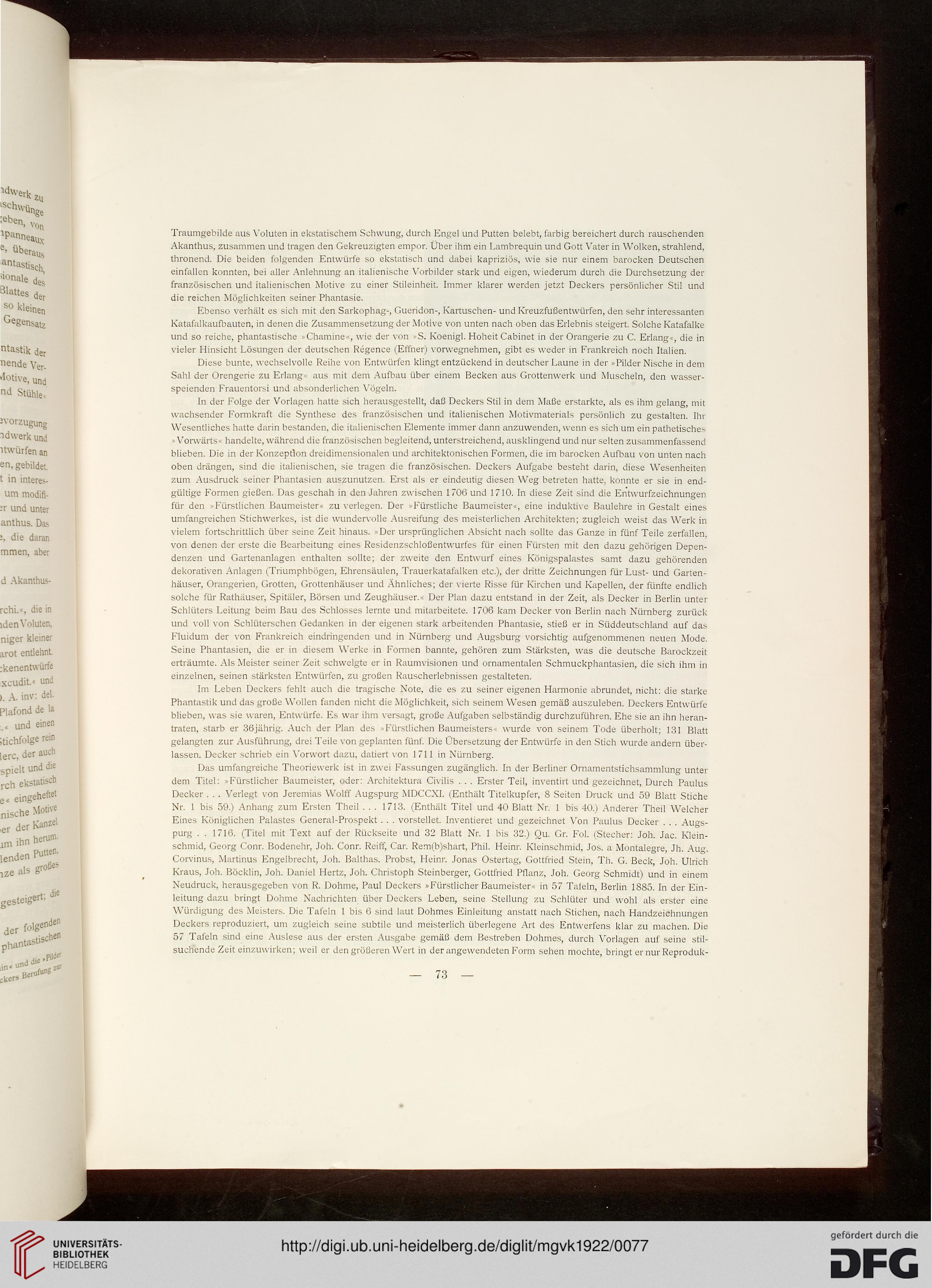Traumgebilde aus Voluten in ekstatischem Schwung, durch Engel und Putten belebt, farbig bereichert durch rauschenden
Akanthus, zusammen und tragen den Gekreuzigten empor. Über ihm ein Lambrequin und Gott Vater in Wolken, strahlend,
thronend. Die beiden folgenden Entwürfe so ekstatisch und dabei kapriziös, wie sie nur einem barocken Deutschen
einfallen konnten, bei aller Anlehnung an italienische Vorbilder stark und eigen, wiederum durch die Durchsetzung der
französischen und italienischen Motive zu einer Stileinheit. Immer klarer werden jetzt Deckers persönlicher Stil und
die reichen Möglichkeiten seiner Phantasie.
Ebenso verhält es sich mit den Sarkophag-, Gucridon-, Kartuschen- und Kreuzfußentwürfen, den sehr interessanten
Katafalkaufbauten, in denen die Zusammensetzung der Motive von unten nach oben das Erlebnis steigert. Solche Katafalke
und so reiche, phantastische »Chamine«, wie der von »S. Koenigl. Hoheit Cabinet in der Orangerie zu C. Erlang«, die in
vieler Hinsicht Lösungen der deutschen Regence (Effner) vorwegnehmen, gibt es weder in Frankreich noch Italien.
Diese bunte, wechselvolle Reihe von Entwürfen klingt entzückend in deutscher Laune in der »Pilder Nische in dem
Sahl der Orengerie zu Erlang« aus mit dem Aufbau über einem Becken aus Grottenwerk und Muscheln, den wasser-
speienden Frauentorsi und absonderlichen Vögeln.
In der Folge der Vorlagen hatte sich herausgestellt, daß Deckers Stil in dem Maße erstarkte, als es ihm gelang, mit
wachsender Formkraft die Synthese des französischen und italienischen Motivmaterials persönlich zu gestalten. Un-
wesentliches hatte darin bestanden, die italienischen Elemente immer dann anzuwenden, wenn es sich um ein pathetisches
»Vorwärts« handelte, während die französischen begleitend, unterstreichend, ausklingend und nur selten zusammenfassend
blieben. Die in der Konzeption dreidimensionalen und architektonischen Formen, die im barocken Aufbau von unten nach
oben drängen, sind die italienischen, sie tragen die französischen. Deckers Aufgabe besteht darin, diese Wesenheiten
zum Ausdruck seiner Phantasien auszunutzen. Erst als er eindeutig diesen Weg betreten hatte, konnte er sie in end-
gültige Formen gießen. Das geschah in den Jahren zwischen 1706 und 1710. In diese Zeit sind die Entwurfzeichnungen
für den »Fürstlichen Baumeister« zu verlegen. Der »Fürstliche Baumeister«, eine induktive Baulehre in Gestalt eines
umfangreichen Stichwerkes, ist die wundervolle Ausreifung des meisterlichen Architekten; zugleich weist das Werk in
vielem fortschrittlich über seine Zeit hinaus. »Der ursprünglichen Absicht nach sollte das Ganze in fünf Teile zerfallen,
von denen der erste die Bearbeitung eines Residenzschloßentwurfes für einen Fürsten mit den dazu gehörigen Depen-
denzen und Gartenanlagen enthalten sollte; der zweite den Entwurf eines Königspalastes samt dazu gehörenden
dekorativen Anlagen (Triumphbögen, Ehrensäulen, Trauerkatafalken etc.), der dritte Zeichnungen für Lust- und Garten-
häuser, Orangerien, Grotten, Grottenhäuser und Ähnliches; der vierte Risse für Kirchen und Kapellen, der fünfte endlich
solche für Rathäuser, Spitäler, Börsen und Zeughäuser.« Der Plan dazu entstand in der Zeit, als Decker in Berlin unter
Schlüters Leitung beim Bau des Schlosses lernte und mitarbeitete. 1706 kam Decker von Berlin nach Nürnberg zurück
und voll von Schlüterschen Gedanken in der eigenen stark arbeitenden Phantasie, stieß er in Süddeutschland auf das
Fluidum der von Frankreich eindringenden und in Nürnberg und Augsburg vorsichtig aufgenommenen neuen Mode.
Seine Phantasien, die er in diesem Werke in Formen bannte, gehören zum Stärksten, was die deutsche Barockzeit
erträumte. Als Meister seiner Zeit schwelgte er in Raumvisjonen und ornamentalen Schmuckphantasien, die sich ihm in
einzelnen, seinen stärksten Entwürfen, zu großen Rauscherlebnissen gestalteten.
Im Leben Deckers fehlt auch die tragische Note, die es zu seiner eigenen Harmonie abrundet, nicht: die starke
Phantastik und das große Wollen fanden nicht die Möglichkeit, sich seinem Wesen gemäß auszuleben. Deckers Entwürfe
blieben, was sie waren, Entwürfe. Es war ihm versagt, große Aufgaben selbständig durchzuführen. Ehe sie an ihn heran-
traten, starb er 36jährig. Auch der Plan des »Fürstlichen Baumeisters« wurde von seinem Tode überholt; 131 Blatt
gelangten zur Ausführung, drei Teile von geplanten fünf. Die Übersetzung der Entwürfe in den Stich wurde andern über-
lassen. Decker schrieb ein Vorwort dazu, datiert von 1711 in Nürnberg.
Das umfangreiche Theoriewerk ist in zwei Fassungen zugänglich. In der Berliner Ornamentstichsammlung unter
dem Titel: »Fürstlicher Baumeister, oder: Architektura Civilis . . . Erster Teil, inventirt und gezeichnet, Durch Paulus
Decker . . . Verlegt von Jeremias Wolff Augspurg MDCCXI. (Enthält Titelkupfer, 8 Seiten Druck und 59 Blatt Stiche
Nr. 1 bis 59.) Anhang zum Ersten Theil . . . 1713. (Enthält Titel und 40 Blatt Nr. 1 bis 40.) Anderer Theil Welcher
Eines Königlichen Palastes General-Prospekt . . . vorstellet. Inventieret und gezeichnet Von Paulus Decker . . . Augs-
purg . . 1716. (Titel mit Text auf der Rückseite und 32 Blatt Nr. 1 bis 32.) Qu. Gr. Fol. (Stecher: Joh. Jac. Klein-
schmid, Georg Conr. Bodenehr, Joh. Conr. Reiff, Car. Rem(b)shart, Phil. Heinr. Kleinschmid, Jos. a Montalegre, Jh. Aug.
Corvinus, Martinus Engelbrecht, Joh. Balthas. Probst, Heinr. Jonas Ostertag, Gottfried Stein, Th. G. Beck, Joh. Ulrich
Kraus, Joh. Böcklin, Joh. Daniel Hertz, Joh. Christoph Steinberger, Gottfried Pflanz, Joh. Georg Schmidt) und in einem
Neudruck, herausgegeben von R. Dohme, Paul Deckers »Fürstlicher Baumeister« in 57 Taieln, Berlin 1885. In der Ein-
leitung dazu bringt Dohme Nachrichten über Deckers Leben, seine Stellung zu Schlüter und wohl als erster eine
Würdigung des Meisters. Die Tafeln 1 bis 6 sind laut Dohmes Einleitung anstatt nach Stichen, nach Handzeichnungen
Deckers reproduziert, um zugleich seine subtile und meisterlich überlegene Art des Entwerfens klar zu machen. Die
57 Tafeln sind eine Auslese aus der ersten Ausgabe gemäß dem Bestreben Dohmes, durch Vorlagen auf seine stil-
suchende Zeit einzuwirken; weil er den größeren Wert in der angewendeten Form sehen mochte, bringt er nur Reproduk-
— 73 —
Akanthus, zusammen und tragen den Gekreuzigten empor. Über ihm ein Lambrequin und Gott Vater in Wolken, strahlend,
thronend. Die beiden folgenden Entwürfe so ekstatisch und dabei kapriziös, wie sie nur einem barocken Deutschen
einfallen konnten, bei aller Anlehnung an italienische Vorbilder stark und eigen, wiederum durch die Durchsetzung der
französischen und italienischen Motive zu einer Stileinheit. Immer klarer werden jetzt Deckers persönlicher Stil und
die reichen Möglichkeiten seiner Phantasie.
Ebenso verhält es sich mit den Sarkophag-, Gucridon-, Kartuschen- und Kreuzfußentwürfen, den sehr interessanten
Katafalkaufbauten, in denen die Zusammensetzung der Motive von unten nach oben das Erlebnis steigert. Solche Katafalke
und so reiche, phantastische »Chamine«, wie der von »S. Koenigl. Hoheit Cabinet in der Orangerie zu C. Erlang«, die in
vieler Hinsicht Lösungen der deutschen Regence (Effner) vorwegnehmen, gibt es weder in Frankreich noch Italien.
Diese bunte, wechselvolle Reihe von Entwürfen klingt entzückend in deutscher Laune in der »Pilder Nische in dem
Sahl der Orengerie zu Erlang« aus mit dem Aufbau über einem Becken aus Grottenwerk und Muscheln, den wasser-
speienden Frauentorsi und absonderlichen Vögeln.
In der Folge der Vorlagen hatte sich herausgestellt, daß Deckers Stil in dem Maße erstarkte, als es ihm gelang, mit
wachsender Formkraft die Synthese des französischen und italienischen Motivmaterials persönlich zu gestalten. Un-
wesentliches hatte darin bestanden, die italienischen Elemente immer dann anzuwenden, wenn es sich um ein pathetisches
»Vorwärts« handelte, während die französischen begleitend, unterstreichend, ausklingend und nur selten zusammenfassend
blieben. Die in der Konzeption dreidimensionalen und architektonischen Formen, die im barocken Aufbau von unten nach
oben drängen, sind die italienischen, sie tragen die französischen. Deckers Aufgabe besteht darin, diese Wesenheiten
zum Ausdruck seiner Phantasien auszunutzen. Erst als er eindeutig diesen Weg betreten hatte, konnte er sie in end-
gültige Formen gießen. Das geschah in den Jahren zwischen 1706 und 1710. In diese Zeit sind die Entwurfzeichnungen
für den »Fürstlichen Baumeister« zu verlegen. Der »Fürstliche Baumeister«, eine induktive Baulehre in Gestalt eines
umfangreichen Stichwerkes, ist die wundervolle Ausreifung des meisterlichen Architekten; zugleich weist das Werk in
vielem fortschrittlich über seine Zeit hinaus. »Der ursprünglichen Absicht nach sollte das Ganze in fünf Teile zerfallen,
von denen der erste die Bearbeitung eines Residenzschloßentwurfes für einen Fürsten mit den dazu gehörigen Depen-
denzen und Gartenanlagen enthalten sollte; der zweite den Entwurf eines Königspalastes samt dazu gehörenden
dekorativen Anlagen (Triumphbögen, Ehrensäulen, Trauerkatafalken etc.), der dritte Zeichnungen für Lust- und Garten-
häuser, Orangerien, Grotten, Grottenhäuser und Ähnliches; der vierte Risse für Kirchen und Kapellen, der fünfte endlich
solche für Rathäuser, Spitäler, Börsen und Zeughäuser.« Der Plan dazu entstand in der Zeit, als Decker in Berlin unter
Schlüters Leitung beim Bau des Schlosses lernte und mitarbeitete. 1706 kam Decker von Berlin nach Nürnberg zurück
und voll von Schlüterschen Gedanken in der eigenen stark arbeitenden Phantasie, stieß er in Süddeutschland auf das
Fluidum der von Frankreich eindringenden und in Nürnberg und Augsburg vorsichtig aufgenommenen neuen Mode.
Seine Phantasien, die er in diesem Werke in Formen bannte, gehören zum Stärksten, was die deutsche Barockzeit
erträumte. Als Meister seiner Zeit schwelgte er in Raumvisjonen und ornamentalen Schmuckphantasien, die sich ihm in
einzelnen, seinen stärksten Entwürfen, zu großen Rauscherlebnissen gestalteten.
Im Leben Deckers fehlt auch die tragische Note, die es zu seiner eigenen Harmonie abrundet, nicht: die starke
Phantastik und das große Wollen fanden nicht die Möglichkeit, sich seinem Wesen gemäß auszuleben. Deckers Entwürfe
blieben, was sie waren, Entwürfe. Es war ihm versagt, große Aufgaben selbständig durchzuführen. Ehe sie an ihn heran-
traten, starb er 36jährig. Auch der Plan des »Fürstlichen Baumeisters« wurde von seinem Tode überholt; 131 Blatt
gelangten zur Ausführung, drei Teile von geplanten fünf. Die Übersetzung der Entwürfe in den Stich wurde andern über-
lassen. Decker schrieb ein Vorwort dazu, datiert von 1711 in Nürnberg.
Das umfangreiche Theoriewerk ist in zwei Fassungen zugänglich. In der Berliner Ornamentstichsammlung unter
dem Titel: »Fürstlicher Baumeister, oder: Architektura Civilis . . . Erster Teil, inventirt und gezeichnet, Durch Paulus
Decker . . . Verlegt von Jeremias Wolff Augspurg MDCCXI. (Enthält Titelkupfer, 8 Seiten Druck und 59 Blatt Stiche
Nr. 1 bis 59.) Anhang zum Ersten Theil . . . 1713. (Enthält Titel und 40 Blatt Nr. 1 bis 40.) Anderer Theil Welcher
Eines Königlichen Palastes General-Prospekt . . . vorstellet. Inventieret und gezeichnet Von Paulus Decker . . . Augs-
purg . . 1716. (Titel mit Text auf der Rückseite und 32 Blatt Nr. 1 bis 32.) Qu. Gr. Fol. (Stecher: Joh. Jac. Klein-
schmid, Georg Conr. Bodenehr, Joh. Conr. Reiff, Car. Rem(b)shart, Phil. Heinr. Kleinschmid, Jos. a Montalegre, Jh. Aug.
Corvinus, Martinus Engelbrecht, Joh. Balthas. Probst, Heinr. Jonas Ostertag, Gottfried Stein, Th. G. Beck, Joh. Ulrich
Kraus, Joh. Böcklin, Joh. Daniel Hertz, Joh. Christoph Steinberger, Gottfried Pflanz, Joh. Georg Schmidt) und in einem
Neudruck, herausgegeben von R. Dohme, Paul Deckers »Fürstlicher Baumeister« in 57 Taieln, Berlin 1885. In der Ein-
leitung dazu bringt Dohme Nachrichten über Deckers Leben, seine Stellung zu Schlüter und wohl als erster eine
Würdigung des Meisters. Die Tafeln 1 bis 6 sind laut Dohmes Einleitung anstatt nach Stichen, nach Handzeichnungen
Deckers reproduziert, um zugleich seine subtile und meisterlich überlegene Art des Entwerfens klar zu machen. Die
57 Tafeln sind eine Auslese aus der ersten Ausgabe gemäß dem Bestreben Dohmes, durch Vorlagen auf seine stil-
suchende Zeit einzuwirken; weil er den größeren Wert in der angewendeten Form sehen mochte, bringt er nur Reproduk-
— 73 —