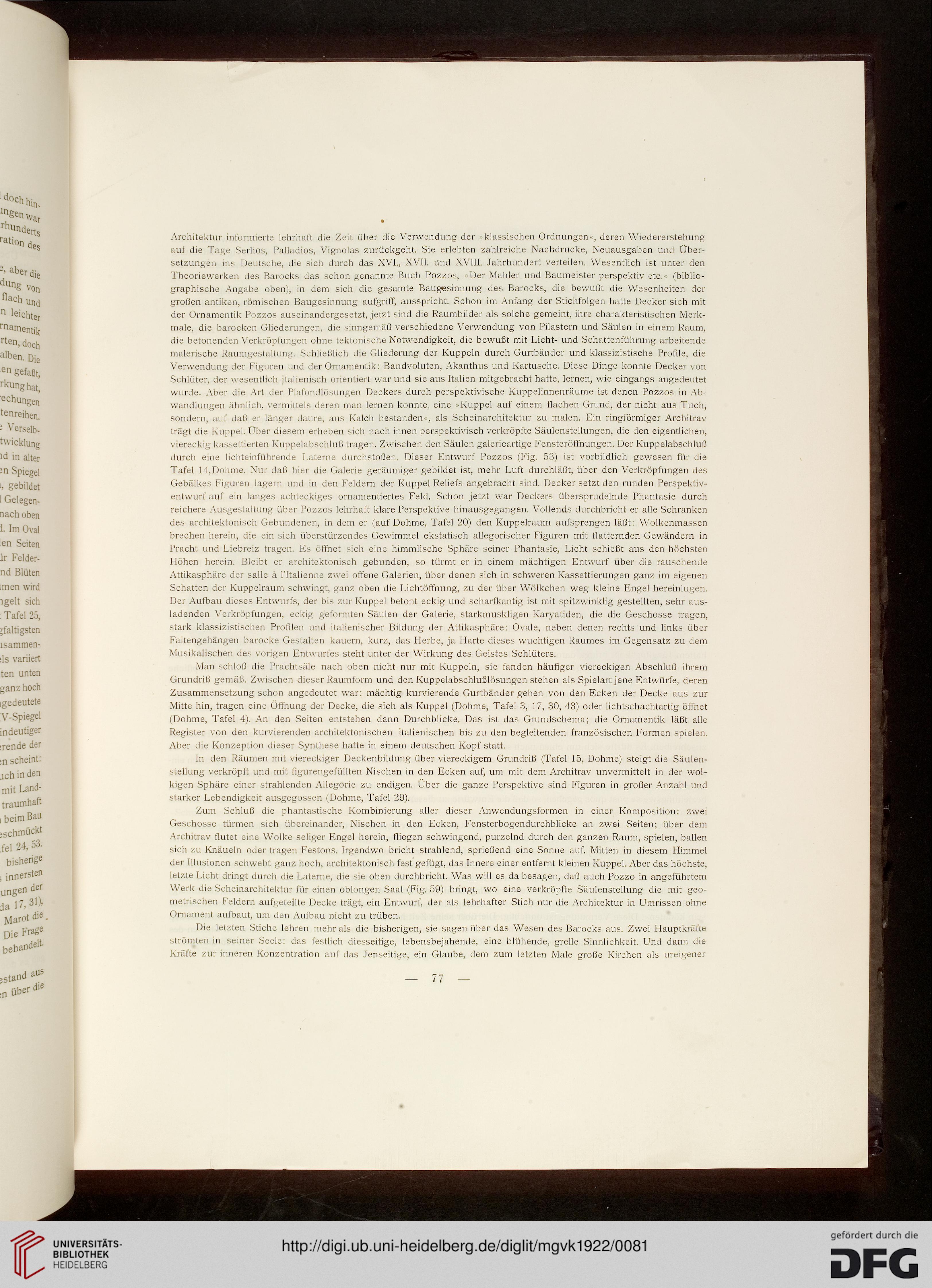'Wir
von
«ntiit
Architektur informierte lehrhaft die Zeit über die Verwendung der ■klassischen Ordnungen«, deren Wiedererstehung
aut die Tage Serlios, Palladios, Vignolas zurückgeht. Sie erlebten zahlreiche Nachdrucke, Neuausgaben und Über-
setzungen ins Deutsche, die sicli durch das XVI., XVII. und XVIII. Jahrhundert verteilen. Wesentlich ist unter den
Theoriewerken des Barocks das schon genannte Buch Pozzos, »Der Mahler und Baumeister perspektiv etc.« (biblio-
graphische Angabe oben), in dem sich die gesamte Baugesinnung des Barocks, die bewußt die Wesenheiten der
großen antiken, römischen Baugesinnung aufgriff, ausspricht. Schon im Anfang der Stichfolgen hatte Decker sich mit
der Ornamentik Pozzos auseinandergesetzt, jetzt sind die Raumbilder als solche gemeint, ihre charakteristischen Merk-
male, die barocken Gliederungen, die sinngemäß verschiedene Verwendung von Pilastern und Säulen in einem Raum,
die betonenden Verkröpfungen ohne tektonische Notwendigkeit, die bewußt mit Licht- und Schattenführung arbeitende
malerische Raumgestaltung. Schließlich die Gliederung der Kuppeln durch Gurtbänder und klassizistische Profile, die
Verwendung der Figuren und der Ornamentik: Bandvoluten, Akanthus und Kartusche. Diese Dinge konnte Decker von
Schlüter, der wesentlich italienisch orientiert war und sie aus Italien mitgebracht hatte, lernen, wie eingangs angedeutet
wurde. Aber die Art der Plafondlösungen Deckers durch perspektivische Kuppelinnenräume ist denen Pozzos in Ab-
wandlungen ähnlich, vermittels deren man lernen konnte, eine »Kuppel auf einem flachen Grund, der nicht aus Tuch,
sondern, auf daß er länger daure, aus Kalch bestanden«, als Scheinarchitektur zu malen. Ein ringförmiger Architrav
trägt die Kuppel. Über diesem erheben sich nach innen perspektivisch verkröpfte Säulenstellungen, die den eigentlichen,
viereckig kassettierten Kuppelabschluß tragen. Zwischen den Säulen galerieartige Fensteröffnungen. Der Kuppelabschluß
durch eine lichteinführende Laterne durchstoßen. Dieser Entwurf Pozzos (Fig. 53) ist vorbildlich gewesen für die
Tafel 14,Dohme. Nur daß hier die Galerie geräumiger gebildet ist, mehr Luft durchläßt, über den Verkröpfungen des
Gebälkes Figuren lagern und in den Feldern der Kuppel Reliefs angebracht sind. Decker setzt den runden Perspektiv-
entwurf auf ein langes achteckiges ornamentiertes Feld. Schon jetzt war Deckers übersprudelnde Phantasie durch
reichere Ausgestaltung über Pozzos lehrhaft klare Perspektive hinausgegangen. Vollends durchbricht er alle Schranken
des architektonisch Gebundenen, in dem er (auf Dohme, Tafel 20) den Kuppelraum aufsprengen läßt: Wolkenmassen
brechen herein, die ein sich überstürzendes Gewimmel ekstatisch allegorischer Figuren mit flatternden Gewändern in
Pracht und Liebreiz tragen. Es öffnet sich eine himmlische Sphäre seiner Phantasie, Licht schießt aus den höchsten
Höhen herein. Bleibt er architektonisch gebunden, so türmt er in einem mächtigen Entwurf über die rauschende
Attikasphäre der salle ä l'Italienne zwei offene Galerien, über denen sich in schweren Kassettierungen ganz im eigenen
Schatten der Kuppelraum schwingt, ganz oben die Lichtöffnung, zu der über Wölkchen weg kleine Engel hereinlugen.
Der Aufbau dieses Entwurfs, der bis zur Kuppel betont eckig und scharfkantig ist mit spitzwinklig gestellten, sehr aus-
ladenden Verkröpfungen, eckig geformten Säulen der Galerie, starkmuskligen Karyatiden, die die Geschosse tragen,
stark klassizistischen Profilen und italienischer Bildung der Attikasphäre: Ovale, neben denen rechts und links über
Faltengehängen barocke Gestalten kauern, kurz, das Herbe, ja Harte dieses wuchtigen Raumes im Gegensatz zu dem
Musikalischen des vorigen Entwurfes steht unter der Wirkung des Geistes Schlüters.
Man schloß die Prachtsäle nach oben nicht nur mit Kuppeln, sie fanden häufiger viereckigen Abschluß ihrem
Grundriß gemäß. Zwischen dieser Raumform und den Kuppelabschlußlösungen stehen als Spielart jene Entwürfe, deren
Zusammensetzung schon angedeutet war: mächtig kurvierende Gurtbänder gehen von den Ecken der Decke aus zur
Mitte hin, tragen eine Öffnung der Decke, die sich als Kuppel (Dohme, Tafel 3, 17, 30, 43) oder lichtschachtartig öffnet
(Dohme, Tafel 4). An den Seiten entstehen dann Durchblicke. Das ist das Grundschema; die Ornamentik läßt alle
Register von den kurvierenden architektonischen italienischen bis zu den begleitenden französischen Formen spielen.
Aber die Konzeption dieser Synthese hatte in einem deutschen Kopf statt.
In den Räumen mit viereckiger Deckenbildung über viereckigem Grundriß (Tafel 15, Dohme) steigt die Säulen-
stellung verkröpft und mit figurengefüllten Nischen in den Ecken auf, um mit dem Architrav unvermittelt in der wol-
kigen Sphäre einer strahlenden Allegorie zu endigen. Über die ganze Perspektive sind Figuren in großer Anzahl und
starker Lebendigkeit ausgegossen (Dohme, Tafel 29).
Zum Schluß die phantastische Kombinierung aller dieser Anwendungsformen in einer Komposition: zwei
Geschosse türmen sich übereinander, Nischen in den Ecken, Fensterbogendurchblicke an zwei Seiten; über dem
Architrav flutet eine Wolke seliger Engel herein, fliegen schwingend, purzelnd durch den ganzen Raum, spielen, ballen
sich zu Knäueln oder tragen Festons. Irgendwo bricht strahlend, sprießend eine Sonne auf. Mitten in diesem Himmel
der Illusionen schwebt ganz hoch, architektonisch fest gefügt, das Innere einer entfernt kleinen Kuppel. Aber das höchste,
letzte Licht dringt durch die Laterne, die sie oben durchbricht. Was will es da besagen, daß auch Pozzo in angeführtem
Werk die Scheinarchitektur für einen oblongen Saal (Fig. 59) bringt, wo eine verkröpfte Säulenstellung die mit geo-
metrischen Feldern aufgeteilte Decke trägt, ein Entwurf, der als lehrhafter Stich nur die Architektur in Umrissen ohne
Ornament aufbaut, um den Aufbau nicht zu trüben.
Die letzten Stiche lehren mehr als die bisherigen, sie sagen über das Wesen des Barocks aus. Zwei Hauptkräfte
strömten in seiner Seele: das festlich diesseitige, lebensbejahende, eine blühende, grelle Sinnlichkeit. Und dann die
Kräfte zur inneren Konzentration auf das Jenseitige, ein Glaube, dem zum letzten Male große Kirchen als ureigener
aus
r die
/ t
von
«ntiit
Architektur informierte lehrhaft die Zeit über die Verwendung der ■klassischen Ordnungen«, deren Wiedererstehung
aut die Tage Serlios, Palladios, Vignolas zurückgeht. Sie erlebten zahlreiche Nachdrucke, Neuausgaben und Über-
setzungen ins Deutsche, die sicli durch das XVI., XVII. und XVIII. Jahrhundert verteilen. Wesentlich ist unter den
Theoriewerken des Barocks das schon genannte Buch Pozzos, »Der Mahler und Baumeister perspektiv etc.« (biblio-
graphische Angabe oben), in dem sich die gesamte Baugesinnung des Barocks, die bewußt die Wesenheiten der
großen antiken, römischen Baugesinnung aufgriff, ausspricht. Schon im Anfang der Stichfolgen hatte Decker sich mit
der Ornamentik Pozzos auseinandergesetzt, jetzt sind die Raumbilder als solche gemeint, ihre charakteristischen Merk-
male, die barocken Gliederungen, die sinngemäß verschiedene Verwendung von Pilastern und Säulen in einem Raum,
die betonenden Verkröpfungen ohne tektonische Notwendigkeit, die bewußt mit Licht- und Schattenführung arbeitende
malerische Raumgestaltung. Schließlich die Gliederung der Kuppeln durch Gurtbänder und klassizistische Profile, die
Verwendung der Figuren und der Ornamentik: Bandvoluten, Akanthus und Kartusche. Diese Dinge konnte Decker von
Schlüter, der wesentlich italienisch orientiert war und sie aus Italien mitgebracht hatte, lernen, wie eingangs angedeutet
wurde. Aber die Art der Plafondlösungen Deckers durch perspektivische Kuppelinnenräume ist denen Pozzos in Ab-
wandlungen ähnlich, vermittels deren man lernen konnte, eine »Kuppel auf einem flachen Grund, der nicht aus Tuch,
sondern, auf daß er länger daure, aus Kalch bestanden«, als Scheinarchitektur zu malen. Ein ringförmiger Architrav
trägt die Kuppel. Über diesem erheben sich nach innen perspektivisch verkröpfte Säulenstellungen, die den eigentlichen,
viereckig kassettierten Kuppelabschluß tragen. Zwischen den Säulen galerieartige Fensteröffnungen. Der Kuppelabschluß
durch eine lichteinführende Laterne durchstoßen. Dieser Entwurf Pozzos (Fig. 53) ist vorbildlich gewesen für die
Tafel 14,Dohme. Nur daß hier die Galerie geräumiger gebildet ist, mehr Luft durchläßt, über den Verkröpfungen des
Gebälkes Figuren lagern und in den Feldern der Kuppel Reliefs angebracht sind. Decker setzt den runden Perspektiv-
entwurf auf ein langes achteckiges ornamentiertes Feld. Schon jetzt war Deckers übersprudelnde Phantasie durch
reichere Ausgestaltung über Pozzos lehrhaft klare Perspektive hinausgegangen. Vollends durchbricht er alle Schranken
des architektonisch Gebundenen, in dem er (auf Dohme, Tafel 20) den Kuppelraum aufsprengen läßt: Wolkenmassen
brechen herein, die ein sich überstürzendes Gewimmel ekstatisch allegorischer Figuren mit flatternden Gewändern in
Pracht und Liebreiz tragen. Es öffnet sich eine himmlische Sphäre seiner Phantasie, Licht schießt aus den höchsten
Höhen herein. Bleibt er architektonisch gebunden, so türmt er in einem mächtigen Entwurf über die rauschende
Attikasphäre der salle ä l'Italienne zwei offene Galerien, über denen sich in schweren Kassettierungen ganz im eigenen
Schatten der Kuppelraum schwingt, ganz oben die Lichtöffnung, zu der über Wölkchen weg kleine Engel hereinlugen.
Der Aufbau dieses Entwurfs, der bis zur Kuppel betont eckig und scharfkantig ist mit spitzwinklig gestellten, sehr aus-
ladenden Verkröpfungen, eckig geformten Säulen der Galerie, starkmuskligen Karyatiden, die die Geschosse tragen,
stark klassizistischen Profilen und italienischer Bildung der Attikasphäre: Ovale, neben denen rechts und links über
Faltengehängen barocke Gestalten kauern, kurz, das Herbe, ja Harte dieses wuchtigen Raumes im Gegensatz zu dem
Musikalischen des vorigen Entwurfes steht unter der Wirkung des Geistes Schlüters.
Man schloß die Prachtsäle nach oben nicht nur mit Kuppeln, sie fanden häufiger viereckigen Abschluß ihrem
Grundriß gemäß. Zwischen dieser Raumform und den Kuppelabschlußlösungen stehen als Spielart jene Entwürfe, deren
Zusammensetzung schon angedeutet war: mächtig kurvierende Gurtbänder gehen von den Ecken der Decke aus zur
Mitte hin, tragen eine Öffnung der Decke, die sich als Kuppel (Dohme, Tafel 3, 17, 30, 43) oder lichtschachtartig öffnet
(Dohme, Tafel 4). An den Seiten entstehen dann Durchblicke. Das ist das Grundschema; die Ornamentik läßt alle
Register von den kurvierenden architektonischen italienischen bis zu den begleitenden französischen Formen spielen.
Aber die Konzeption dieser Synthese hatte in einem deutschen Kopf statt.
In den Räumen mit viereckiger Deckenbildung über viereckigem Grundriß (Tafel 15, Dohme) steigt die Säulen-
stellung verkröpft und mit figurengefüllten Nischen in den Ecken auf, um mit dem Architrav unvermittelt in der wol-
kigen Sphäre einer strahlenden Allegorie zu endigen. Über die ganze Perspektive sind Figuren in großer Anzahl und
starker Lebendigkeit ausgegossen (Dohme, Tafel 29).
Zum Schluß die phantastische Kombinierung aller dieser Anwendungsformen in einer Komposition: zwei
Geschosse türmen sich übereinander, Nischen in den Ecken, Fensterbogendurchblicke an zwei Seiten; über dem
Architrav flutet eine Wolke seliger Engel herein, fliegen schwingend, purzelnd durch den ganzen Raum, spielen, ballen
sich zu Knäueln oder tragen Festons. Irgendwo bricht strahlend, sprießend eine Sonne auf. Mitten in diesem Himmel
der Illusionen schwebt ganz hoch, architektonisch fest gefügt, das Innere einer entfernt kleinen Kuppel. Aber das höchste,
letzte Licht dringt durch die Laterne, die sie oben durchbricht. Was will es da besagen, daß auch Pozzo in angeführtem
Werk die Scheinarchitektur für einen oblongen Saal (Fig. 59) bringt, wo eine verkröpfte Säulenstellung die mit geo-
metrischen Feldern aufgeteilte Decke trägt, ein Entwurf, der als lehrhafter Stich nur die Architektur in Umrissen ohne
Ornament aufbaut, um den Aufbau nicht zu trüben.
Die letzten Stiche lehren mehr als die bisherigen, sie sagen über das Wesen des Barocks aus. Zwei Hauptkräfte
strömten in seiner Seele: das festlich diesseitige, lebensbejahende, eine blühende, grelle Sinnlichkeit. Und dann die
Kräfte zur inneren Konzentration auf das Jenseitige, ein Glaube, dem zum letzten Male große Kirchen als ureigener
aus
r die
/ t