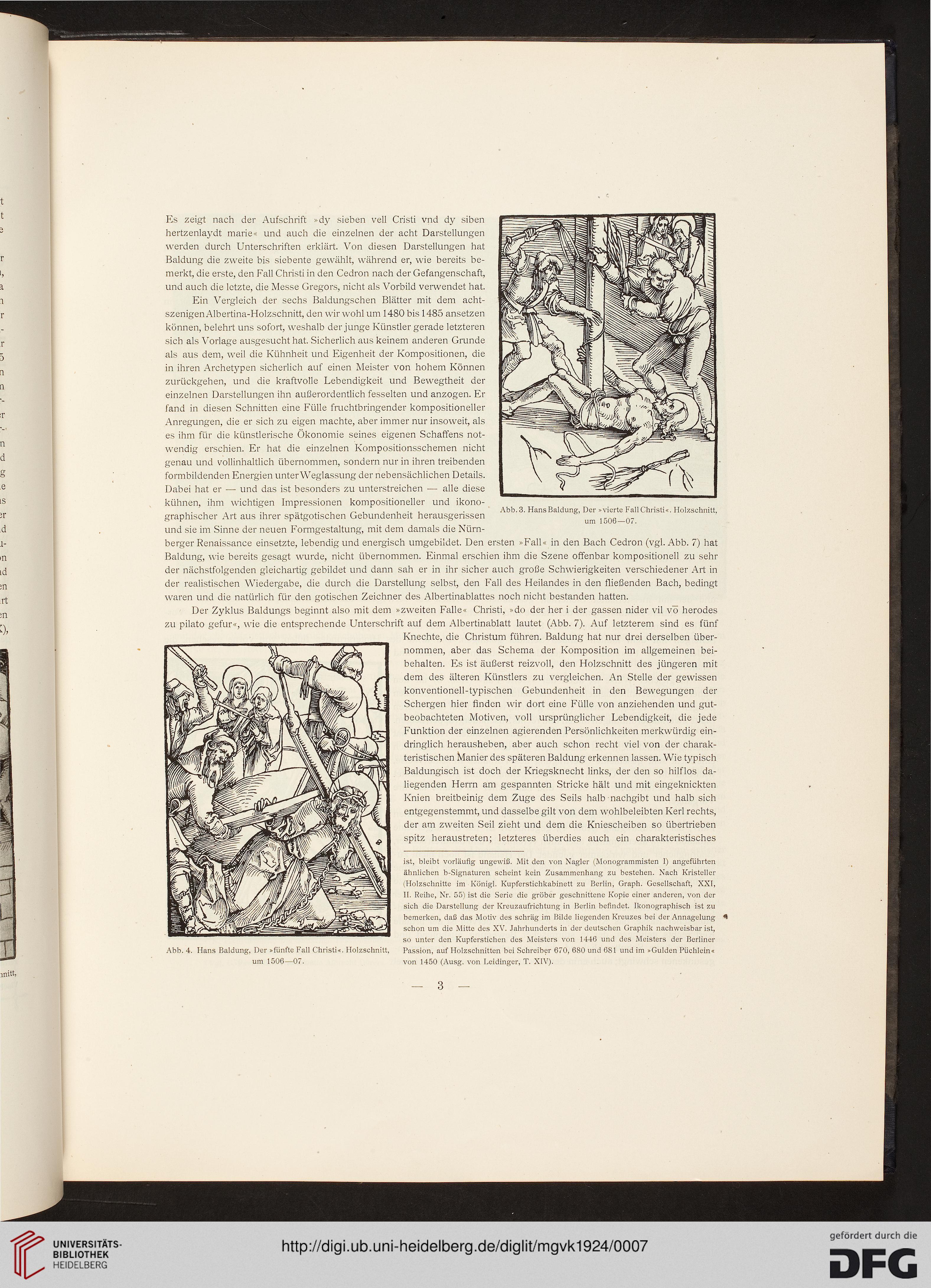Abb. 3. HansBalduns
Der »vierte Fall Christi«. Holzschnitt,
um 1506—07.
Es zeigt nach der Aufschrift »dy sieben vell Cristi vnd dy siben
hertzenlaydt marie« und auch die einzelnen der acht Darstellungen
werden durch Unterschriften erklärt. Von diesen Darstellungen hat
Baidung die zweite bis siebente gewählt, während er, wie bereits be-
merkt, die erste, den Fall Christi in den Cedron nach der Gefangenschaft,
und auch die letzte, die Messe Gregors, nicht als Vorbild verwendet hat.
Ein Vergleich der sechs Baldungschen Blätter mit dem acht-
szenigen Albertina-Holzschnitt, den wir wohl um 1480 bis 1485 ansetzen
können, belehrt uns sofort, weshalb der junge Künstler gerade letzteren
sich als Vorlage ausgesucht hat. Sicherlich aus keinem anderen Grunde
als aus dem, weil die Kühnheit und Eigenheit der Kompositionen, die
in ihren Archetypen sicherlich auf einen Meister von hohem Können
zurückgehen, und die kraftvolle Lebendigkeit und Bewegtheit der
einzelnen Darstellungen ihn außerordentlich fesselten und anzogen. Er
fand in diesen Schnitten eine Fülle fruchtbringender kompositioneller
Anregungen, die er sich zu eigen machte, aber immer nur insoweit, als
es ihm für die künstlerische Ökonomie seines eigenen Schaffens not-
wendig erschien. Er hat die einzelnen Kompositionsschemen nicht
genau und vollinhaltlich übernommen, sondern nur in ihren treibenden
formbildenden Energien unter Weglassung der nebensächlichen Details.
Dabei hat er — und das ist besonders zu unterstreichen — alle diese
kühnen, ihm wichtigen Impressionen kompositioneller und ikono-
graphischer Art aus ihrer spätgotischen Gebundenheit herausgerissen
und sie im Sinne der neuen Formgestaltung, mit dem damals die Nürn-
berger Renaissance einsetzte, lebendig und energisch umgebildet. Den ersten »Fall« in den Bach Cedron (vgl. Abb. 7) hat
Baidung, wie bereits gesagt wurde, nicht übernommen. Einmal erschien ihm die Szene offenbar kompositioneil zu sehr
der nächstfolgenden gleichartig gebildet und dann sah er in ihr sicher auch große Schwierigkeiten verschiedener Art in
der realistischen Wiedergabe, die durch die Darstellung selbst, den Fall des Heilandes in den fließenden Bach, bedingt
waren und die natürlich für den gotischen Zeichner des Albertinablattes noch nicht bestanden hatten.
Der Zyklus Baidungs beginnt also mit dem »zweiten Falle« Christi, »do der her i der gassen nider vil vö herodes
zu pilato gefur«, wie die entsprechende Unterschrift auf dem Albertinablatt lautet (Abb. 7). Auf letzterem sind es fünf
Knechte, die Christum führen. Baidung hat nur drei derselben über-
nommen, aber das Schema der Komposition im allgemeinen bei-
behalten. Es ist äußerst reizvoll, den Holzschnitt des jüngeren mit
dem des älteren Künstlers zu vergleichen. An Stelle der gewissen
konventionell-typischen Gebundenheit in den Bewegungen der
Schergen hier finden wir dort eine Fülle von anziehenden und gut-
beobachteten Motiven, voll ursprünglicher Lebendigkeit, die jede
Funktion der einzelnen agierenden Persönlichkeiten merkwürdig ein-
dringlich herausheben, aber auch schon recht viel von der charak-
teristischen Manier des späteren Baidung erkennen lassen. Wie typisch
Baldungisch ist doch der Kriegsknecht links, der den so hilflos da-
liegenden Herrn am gespannten Stricke hält und mit eingeknickten
Knien breitbeinig dem Zuge des Seils halb nachgibt und halb sich
entgegenstemmt, und dasselbe gilt von dem wohlbeleibten Kerl rechts,
der am zweiten Seil zieht und dem die Kniescheiben so übertrieben
spitz heraustreten; letzteres überdies auch ein charakteristisches
Abb. 4. Hans Baidung, Der »fünfte Fall Christi«
um 1506—07.
I lolzschnitt,
ist, bleibt vorläufig ungewiß. Mit den von Xagler (Monogrammisten 1) angeführten
ähnlichen b-Signaturen scheint kein Zusammenhang zu bestehen. Nach Kristeller
(Holzschnitte im Königl. Kupferstichkabinett zu Berlin, Graph. Gesellschaft, XXI,
II. Reihe, Nr. 55) ist die Serie die gröber geschnittene Kopie einer anderen, von der
sich die Darstellung der Kreuzaufrichtung in Berlin befindet. Ikonographisch ist zu
bemerken, daß das Motiv des schräg im Bilde liegenden Kreuzes bei der Annagelung
schon um die Mitte des XV. Jahrhunderts in der deutschen Graphik nachweisbar ist,
so unter den Kupferstichen des Meisters von 1446 und des Meisters der Berliner
Passion, auf Holzschnitten bei Schreiber 670, 680 und 681 und im »Gulden Piichlein«
von 1450 (Ausg. von Leidinger, T. XIV).
— 3 —
Der »vierte Fall Christi«. Holzschnitt,
um 1506—07.
Es zeigt nach der Aufschrift »dy sieben vell Cristi vnd dy siben
hertzenlaydt marie« und auch die einzelnen der acht Darstellungen
werden durch Unterschriften erklärt. Von diesen Darstellungen hat
Baidung die zweite bis siebente gewählt, während er, wie bereits be-
merkt, die erste, den Fall Christi in den Cedron nach der Gefangenschaft,
und auch die letzte, die Messe Gregors, nicht als Vorbild verwendet hat.
Ein Vergleich der sechs Baldungschen Blätter mit dem acht-
szenigen Albertina-Holzschnitt, den wir wohl um 1480 bis 1485 ansetzen
können, belehrt uns sofort, weshalb der junge Künstler gerade letzteren
sich als Vorlage ausgesucht hat. Sicherlich aus keinem anderen Grunde
als aus dem, weil die Kühnheit und Eigenheit der Kompositionen, die
in ihren Archetypen sicherlich auf einen Meister von hohem Können
zurückgehen, und die kraftvolle Lebendigkeit und Bewegtheit der
einzelnen Darstellungen ihn außerordentlich fesselten und anzogen. Er
fand in diesen Schnitten eine Fülle fruchtbringender kompositioneller
Anregungen, die er sich zu eigen machte, aber immer nur insoweit, als
es ihm für die künstlerische Ökonomie seines eigenen Schaffens not-
wendig erschien. Er hat die einzelnen Kompositionsschemen nicht
genau und vollinhaltlich übernommen, sondern nur in ihren treibenden
formbildenden Energien unter Weglassung der nebensächlichen Details.
Dabei hat er — und das ist besonders zu unterstreichen — alle diese
kühnen, ihm wichtigen Impressionen kompositioneller und ikono-
graphischer Art aus ihrer spätgotischen Gebundenheit herausgerissen
und sie im Sinne der neuen Formgestaltung, mit dem damals die Nürn-
berger Renaissance einsetzte, lebendig und energisch umgebildet. Den ersten »Fall« in den Bach Cedron (vgl. Abb. 7) hat
Baidung, wie bereits gesagt wurde, nicht übernommen. Einmal erschien ihm die Szene offenbar kompositioneil zu sehr
der nächstfolgenden gleichartig gebildet und dann sah er in ihr sicher auch große Schwierigkeiten verschiedener Art in
der realistischen Wiedergabe, die durch die Darstellung selbst, den Fall des Heilandes in den fließenden Bach, bedingt
waren und die natürlich für den gotischen Zeichner des Albertinablattes noch nicht bestanden hatten.
Der Zyklus Baidungs beginnt also mit dem »zweiten Falle« Christi, »do der her i der gassen nider vil vö herodes
zu pilato gefur«, wie die entsprechende Unterschrift auf dem Albertinablatt lautet (Abb. 7). Auf letzterem sind es fünf
Knechte, die Christum führen. Baidung hat nur drei derselben über-
nommen, aber das Schema der Komposition im allgemeinen bei-
behalten. Es ist äußerst reizvoll, den Holzschnitt des jüngeren mit
dem des älteren Künstlers zu vergleichen. An Stelle der gewissen
konventionell-typischen Gebundenheit in den Bewegungen der
Schergen hier finden wir dort eine Fülle von anziehenden und gut-
beobachteten Motiven, voll ursprünglicher Lebendigkeit, die jede
Funktion der einzelnen agierenden Persönlichkeiten merkwürdig ein-
dringlich herausheben, aber auch schon recht viel von der charak-
teristischen Manier des späteren Baidung erkennen lassen. Wie typisch
Baldungisch ist doch der Kriegsknecht links, der den so hilflos da-
liegenden Herrn am gespannten Stricke hält und mit eingeknickten
Knien breitbeinig dem Zuge des Seils halb nachgibt und halb sich
entgegenstemmt, und dasselbe gilt von dem wohlbeleibten Kerl rechts,
der am zweiten Seil zieht und dem die Kniescheiben so übertrieben
spitz heraustreten; letzteres überdies auch ein charakteristisches
Abb. 4. Hans Baidung, Der »fünfte Fall Christi«
um 1506—07.
I lolzschnitt,
ist, bleibt vorläufig ungewiß. Mit den von Xagler (Monogrammisten 1) angeführten
ähnlichen b-Signaturen scheint kein Zusammenhang zu bestehen. Nach Kristeller
(Holzschnitte im Königl. Kupferstichkabinett zu Berlin, Graph. Gesellschaft, XXI,
II. Reihe, Nr. 55) ist die Serie die gröber geschnittene Kopie einer anderen, von der
sich die Darstellung der Kreuzaufrichtung in Berlin befindet. Ikonographisch ist zu
bemerken, daß das Motiv des schräg im Bilde liegenden Kreuzes bei der Annagelung
schon um die Mitte des XV. Jahrhunderts in der deutschen Graphik nachweisbar ist,
so unter den Kupferstichen des Meisters von 1446 und des Meisters der Berliner
Passion, auf Holzschnitten bei Schreiber 670, 680 und 681 und im »Gulden Piichlein«
von 1450 (Ausg. von Leidinger, T. XIV).
— 3 —