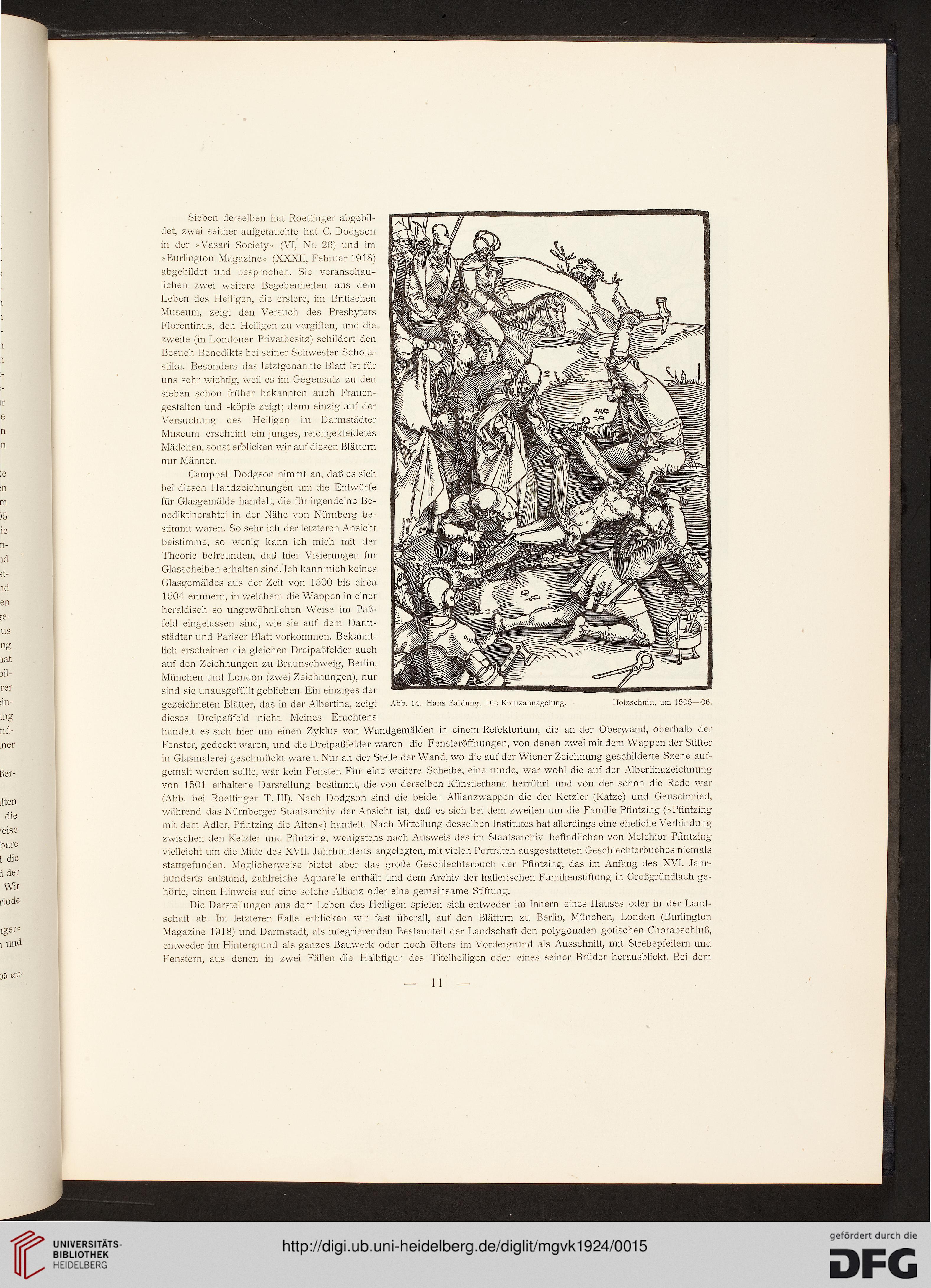Sieben derselben hat Roettinger abgebil-
det, zwei seither aufgetauchte hat C. Dodgson
in der »Vasari Society« (VI, Nr. 26) und im
»Burlington Magazine« (XXXII, Februar 1918)
abgebildet und besprochen. Sie veranschau-
lichen zwei weitere Begebenheiten aus dem
Leben des Heiligen, die erstere, im Britischen
Museum, zeigt den Versuch des Presbyters
Florentinus, den Heiligen zu vergiften, und die
zweite (in Londoner Privatbesitz) schildert den
Besuch Benedikts bei seiner Schwester Schola-
stika. Besonders das letztgenannte Blatt ist für
uns sehr wichtig, weil es im Gegensatz zu den
sieben schon früher bekannten auch Frauen-
gestalten und -köpfe zeigt; denn einzig auf der
Versuchung des Heiligen im Darmstädter
Museum erscheint ein junges, reichgekleidetes
Mädchen, sonst erblicken wir auf diesen Blättern
nur Männer.
Campbell Dodgson nimmt an, daß es sich
bei diesen Handzeichnungen um die Entwürfe
für Glasgemälde handelt, die für irgendeine Be-
nediktinerabtei in der Nähe von Nürnberg be-
stimmt waren. So sehr ich der letzteren Ansicht
beistimme, so wenig kann ich mich mit der
Theorie befreunden, daß hier Visierungen für
Glasscheiben erhalten sind. Ich kann mich keines
Glasgemäldes aus der Zeit von 1500 bis circa
1504 erinnern, in welchem die Wappen in einer
heraldisch so ungewöhnlichen Weise im Paß-
feld eingelassen sind, wie sie auf dem Darm-
städter und Pariser Blatt vorkommen. Bekannt-
lich erscheinen die gleichen Dreipaßfelder auch
auf den Zeichnungen zu Braunschweig, Berlin,
München und London (zwei Zeichnungen), nur
sind sie unausgefüllt geblieben. Ein einziges der
gezeichneten Blätter, das in der Albertina, zeigt
dieses Dreipaßfeld nicht. Meines Erachtens
handelt es sich hier um einen Zyklus von Wandgemälden in einem Refektorium, die an der Oberwand, oberhalb der
Fenster, gedeckt waren, und die Dreipaßfelder waren die Fensteröffnungen, von denen zwei mit dem Wappen der Stifter
in Glasmalerei geschmückt waren. Nur an der Stelle der Wand, wo die auf der Wiener Zeichnung geschilderte Szene auf-
gemalt werden sollte, war kein Fenster. Für eine weitere Scheibe, eine runde, war wohl die auf der Albertinazeichnung
von 1501 erhaltene Darstellung bestimmt, die von derselben Künstlerhand herrührt und von der schon die Rede war
(Abb. bei Roettinger T. III). Nach Dodgson sind die beiden Allianzwappen die der Ketzler (Katze) und Geuschmied,
während das Nürnberger Staatsarchiv der Ansicht ist, daß es sich bei dem zweiten um die Familie Pfintzing (»Pfintzing
mit dem Adler, Pfintzing die Alten«) handelt. Nach Mitteilung desselben Institutes hat allerdings eine eheliche Verbindung
zwischen den Ketzler und Pfintzing, wenigstens nach Ausweis des im Staatsarchiv befindlichen von Melchior Pfintzing
vielleicht um die Mitte des XVII. Jahrhunderts angelegten, mit vielen Porträten ausgestatteten Geschlechterbuches niemals
stattgefunden. Möglicherweise bietet aber das große Geschlechterbuch der Pfintzing, das im Anfang des XVI. Jahr-
hunderts entstand, zahlreiche Aquarelle enthält und dem Archiv der hallerischen Familienstiftung in Großgründlach ge-
hörte, einen Hinweis auf eine solche Allianz oder eine gemeinsame Stiftung.
Die Darstellungen aus dem Leben des Heiligen spielen sich entweder im Innern eines Hauses oder in der Land-
schaft ab. Im letzteren Falle erblicken wir fast überall, auf den Blättern zu Berlin, München, London (Burlington
Magazine 1918) und Darmstadt, als integrierenden Bestandteil der Landschaft den polygonalen gotischen Chorabschluß,
entweder im Hintergrund als ganzes Bauwerk oder noch öfters im Vordergrund als Ausschnitt, mit Strebepfeilern und
Fenstern, aus denen in zwei Fällen die Halbfigur des Titelheiligen oder eines seiner Brüder herausblickt. Bei dem
Abb. 14. Hans Baidung, Die Kreuzannagelung
Holzschnitt, um 1505—06.
det, zwei seither aufgetauchte hat C. Dodgson
in der »Vasari Society« (VI, Nr. 26) und im
»Burlington Magazine« (XXXII, Februar 1918)
abgebildet und besprochen. Sie veranschau-
lichen zwei weitere Begebenheiten aus dem
Leben des Heiligen, die erstere, im Britischen
Museum, zeigt den Versuch des Presbyters
Florentinus, den Heiligen zu vergiften, und die
zweite (in Londoner Privatbesitz) schildert den
Besuch Benedikts bei seiner Schwester Schola-
stika. Besonders das letztgenannte Blatt ist für
uns sehr wichtig, weil es im Gegensatz zu den
sieben schon früher bekannten auch Frauen-
gestalten und -köpfe zeigt; denn einzig auf der
Versuchung des Heiligen im Darmstädter
Museum erscheint ein junges, reichgekleidetes
Mädchen, sonst erblicken wir auf diesen Blättern
nur Männer.
Campbell Dodgson nimmt an, daß es sich
bei diesen Handzeichnungen um die Entwürfe
für Glasgemälde handelt, die für irgendeine Be-
nediktinerabtei in der Nähe von Nürnberg be-
stimmt waren. So sehr ich der letzteren Ansicht
beistimme, so wenig kann ich mich mit der
Theorie befreunden, daß hier Visierungen für
Glasscheiben erhalten sind. Ich kann mich keines
Glasgemäldes aus der Zeit von 1500 bis circa
1504 erinnern, in welchem die Wappen in einer
heraldisch so ungewöhnlichen Weise im Paß-
feld eingelassen sind, wie sie auf dem Darm-
städter und Pariser Blatt vorkommen. Bekannt-
lich erscheinen die gleichen Dreipaßfelder auch
auf den Zeichnungen zu Braunschweig, Berlin,
München und London (zwei Zeichnungen), nur
sind sie unausgefüllt geblieben. Ein einziges der
gezeichneten Blätter, das in der Albertina, zeigt
dieses Dreipaßfeld nicht. Meines Erachtens
handelt es sich hier um einen Zyklus von Wandgemälden in einem Refektorium, die an der Oberwand, oberhalb der
Fenster, gedeckt waren, und die Dreipaßfelder waren die Fensteröffnungen, von denen zwei mit dem Wappen der Stifter
in Glasmalerei geschmückt waren. Nur an der Stelle der Wand, wo die auf der Wiener Zeichnung geschilderte Szene auf-
gemalt werden sollte, war kein Fenster. Für eine weitere Scheibe, eine runde, war wohl die auf der Albertinazeichnung
von 1501 erhaltene Darstellung bestimmt, die von derselben Künstlerhand herrührt und von der schon die Rede war
(Abb. bei Roettinger T. III). Nach Dodgson sind die beiden Allianzwappen die der Ketzler (Katze) und Geuschmied,
während das Nürnberger Staatsarchiv der Ansicht ist, daß es sich bei dem zweiten um die Familie Pfintzing (»Pfintzing
mit dem Adler, Pfintzing die Alten«) handelt. Nach Mitteilung desselben Institutes hat allerdings eine eheliche Verbindung
zwischen den Ketzler und Pfintzing, wenigstens nach Ausweis des im Staatsarchiv befindlichen von Melchior Pfintzing
vielleicht um die Mitte des XVII. Jahrhunderts angelegten, mit vielen Porträten ausgestatteten Geschlechterbuches niemals
stattgefunden. Möglicherweise bietet aber das große Geschlechterbuch der Pfintzing, das im Anfang des XVI. Jahr-
hunderts entstand, zahlreiche Aquarelle enthält und dem Archiv der hallerischen Familienstiftung in Großgründlach ge-
hörte, einen Hinweis auf eine solche Allianz oder eine gemeinsame Stiftung.
Die Darstellungen aus dem Leben des Heiligen spielen sich entweder im Innern eines Hauses oder in der Land-
schaft ab. Im letzteren Falle erblicken wir fast überall, auf den Blättern zu Berlin, München, London (Burlington
Magazine 1918) und Darmstadt, als integrierenden Bestandteil der Landschaft den polygonalen gotischen Chorabschluß,
entweder im Hintergrund als ganzes Bauwerk oder noch öfters im Vordergrund als Ausschnitt, mit Strebepfeilern und
Fenstern, aus denen in zwei Fällen die Halbfigur des Titelheiligen oder eines seiner Brüder herausblickt. Bei dem
Abb. 14. Hans Baidung, Die Kreuzannagelung
Holzschnitt, um 1505—06.