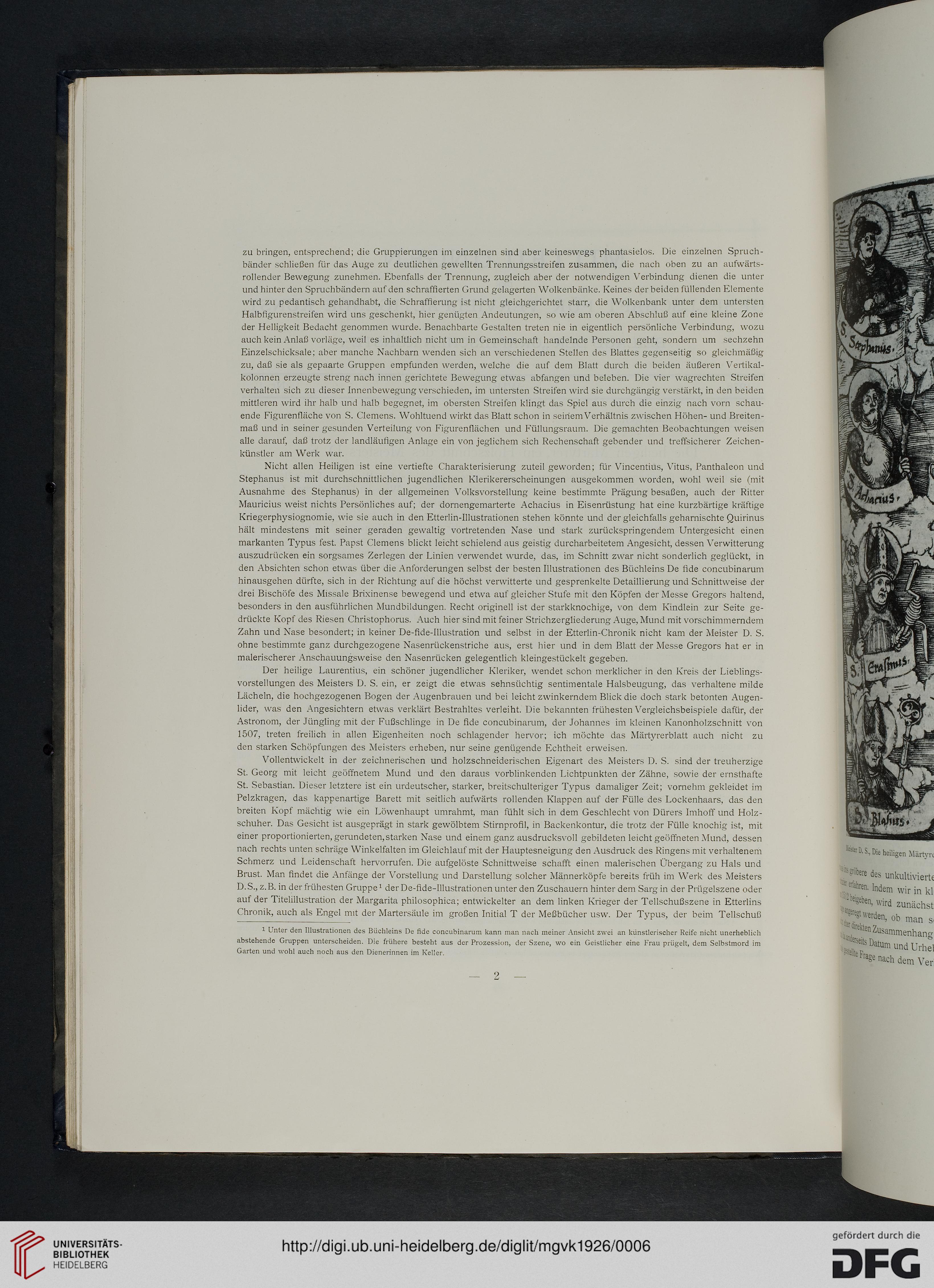zu bringen, entsprechend; die Gruppierungen im einzelnen sind aber keineswegs phantasielos. Die einzelnen Spruch-
bänder schließen für das Auge zu deutlichen gewellten Trennungsstreifen zusammen, die nach oben zu an aufwärts-
rollender Bewegung zunehmen. Ebenfalls der Trennung, zugleich aber der notwendigen Verbindung dienen die unter
und hinter den Spruchbändern auf den schraffierten Grund gelagerten Wolkenbänke. Keines der beiden füllenden Elemente
wird zu pedantisch gehandhabt, die Schraffierung ist nicht gleichgerichtet starr, die Wolkenbank unter dem untersten
Halbfigurenstreifen wird uns geschenkt, hier genügten Andeutungen, so wie am oberen Abschluß auf eine kleine Zone
der Helligkeit Bedacht genommen wurde. Benachbarte Gestalten treten nie in eigentlich persönliche Verbindung, wozu
auch kein Anlaß vorläge, weil es inhaltlich nicht um in Gemeinschaft handelnde Personen geht, sondern um sechzehn
Einzelschicksale; aber manche Nachbarn wenden sich an verschiedenen Stellen des Blattes gegenseitig so gleichmäßig
zu, daß sie als gepaarte Gruppen empfunden werden, welche die auf dem Blatt durch die beiden äußeren Vertikal-
kolonnen erzeugte streng nach innen gerichtete Bewegung etwas abfangen und beleben. Die vier wagrechten Streifen
verhalten sich zu dieser Innenbewegung verschieden, im untersten Streifen wird sie durchgängig verstärkt, in den beiden
mittleren wird ihr halb und halb begegnet, im obersten Streifen klingt das Spiel aus durch die einzig nach vorn schau-
ende Figurenfläche von S. Clemens. Wohltuend wirkt das Blatt schon in seinem Verhältnis zwischen Hohen- und Breiten-
maß und in seiner gesunden Verteilung von Figurenflächen und Füllungsraum. Die gemachten Beobachtungen weisen
alle darauf, daß trotz der landläufigen Anlage ein von jeglichem sich Rechenschaft gebender und treffsicherer Zeichen-
künstler am Werk war.
Nicht allen Heiligen ist eine vertiefte Charakterisierung zuteil geworden; für Vincentius, Vitus, Panthaleon und
Stephanus ist mit durchschnittlichen jugendlichen Klerikererscheinungen ausgekommen worden, wohl weil sie (mit
Ausnahme des Stephanus) in der allgemeinen Volksvorstellung keine bestimmte Prägung besaßen, auch der Ritter
Mauricius weist nichts Persönliches auf; der dornengemarterte Achacius in Eisenrüstung hat eine kurzbärtige kräftige
Kriegerphysiognomie, wie sie auch in den Etterlin-Illustrationen stehen könnte und der gleichfalls geharnischte Quirinus
hält mindestens mit seiner geraden gewaltig vortretenden Nase und stark zurückspringendem Untergesicht einen
markanten Typus fest. Papst Clemens blickt leicht schielend aus geistig durcharbeiteten! Angesicht, dessen Verwitterung
auszudrücken ein sorgsames Zerlegen der Linien verwendet wurde, das, im Schnitt zwar nicht sonderlich geglückt, in
den Absichten schon etwas über die Anforderungen selbst der besten Illustrationen des Büchleins De fide concubinarum
hinausgehen dürfte, sich in der Richtung auf die höchst verwitterte und gesprenkelte Detaillierung und Schnittweise der
drei Bischöfe des Missale Brixinense bewegend und etwa auf gleicher Stufe mit den Köpfen der Messe Gregors haltend,
besonders in den ausführlichen Mundbildungen. Recht originell ist der starkknochige, von dem Kindlein zur Seite ge-
drückte Kopf des Riesen Christopherus. Auch hier sind mit feiner Strichzergliederung Auge, Mund mit vorschimmerndem
Zahn und Nase besondert; in keiner De-fide-Illustration und selbst in der Etterlin-Chronik nicht kam der Meister D. S.
ohne bestimmte ganz durchgezogene Nasenrückenstriche aus, erst hier und in dem Blatt der Messe Gregors hat er in
malerischerer Anschauungsweise den Nasenrücken gelegentlich kleingestückelt gegeben.
Der heilige Laurentius, ein schöner jugendlicher Kleriker, wendet schon merklicher in den Kreis der Lieblings-
vorstellungen des Meisters D. S. ein, er zeigt die etwas sehnsüchtig sentimentale Halsbeugung, das verhaltene milde
Lächeln, die hochgezogenen Bogen der Augenbrauen und bei leicht zwinkerndem Blick die doch stark betonten Augen-
lider, was den Angesichtern etwas verklärt Bestrahltes verleiht. Die bekannten frühesten Vergleichsbeispiele dafür, der
Astronom, der Jüngling mit der Fußschlinge in De fide concubinarum, der Johannes im kleinen Kanonholzschnitt von
1507, treten freilich in allen Eigenheiten noch schlagender hervor; ich möchte das Märtyrerblatt auch nicht zu
den starken Schöpfungen des Meisters erheben, nur seine genügende Echtheit erweisen.
Vollentwickelt in der zeichnerischen und holzschneiderischen Eigenart des Meisters D. S. sind der treuherzige
St. Georg mit leicht geöffnetem Mund und den daraus vorblinkenden Lichtpunkten der Zähne, sowie der ernsthafte
St. Sebastian. Dieser letztere ist ein urdeutscher, starker, breitschulteriger Typus damaliger Zeit; vornehm gekleidet im
Pelzkragen, das kappenartige Barett mit seitlich aufwärts rollenden Klappen auf der Fülle des Lockenhaars, das den
breiten Kopf mächtig wie ein Löwenhaupt umrahmt, man fühlt sich in dem Geschlecht von Dürers Imhoff und Holz-
schuher. Das Gesicht ist ausgeprägt in stark gewölbtem Stirnprofil, in Backenkontur, die trotz der Fülle knochig ist, mit
einer proportionierten, gerundeten, starken Nase und einem ganz ausdrucksvoll gebildeten leicht geöffneten Mund, dessen
nach rechts unten schräge Winkelfalten im Gleichlauf mit der Hauptesneigung den Ausdruck des Ringens mit verhaltenem
Schmerz und Leidenschaft hervorrufen. Die aufgelöste Schnittweise schafft einen malerischen Übergang zu Hals und
Brust. Man findet die Anfänge der Vorstellung und Darstellung solcher Männerköpfe bereits früh im Werk des Meisters
D.S., z.B. in der frühesten Gruppe1 der De-fide-Illustrationen unter den Zuschauern hinter dem Sargin der Prügelszene oder
auf der Titelillustration der Margarita philosophica; entwickelter an dem linken Krieger der Tellschußszene in Etterlins
Chronik, auch als Engel mit der Martersäule im großen Initial T der Meßbücher usw. Der Typus, der beim Tellschuß
1 Unter den Illustrationen des Büchleins De fide concubinarum kann man nach meiner Ansicht zwei an künstlerischer Reife nicht unerheblich
abstehende Gruppen unterscheiden. Die frühere besteht aus der Prozession, der Szene, wo ein Geistlicher eine Frau prügelt, dem Selbstmord im
Garten und wohl auch noch aus den Dienerinnen im Keller.
bänder schließen für das Auge zu deutlichen gewellten Trennungsstreifen zusammen, die nach oben zu an aufwärts-
rollender Bewegung zunehmen. Ebenfalls der Trennung, zugleich aber der notwendigen Verbindung dienen die unter
und hinter den Spruchbändern auf den schraffierten Grund gelagerten Wolkenbänke. Keines der beiden füllenden Elemente
wird zu pedantisch gehandhabt, die Schraffierung ist nicht gleichgerichtet starr, die Wolkenbank unter dem untersten
Halbfigurenstreifen wird uns geschenkt, hier genügten Andeutungen, so wie am oberen Abschluß auf eine kleine Zone
der Helligkeit Bedacht genommen wurde. Benachbarte Gestalten treten nie in eigentlich persönliche Verbindung, wozu
auch kein Anlaß vorläge, weil es inhaltlich nicht um in Gemeinschaft handelnde Personen geht, sondern um sechzehn
Einzelschicksale; aber manche Nachbarn wenden sich an verschiedenen Stellen des Blattes gegenseitig so gleichmäßig
zu, daß sie als gepaarte Gruppen empfunden werden, welche die auf dem Blatt durch die beiden äußeren Vertikal-
kolonnen erzeugte streng nach innen gerichtete Bewegung etwas abfangen und beleben. Die vier wagrechten Streifen
verhalten sich zu dieser Innenbewegung verschieden, im untersten Streifen wird sie durchgängig verstärkt, in den beiden
mittleren wird ihr halb und halb begegnet, im obersten Streifen klingt das Spiel aus durch die einzig nach vorn schau-
ende Figurenfläche von S. Clemens. Wohltuend wirkt das Blatt schon in seinem Verhältnis zwischen Hohen- und Breiten-
maß und in seiner gesunden Verteilung von Figurenflächen und Füllungsraum. Die gemachten Beobachtungen weisen
alle darauf, daß trotz der landläufigen Anlage ein von jeglichem sich Rechenschaft gebender und treffsicherer Zeichen-
künstler am Werk war.
Nicht allen Heiligen ist eine vertiefte Charakterisierung zuteil geworden; für Vincentius, Vitus, Panthaleon und
Stephanus ist mit durchschnittlichen jugendlichen Klerikererscheinungen ausgekommen worden, wohl weil sie (mit
Ausnahme des Stephanus) in der allgemeinen Volksvorstellung keine bestimmte Prägung besaßen, auch der Ritter
Mauricius weist nichts Persönliches auf; der dornengemarterte Achacius in Eisenrüstung hat eine kurzbärtige kräftige
Kriegerphysiognomie, wie sie auch in den Etterlin-Illustrationen stehen könnte und der gleichfalls geharnischte Quirinus
hält mindestens mit seiner geraden gewaltig vortretenden Nase und stark zurückspringendem Untergesicht einen
markanten Typus fest. Papst Clemens blickt leicht schielend aus geistig durcharbeiteten! Angesicht, dessen Verwitterung
auszudrücken ein sorgsames Zerlegen der Linien verwendet wurde, das, im Schnitt zwar nicht sonderlich geglückt, in
den Absichten schon etwas über die Anforderungen selbst der besten Illustrationen des Büchleins De fide concubinarum
hinausgehen dürfte, sich in der Richtung auf die höchst verwitterte und gesprenkelte Detaillierung und Schnittweise der
drei Bischöfe des Missale Brixinense bewegend und etwa auf gleicher Stufe mit den Köpfen der Messe Gregors haltend,
besonders in den ausführlichen Mundbildungen. Recht originell ist der starkknochige, von dem Kindlein zur Seite ge-
drückte Kopf des Riesen Christopherus. Auch hier sind mit feiner Strichzergliederung Auge, Mund mit vorschimmerndem
Zahn und Nase besondert; in keiner De-fide-Illustration und selbst in der Etterlin-Chronik nicht kam der Meister D. S.
ohne bestimmte ganz durchgezogene Nasenrückenstriche aus, erst hier und in dem Blatt der Messe Gregors hat er in
malerischerer Anschauungsweise den Nasenrücken gelegentlich kleingestückelt gegeben.
Der heilige Laurentius, ein schöner jugendlicher Kleriker, wendet schon merklicher in den Kreis der Lieblings-
vorstellungen des Meisters D. S. ein, er zeigt die etwas sehnsüchtig sentimentale Halsbeugung, das verhaltene milde
Lächeln, die hochgezogenen Bogen der Augenbrauen und bei leicht zwinkerndem Blick die doch stark betonten Augen-
lider, was den Angesichtern etwas verklärt Bestrahltes verleiht. Die bekannten frühesten Vergleichsbeispiele dafür, der
Astronom, der Jüngling mit der Fußschlinge in De fide concubinarum, der Johannes im kleinen Kanonholzschnitt von
1507, treten freilich in allen Eigenheiten noch schlagender hervor; ich möchte das Märtyrerblatt auch nicht zu
den starken Schöpfungen des Meisters erheben, nur seine genügende Echtheit erweisen.
Vollentwickelt in der zeichnerischen und holzschneiderischen Eigenart des Meisters D. S. sind der treuherzige
St. Georg mit leicht geöffnetem Mund und den daraus vorblinkenden Lichtpunkten der Zähne, sowie der ernsthafte
St. Sebastian. Dieser letztere ist ein urdeutscher, starker, breitschulteriger Typus damaliger Zeit; vornehm gekleidet im
Pelzkragen, das kappenartige Barett mit seitlich aufwärts rollenden Klappen auf der Fülle des Lockenhaars, das den
breiten Kopf mächtig wie ein Löwenhaupt umrahmt, man fühlt sich in dem Geschlecht von Dürers Imhoff und Holz-
schuher. Das Gesicht ist ausgeprägt in stark gewölbtem Stirnprofil, in Backenkontur, die trotz der Fülle knochig ist, mit
einer proportionierten, gerundeten, starken Nase und einem ganz ausdrucksvoll gebildeten leicht geöffneten Mund, dessen
nach rechts unten schräge Winkelfalten im Gleichlauf mit der Hauptesneigung den Ausdruck des Ringens mit verhaltenem
Schmerz und Leidenschaft hervorrufen. Die aufgelöste Schnittweise schafft einen malerischen Übergang zu Hals und
Brust. Man findet die Anfänge der Vorstellung und Darstellung solcher Männerköpfe bereits früh im Werk des Meisters
D.S., z.B. in der frühesten Gruppe1 der De-fide-Illustrationen unter den Zuschauern hinter dem Sargin der Prügelszene oder
auf der Titelillustration der Margarita philosophica; entwickelter an dem linken Krieger der Tellschußszene in Etterlins
Chronik, auch als Engel mit der Martersäule im großen Initial T der Meßbücher usw. Der Typus, der beim Tellschuß
1 Unter den Illustrationen des Büchleins De fide concubinarum kann man nach meiner Ansicht zwei an künstlerischer Reife nicht unerheblich
abstehende Gruppen unterscheiden. Die frühere besteht aus der Prozession, der Szene, wo ein Geistlicher eine Frau prügelt, dem Selbstmord im
Garten und wohl auch noch aus den Dienerinnen im Keller.